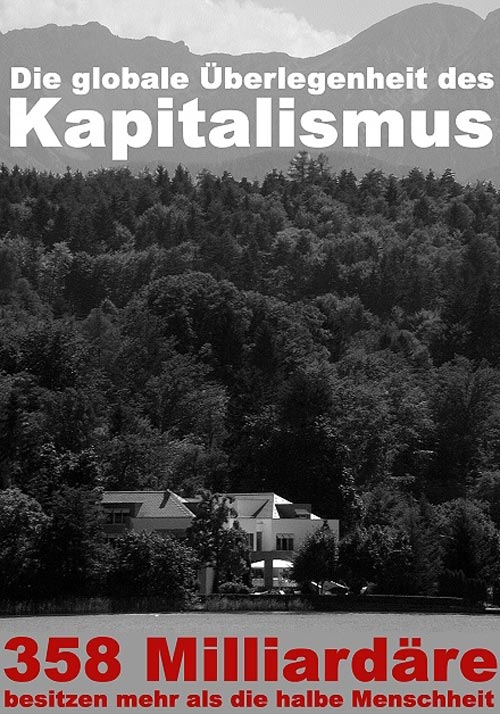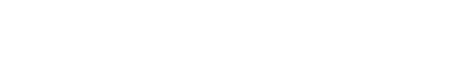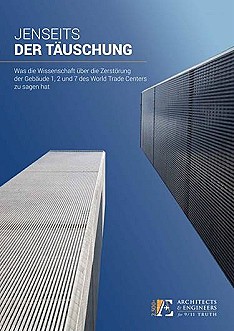SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Arbeit und Soziales
Die neuen Unterschichten in der Soziologie deutscher Professoren
"Krieg dem Pöbel" Teil 3/3
Von Hans Otto Rößer
Empirische Untersuchungen zu subjektiven Orientierungen der „Ausgeschlossenen“
Die deutsche „Unterschichtendebatte“ kann nicht nur in den Kontext der bis ins 18. Jahrhundert zurückreichende Tradition einer Rhetorik der Reaktion (Hirschman) gestellt werden, sie liest sich streckenweise wie eine Kopie der underclass–Debatte in den 1980er Jahren der USA, in der eine Verbindung von Auftragswissenschaft und Mediensturm die Anti-Sozialpolitik der Reagan-Administration rechtfertigte. Loic Wacquant hat bereits 1996 einen lesenswerten Aufsatz verfasst, der diese Debatten rekonstruiert, und dabei an die zeitgenössische Kritik von Douglas G. Glasgow erinnert, der den Akteuren dieser Debatte die Geburt von drei „gefährlichen Mythen“ vorgehalten hat:
– Jugendliche in den Ghettos hätten kein Interesse am sozialen Aufstieg.
– Sie besäßen keine Motivation zur Arbeit.
– Sie hätten große Eile, die Zahl der Sozialhilfe Empfänger zu vergrößern. (Wacquant 2008, S. 65 f.)
Diese nun auch in der deutschen „Debatte“ wieder aufgelegten Mythen widersprechen nicht nur den Erfahrungen der professionell mit diesen Menschen Befassten. Diese Erfahrungen haben mittlerweile selbst in die FAZ Eingang gefunden (vgl. Soldt 2008, S. 3) und sie werden durch neuere Ergebnisse empirischer Sozialforschung bestätigt.
Einschlägig sind hier die Untersuchungen des Sonderforschungsbereichs 580 „Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch“ am Institut für Soziologie der Universität Jena unter Leitung von Klaus Dörre, und zwar das Projekt „Eigensinnige Kunden. Der Einfluss strenger Zumutbarkeit auf die Erwerbsorientierung Arbeitsloser und prekär Beschäftigter“. In ihm geht es um Folgendes:
„Im Projekt wird die Transformation subjektiver Erwerbsorientierungen in den unteren Segmenten der Arbeitsgesellschaft im Zuge einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik untersucht. Im Mittelpunkt stehen die Wechselbeziehungen zwischen solchen Orientierungen bzw. Handlungsstrategien der betroffenen Personen und den Aktivierungsdiskursen sowie Instrumenten und Maßnahmen des Forderns und Förderns. In der ersten Projektphase liegt der Fokus auf folgenden Fragestellungen: Wie setzen sich die Adressaten einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik mit den veränderten, strengeren Anforderungen auseinander? Führt diese Auseinandersetzung zu Veränderungen von vorhandenen Erwerbsorientierungen? Warum orientieren sich bestimmte Gruppen weiter am ersten Arbeitsmarkt, während andere sich in Prekarität und Ausgrenzung einzurichten beginnen? Anders als die dezidiert effizienzorientierte Evaluationsforschung wollen wir diese Transformation aus der Perspektive der Adressaten aktivierender Arbeitspolitik rekonstruieren.“

Oft keine Unterschichtenmentalität, sondern widerstandswillig
In den Regionen Bremen, Bremerhaven (im Westen) und in Jena sowie im Saale-Orla–Kreis (im Osten) wurden bis jetzt 53 Experteninterviews mit relevanten Akteuren der arbeitsmarktpolitischen Praxis geführt und in denselben Gebieten bislang 99 Interviews mit „aktivierten“, langzeitarbeitslosen Leistungsempfängern. „In einer zweiten Projektphase ist eine Wiederholungsbefragung der Adressaten und die Ausweitung des interregionalen Vergleichs geplant. Zugleich soll das Projekt um eine internationale Vergleichsperspektive ergänzt werden.“
Der generelle Befund dieser Untersuchung lautet: Für das „Bild einer kulturell relativ homogenen, aufstiegsunwilligen Unterschicht“ und die „Diagnose einer kulturell verfestigten Unterschichtenmentalität“ gibt es keine empirischen Anhaltspunkte (Dörre 2008, S. 11). „In deutlichem Kontrast, ja häufig in krassem Widerspruch zur generalisierenden Passivitätsvermutungen, sind die von uns befragten Arbeitslosen und prekär Beschäftigten durchaus aktiv. In ihrer großen Mehrzahl streben sie unabhängig von strengen Zumutbarkeitsregeln nach einer regulären, Existenz sichernden und sozial anerkannten Erwerbsarbeit.“ (Ebd., S. 19) M. a. W.: Der erstaunliche Befund der Untersuchung besteht darin, dass Menschen, die aus der „Zone der Integration“ auf unabsehbare Weise ausgeschlossen sind und in die „Zone der Prekarität“ bzw. in die „Zone der dauerhaften Entkopplung“ abgerutscht sind, dennoch an den ideologischen Werten einer sozialstaatlich eingehegten Lohnarbeit festhalten, und zwar relativ unbeeindruckt von der lebenspraktisch strukturierenden Wirkung der Langzeitarbeitslosigkeit, also relativ unabhängig davon, ob und wann sie diese Erwerbsorientierung in eine praktische Lebensführung umsetzen können (ebd. S. 31). [8]
Allerdings bleibt die Erwerbsorientierung von der objektiven Lebenslage nicht unbeeinflusst, sondern erfährt, abhängig von den jeweiligen Chancen am Arbeitsmarkt, von Lebensalter und von biographischen Erfahrungen und akuter Lebenssituation usw., Ausprägungen und Modifizierungen, die die Jenaer Untersuchung zu drei Gruppen gebündelt hat:
.jpg)
„Arbeit, Arbeit über Alles" – gilt offenbar nicht für jeden
Fotos: arbeiterfotografie.com
Die „Um-Jeden-Preis-Arbeiter“ (S. 20 ff.): Zu ihnen zählen neben vielen Aufstockern und Selbstständigen auch junge, relativ gut ausgebildete Arbeitslose. Aus dem Interviewmaterial wird u.a. eine junge Frau zitiert, die zwischen ihrem ersten und zweiten Kind den Schulabschluss in der Abendschule nachgeholt und dann eine Ausbildung im zahntechnischen Bereich absolviert hat (S. 22). Die Autoren sehen in ihr ein Beispiel dafür, „dass der Aktivierungsimpuls nicht von strengen Zumutbarkeitsregeln ausging, sondern in einer normativen Grundorientierung tief verankert ist“ (S. 23).
Die „Als-ob-Arbeitenden“ (S. 23 ff.): Sie halten an der Erwerbsorientierung fest, suchen aber aufgrund anhaltender Erwerbslosigkeit und nach vielfältigen Enttäuschungserfahrungen nach Alternativen und Kompensationen. Es öffnet sich eine wachsende Kluft zwischen normativer Orientierung und gelebten Handlungsstrategien mit dem Zwang zur Aufrechterhaltung von Normalitätsfassaden (So tun, als gehe man zur Arbeit; der Ein-Euro-Job wird gegenüber Nachbarn und Freunden als Normalarbeitsverhältnis ausgegeben, ehrenamtliche Arbeit als Ersatz für Erwerbsarbeit). Die Tragfähigkeit solcher Überbrückungsversuche hängt entscheidend ab von der Wertschätzung, die die Betroffenen in ihrer ‚Ersatztätigkeit’ erfahren, und von dem Prestige, das sie ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich zumessen bzw. das diesem Bereich gesellschaftlich zugemessen wird.
Die Gruppe der bewussten „Nicht-Arbeiter“ (S. 25 ff.): Die Autoren subsumieren hierunter Formen des (temporären oder andauernden) (Selbst-) Ausschlusses und der Einkapselung aufgrund der Antizipation tatsächlicher oder vermeintlicher Chancenlosigkeit im Blick auf eine gesellschaftliche Integration durch Erwerbsarbeit. Formen dieses (Selbst-) Ausschlusses und der Einkapselung, also der individuellen Reproduktion von „Exklusion“ wären die „Flucht“ in die Mutterrolle oder alle Versuche, Anerkennung in der Familie oder in einer „Szene“ zu finden. Selbst wenn in diesen Formen „Anerkennung“ gefunden wird, ist den Betroffenen bewusst, dass es sich um eine „Privatisierung der Herstellung von Anerkennung“ handelt (vgl. Marquardsen 2008, S. 53), also nur um ein Surrogat der gesuchten und gewünschten öffentlichen Anerkennung durch Integration in die Arbeitsgesellschaft. Das macht diese Ersatzformen von Anerkennung in sich brüchig (s.u.). Zu den Formen der (Selbst-) Reproduktion von „Exklusion“ gehört aber auch das, was auf den ersten Blick als Arbeitsverweigerung erscheint. Die Verfasser zeigen die Ambivalenz dieses Verhaltens eindrucksvoll am Fall von „Herrn Müller“:
„Herr Müller ist 19 Jahre alt und lebt bei seiner Mutter. Sie war schon häufiger arbeitslos und erhält zu ihrem Minijob ergänzend ALG II; eine Schwester ist Mutter und Hausfrau. Eine weitere Schwester habe es „am weitesten in der Familie gebracht“: „Ja und meine andere Schwester, die arbeitet als, keine Ahnung, jedenfalls was Besseres … Bin ich auch stolz. Die ist sehr gut … Die hat immer gelernt und alles.“ Herr Müller absolviert zum Interviewzeitpunkt eine Maßnahme, die den Hauptschulabschluss zum Ziel hat. Aus der Sicht der ARGE gehört er zu denen, die kaum Eigeninitiative zeigen und aufgrund ihres Alters sowie der Vermittlungsdefizite gefordert und gefördert werden müssen. Da Herr Müller schon mehrere Maßnahmen abgebrochen hat, gilt er als unwillig und unfähig. Der Maßnahmeträger prognostiziert, dass er den Hauptschulabschluss wiederum nicht erreichen wird, u.a. weil er häufig unentschuldigt fehlt. Das Verhältnis zu den Mitarbeitern der ARGE beschreibt Herr Müller als widersprüchlich – einerseits als Autonomieverlust, andererseits aber auch als Unterstützung: „Da sind schon ein paar, die eigentlich ganz nett sind, aber das ist halt das, was ich schon sagte, dass die von oben herab, das ist das, was nervt. Die reden halt mit Dir, als ob Du Scheiße wärst …“ (S. 26)
Bei näherer Betrachtung zeige Herr Müllers „Arbeitsverweigerung“, dass er eigentlich „richtig“ arbeiten will, anstatt in Ersatzmaßnahmen gesteckt zu werden. In seinem Verhalten diffundieren Wahrnehmungen von Chancen und von Chancenlosigkeit. Dass die Ersatzmaßnahmen, in die er gesteckt wird, Verwahrungen sind, hat er mehrmals erfahren. Er hält die ihm aufgezeigten Wege für „wenig realistisch“. Gleichzeitig aber weiß er, dass der Abbruch der Maßnahme zur Erlangung des Hauptschulabschlusses auch keine Lösung seiner Probleme ist. Damit befindet sich „Herr Müller“ eher noch an der Schwelle zu einer bewussten Orientierung auf Nichtarbeit.
Wichtig ist noch die Beobachtung, dass, sollte „Herr Müller“ aus der Maßnahme aussteigen, die dann zu erwartenden Sanktionen der Leistungskürzung nicht greifen, weil sie durch Überlebenstechniken der informellen Arbeit, durch die Familie und andere sozialen Kontakte zumindest teilweise kompensiert werden können.
Konsequenzen für den Unterricht
Wenn man der Meinung ist: so geht es nicht, man kann unseren Studierenden in der Hauptschule nicht dauernd diese Zerrspiegel des bürgerlichen Vorurteils über die Unterschichten vorhalten, ergeben sich für Prüfung und Unterricht folgende Optionen:
Man lässt die Finger von Problemthemen. Man reagiert auf zweifellos vorhandene und problematische Tendenzen der Kultur von Unterschichten-Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Ignorieren. Das ließe sich so nur rechtfertigen, wenn in einer Lerngruppe solche aus der Sicht der Mittelschichten anrüchigen Verhaltensweisen nicht vertreten wären. Das dürfte eher ausnahmsweise der Fall sein.
Man setzt auf einen Perspektivenmix: Es gibt auch Erfahrungen der Erfolgs: Bewährungen in der Schule, neue Jobs, Entdeckung neuer Möglichkeiten und Entwicklung neuer Fähigkeiten. Das wäre realistischer im Blick auf die Zusammensetzung unserer Hauptschulklasse und käme dem pädagogischen Optimismus entgegen. Die stabileren unter den Studierenden mit einem konkreten und beharrlich verfolgten Ziel setzten die Themen, bestimmen das Unterrichtsklima und reißen die skeptischen und schwankenden, deren Unterrichtsbeteiligung eher diskontinuierlich ist, mit. Das wäre schön, das kann sogar mal funktionieren, aber nicht immer.
Aber auch in diesem nicht sehr wahrscheinlichen Fall stellt sich die Frage, wie mit den weniger schönen und braven Verhaltensweisen im Unterricht umgegangen werden kann. Diese Frage wird unabweisbar dann, wenn es sich um Studierende handelt, die nicht freiwillig gekommen sind, um ein selbstgesetztes Bildungsziel zu erreichen, sondern die von der Arbeitsagentur die Auflage bekommen haben, unser Bildungsangebot wahrzunehmen. Und wenn die Klasse, wie dies an einigen Schulen bereits der Fall war, ein Kooperationsprojekt ist, kann es sein, dass nur solche Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen ihr angehören.
In einem solchen Fall ist es vorgekommen, dass der Kooperationspartner von unseren Kolleginnen und Kollegen verlangte, dass man auf keinen Fall über die geringen Chancen eines Hauptschulabschlusses im Unterricht reden dürfe, denn das würde die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Maßnahme nur demotivieren. Dumm war nur, dass eben diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bald befürchteten, dass ihre Hoffnungen in die Maßnahme sich nicht erfüllten, und damit ihre zunehmenden Fehlzeiten begründeten. Auch die, die freiwillig in unsere Hauptschulklassen kommen, können die Frage nach der Perspektive über den Hauptschulabschluss hinaus nicht verdrängen und nicht immer gelingt es ihnen, angesichts möglicher nicht sehr rosiger Aussichten rational mit der Institution Schule umzugehen. Dies gelingt am ehesten denen, die schon eine klare Perspektive über den Hauptschulabschluss hinaus haben. [9]
Man kann also gar nicht die Frage umgehen, ob es eine Alternative zum Beaufsichtigungsdiskurs, der die Abschlussprüfungen Deutsch beherrscht, und zur Problemtabuisierung gibt.
Man könnte den Beaufsichtigungsdiskurs natürlich einfach umwerten und dem konservativen Blick auf die Unteren als Barbaren das romantische Bild vom mehr oder weniger edlen Wilden entgegensetzen. Die symbolischen Praktiken und Gewaltrituale sind allerdings roh und brutal und wenig edel. Man kann sogar feststellen: sie haben „eine reproduktive Funktion hinsichtlich der konservativen Ideologie“ (und der bestehenden Verhältnisse) (Willis 1982, S. 271). Kochs Wahlkampf in Hessen 2007/08 ist nicht an der Zurückweisung dieser Ideologie gescheitert, sondern daran, dass ihm nachgewiesen wurde, dass seine Sparpolitik nicht nur Sozialstaatsfunktionen, sondern auch die des Sicherheitsstaates so untergraben hat, dass die von ihm eingeforderten Maßnahmen des Überwachens und Strafens unzulänglicher umgesetzt werden als in anderen Bundesländern. Kann es daher etwas anderes geben, als die Praktiken der Körperinszenierung und des Rauschs, des Eskapismus und der Störungen, des Machismo, der Schlägereien und der Einschüchterung als „unvernünftig“ und „barbarisch“ zu verdammen und den Beck zu machen: „Wascht euch, rasiert euch, kämmt euch und hört auf, (uns) zu stinken!“?
Für den Unterricht in der (Abend-) Hauptschule ist es von entscheidender Bedeutung, über diese Alternativen der Beaufsichtigung und Ermahnung, der Umwertung und Romantisierung oder des Ignorierens und Laufenlassens hinauszukommen. Die vielen gut gemeinten Fortbildungen und pädagogischen Tage zum Aufmerksamkeitsmanagement oder zur Methodenvielfalt kann man sich schenken, wenn man sich um diese Problematik drückt bzw. sie gar nicht erst wahrnimmt.
Die einfachsten Konsequenzen wären:
– Mehr Texte präsentieren, in denen die Betroffenen selbst zur Sprache kommen, in denen sie mehr sind als stumme Objekte, über die gesprochen und verfügt werden muss.
– Ernstmachen mit der Einsicht, dass auch das Leben von Troublemakern nicht von morgens bis abends im Trouble-Machen besteht.
Die schwierigen Fragen betreffen die gesamte Unterrichtsorganisation: Wie reagieren wir auf Störungen? Wie gehen wir vor, ohne zu ignorieren und zu beleidigen, und vermeiden dabei „jede simplistische Sympathiebekundung“ (Willis 1982, S. 272)? Wie stärken wir Einsicht und Illusionslosigkeit, ohne zu demotivieren und zu entmutigen? Wie motivieren wir, ohne Illusionen zu schaffen? Die Logik des hier im Anschluss an die Kritik Skizzierten legt es nahe, Fertigkeiten und Disziplin über die Durchführung einer Art sozialer Selbstanalyse zu fördern, die die Verschränkung von Einsichten und Selbstausschluss deutlich macht.
Mögliche Themen, mit deren Bearbeitung man diese Selbstanalyse erreichen könnte, wären:
– Rolle von Qualifikationen und die Bedeutung von Arbeit für die Studierenden
– Ihr Verhältnis zu geistiger und manueller Arbeit
– Die Verknüpfung von Tätigkeiten mit Geschlechterimages
– Rolle von Selbstbildern bei der Bewertung von Tätigkeiten und bei der Konfrontation mit Anforderungen; ist ihre Akzeptanz oder Zurückweisung auf Rationalität oder Irrationalität gegründet?
– Was bedeuten Störungen, Schlägereien, Eskapaden und was kommt dabei zum Ausdruck?
– Was bedeuten Cliquen und Freundschaften, was sind ihre Stärken und Schwächen?
Die Bearbeitung dieser Themen würde voraussetzen, dass die Lehrerinnen und Lehrer etwas über prekäre Lebensverhältnisse und ihre kulturell-symbolische Aneignung wüssten, um etwa auffällige und für sich allein genommen strikt zu verurteilende Verhaltensweisen auf diese kulturelle Ebene in ihrer relativen Einheit hin ‚lesen’ und verstehen zu können, anstatt sich davon nur persönlich beleidigt und abgestoßen zu fühlen. (HDH)
_________________________________________________________
[1] Wie unsinnig die Bezeichnung „öffentliche Soziologie“ ist, zeigt sich schon daran, wenn man sie mit ihrem Gegenteil konfrontiert: Ist alle bisherige/andere Soziologie „privat“ oder „geheim“? Haben nicht längst vor Bude und Nolte Ansätze des Fachs existiert, die sich „der prinzipiellen Erörterung öffentlicher Fragen“ (Bude 2008, S. 7) gewidmet haben? Lebt Soziologie – bei Strafe ihres Untergangs – nicht vielmehr davon, „öffentliche Fragen“ zu behandeln, im Einzelnen und Besonderen das Allgemeine zu entdecken, begrifflich zu arbeiten, um empirische Sachverhalte zu erklären?
[2] Das Wort wurde von Harald Schmitt popularisiert. Diejenigen, die sich heute über ein vermeintliches „Unterschichtenfernsehen“ mokieren, haben in den 80 er Jahren alles getan, die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten als an Hochkultur orientiertes, elitäres „Studienratsfernsehen“ zu attackieren und delegitimieren. Gestützt auf die „Kirch-Kohl-Allianz“ wurde aber 1982 eine Medienpolitik verfolgt, die dazu geführt hat, dass die Bundesrepublik heute mit mehr als 30 Privatsendern über das europaweit umfassendste Angebot verfügt: Mängel 2008, S. 111. Diese Medien orientieren sich an „Quoten“, d.h. sie bedienen eine Bevölkerungsgruppe, die größer als die Unterschichten ist, wie immer man diese quantitativ fasst (vgl. auch Winkler 2007, S. 117 f.)
[3] Hirschman identifiziert an der reaktionären Kritik an den Fortschritten der Freiheit seit 1789 drei rhetorische Hauptstrategien: eine Sinnverkehrungsthese, eine Vergeblichkeitsthese und eine Gefährdungsthese. Orientiert an T. H. Marshalls Drei-Jahrhunderte-Schema der Menschenrechte (individuelle Freiheitsrechte im 18., staatsbürgerliche Partizipationsrechte im 19. und soziale Anspruchsrechte im 20. Jahrhundert) zeigt er, wie diesen drei Entwicklungsschüben der Menschenrechte drei reaktionäre Wellen folgen. Das von ihm berücksichtigte Material ordnet er dann unter die genannten rhetorischen Strategien. Dabei fällt ihm auf: „fast jeder Gedanke, der eine Zeitlang aus dem allgemeinen Gesichtskreis verschwunden war, wird leicht mit einer neuen Einsicht verwechselt.“ (Ebd., S. 37)
[4] Zitiert nach Bultmann 2001, S.50. Bultmann zeigt in seinem instruktiven Aufsatz, wie die neoliberal gewendeten sozialdemokratischen Parteien in den 90er Jahren alle noch vorhandenen Verknüpfungsversuche zwischen Chancengleichheit und gesellschaftlicher Emanzipation und Gleichheit aufgelöst haben. Mit zum Teil demselben Material, aber ohne Bezug auf Bultmann: Solga 2005, S. 48 ff. - Auch der Berliner Professor für Historische Erziehungswissenschaft Heinz-Elmar Tenorth wendet sich, ähnlich wie Bude, gegen die „Illusion“ und das „unseriöse Versprechen“, durch Bildungschancen soziale Ungleichheit beseitigen zu wollen. Deutlicher aber als Bude zeigt Tenorths Argumentation, zu welchen Konsequenzen das „aufklärte falsche Bewusstsein“ seine Anleihen bei kritischer Gesellschaftsanalyse treibt. Weil reformistische Bildungspolitik nicht erreicht, was sie erreichen zu wollen vorgibt, lässt man sie am besten gleich ganz sein. Den „Risikogruppen“ des Bildungssystems sei ohnehin nicht zu helfen, da ihnen die „Grundeinstellung“ fehle und sie stattdessen dem Fatalismus und der Gewalt anhingen. Bildung sei in diesem Milieu weder verankert noch geachtet. In dieser Situation könne man nichts anderes tun, als das bestehende Bildungssystem aufrechtzuerhalten: „Man darf kein Bildungssystem installieren, in dem man die Eltern dafür bestraft, dass sie an die Bildungskarrieren ihrer Kinder denken. Und genau das tut man, wenn man zum Beispiel das Gymnasium abschafft.“ (Tenorth 2008, S. 37)
[5] Mit „schulgescheit“ werden (nicht nur in Hessen) Menschen bezeichnet, die in der Schule sehr gut waren, aber im Leben gescheitert sind bzw. eine eher bescheidene, wenig glamouröse Berufslaufbahn eingeschlagen haben.
[6] In den letzten Jahren sind die Jungen als Problemgruppe im Kontrast zu den Mädchen als Bildungsgewinnerinnen entdeckt oder erfunden worden. Merkwürdigerweise nehmen aber diese ‚defizitären’ Jungen immer noch die höheren und besser bezahlten Berufspositionen ein als die Mädchen. Offenbar eine weitere Form des Auseinandertretens von Schulerziehung und Produktion bzw. Beruf.
[7] Es wäre interessant zu untersuchen, inwieweit das Freizeitverhalten von beschäftigten Jugendlichen eingeschränkt oder verändert wird, wenn Jugendliche keine Beschäftigung finden. Eine Folie böte Willis 1991.
[8] Zu Castel vgl. Castel 2000; eine gute Einführung nicht nur in die französische Prekarisierungsforschung und –theorie gibt Stefanie Hürtgen 2008. Hinweise im oben zitierten Forschungsbericht finden sich auf den Seiten 12-14.
[9] Hierzu ausführlicher der Infobrief der Landesfachgruppe Erwachsenenbildung der GEW Hessen Nr. 20, August 2008: Wie lange noch Abendhauptschule?
Online-Flyer Nr. 172 vom 12.11.2008
Druckversion
Arbeit und Soziales
Die neuen Unterschichten in der Soziologie deutscher Professoren
"Krieg dem Pöbel" Teil 3/3
Von Hans Otto Rößer
Empirische Untersuchungen zu subjektiven Orientierungen der „Ausgeschlossenen“
Die deutsche „Unterschichtendebatte“ kann nicht nur in den Kontext der bis ins 18. Jahrhundert zurückreichende Tradition einer Rhetorik der Reaktion (Hirschman) gestellt werden, sie liest sich streckenweise wie eine Kopie der underclass–Debatte in den 1980er Jahren der USA, in der eine Verbindung von Auftragswissenschaft und Mediensturm die Anti-Sozialpolitik der Reagan-Administration rechtfertigte. Loic Wacquant hat bereits 1996 einen lesenswerten Aufsatz verfasst, der diese Debatten rekonstruiert, und dabei an die zeitgenössische Kritik von Douglas G. Glasgow erinnert, der den Akteuren dieser Debatte die Geburt von drei „gefährlichen Mythen“ vorgehalten hat:
– Jugendliche in den Ghettos hätten kein Interesse am sozialen Aufstieg.
– Sie besäßen keine Motivation zur Arbeit.
– Sie hätten große Eile, die Zahl der Sozialhilfe Empfänger zu vergrößern. (Wacquant 2008, S. 65 f.)
Diese nun auch in der deutschen „Debatte“ wieder aufgelegten Mythen widersprechen nicht nur den Erfahrungen der professionell mit diesen Menschen Befassten. Diese Erfahrungen haben mittlerweile selbst in die FAZ Eingang gefunden (vgl. Soldt 2008, S. 3) und sie werden durch neuere Ergebnisse empirischer Sozialforschung bestätigt.
Einschlägig sind hier die Untersuchungen des Sonderforschungsbereichs 580 „Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch“ am Institut für Soziologie der Universität Jena unter Leitung von Klaus Dörre, und zwar das Projekt „Eigensinnige Kunden. Der Einfluss strenger Zumutbarkeit auf die Erwerbsorientierung Arbeitsloser und prekär Beschäftigter“. In ihm geht es um Folgendes:
„Im Projekt wird die Transformation subjektiver Erwerbsorientierungen in den unteren Segmenten der Arbeitsgesellschaft im Zuge einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik untersucht. Im Mittelpunkt stehen die Wechselbeziehungen zwischen solchen Orientierungen bzw. Handlungsstrategien der betroffenen Personen und den Aktivierungsdiskursen sowie Instrumenten und Maßnahmen des Forderns und Förderns. In der ersten Projektphase liegt der Fokus auf folgenden Fragestellungen: Wie setzen sich die Adressaten einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik mit den veränderten, strengeren Anforderungen auseinander? Führt diese Auseinandersetzung zu Veränderungen von vorhandenen Erwerbsorientierungen? Warum orientieren sich bestimmte Gruppen weiter am ersten Arbeitsmarkt, während andere sich in Prekarität und Ausgrenzung einzurichten beginnen? Anders als die dezidiert effizienzorientierte Evaluationsforschung wollen wir diese Transformation aus der Perspektive der Adressaten aktivierender Arbeitspolitik rekonstruieren.“

Oft keine Unterschichtenmentalität, sondern widerstandswillig
In den Regionen Bremen, Bremerhaven (im Westen) und in Jena sowie im Saale-Orla–Kreis (im Osten) wurden bis jetzt 53 Experteninterviews mit relevanten Akteuren der arbeitsmarktpolitischen Praxis geführt und in denselben Gebieten bislang 99 Interviews mit „aktivierten“, langzeitarbeitslosen Leistungsempfängern. „In einer zweiten Projektphase ist eine Wiederholungsbefragung der Adressaten und die Ausweitung des interregionalen Vergleichs geplant. Zugleich soll das Projekt um eine internationale Vergleichsperspektive ergänzt werden.“
Der generelle Befund dieser Untersuchung lautet: Für das „Bild einer kulturell relativ homogenen, aufstiegsunwilligen Unterschicht“ und die „Diagnose einer kulturell verfestigten Unterschichtenmentalität“ gibt es keine empirischen Anhaltspunkte (Dörre 2008, S. 11). „In deutlichem Kontrast, ja häufig in krassem Widerspruch zur generalisierenden Passivitätsvermutungen, sind die von uns befragten Arbeitslosen und prekär Beschäftigten durchaus aktiv. In ihrer großen Mehrzahl streben sie unabhängig von strengen Zumutbarkeitsregeln nach einer regulären, Existenz sichernden und sozial anerkannten Erwerbsarbeit.“ (Ebd., S. 19) M. a. W.: Der erstaunliche Befund der Untersuchung besteht darin, dass Menschen, die aus der „Zone der Integration“ auf unabsehbare Weise ausgeschlossen sind und in die „Zone der Prekarität“ bzw. in die „Zone der dauerhaften Entkopplung“ abgerutscht sind, dennoch an den ideologischen Werten einer sozialstaatlich eingehegten Lohnarbeit festhalten, und zwar relativ unbeeindruckt von der lebenspraktisch strukturierenden Wirkung der Langzeitarbeitslosigkeit, also relativ unabhängig davon, ob und wann sie diese Erwerbsorientierung in eine praktische Lebensführung umsetzen können (ebd. S. 31). [8]
Allerdings bleibt die Erwerbsorientierung von der objektiven Lebenslage nicht unbeeinflusst, sondern erfährt, abhängig von den jeweiligen Chancen am Arbeitsmarkt, von Lebensalter und von biographischen Erfahrungen und akuter Lebenssituation usw., Ausprägungen und Modifizierungen, die die Jenaer Untersuchung zu drei Gruppen gebündelt hat:
.jpg)
„Arbeit, Arbeit über Alles" – gilt offenbar nicht für jeden
Fotos: arbeiterfotografie.com
Die „Um-Jeden-Preis-Arbeiter“ (S. 20 ff.): Zu ihnen zählen neben vielen Aufstockern und Selbstständigen auch junge, relativ gut ausgebildete Arbeitslose. Aus dem Interviewmaterial wird u.a. eine junge Frau zitiert, die zwischen ihrem ersten und zweiten Kind den Schulabschluss in der Abendschule nachgeholt und dann eine Ausbildung im zahntechnischen Bereich absolviert hat (S. 22). Die Autoren sehen in ihr ein Beispiel dafür, „dass der Aktivierungsimpuls nicht von strengen Zumutbarkeitsregeln ausging, sondern in einer normativen Grundorientierung tief verankert ist“ (S. 23).
Die „Als-ob-Arbeitenden“ (S. 23 ff.): Sie halten an der Erwerbsorientierung fest, suchen aber aufgrund anhaltender Erwerbslosigkeit und nach vielfältigen Enttäuschungserfahrungen nach Alternativen und Kompensationen. Es öffnet sich eine wachsende Kluft zwischen normativer Orientierung und gelebten Handlungsstrategien mit dem Zwang zur Aufrechterhaltung von Normalitätsfassaden (So tun, als gehe man zur Arbeit; der Ein-Euro-Job wird gegenüber Nachbarn und Freunden als Normalarbeitsverhältnis ausgegeben, ehrenamtliche Arbeit als Ersatz für Erwerbsarbeit). Die Tragfähigkeit solcher Überbrückungsversuche hängt entscheidend ab von der Wertschätzung, die die Betroffenen in ihrer ‚Ersatztätigkeit’ erfahren, und von dem Prestige, das sie ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich zumessen bzw. das diesem Bereich gesellschaftlich zugemessen wird.
Die Gruppe der bewussten „Nicht-Arbeiter“ (S. 25 ff.): Die Autoren subsumieren hierunter Formen des (temporären oder andauernden) (Selbst-) Ausschlusses und der Einkapselung aufgrund der Antizipation tatsächlicher oder vermeintlicher Chancenlosigkeit im Blick auf eine gesellschaftliche Integration durch Erwerbsarbeit. Formen dieses (Selbst-) Ausschlusses und der Einkapselung, also der individuellen Reproduktion von „Exklusion“ wären die „Flucht“ in die Mutterrolle oder alle Versuche, Anerkennung in der Familie oder in einer „Szene“ zu finden. Selbst wenn in diesen Formen „Anerkennung“ gefunden wird, ist den Betroffenen bewusst, dass es sich um eine „Privatisierung der Herstellung von Anerkennung“ handelt (vgl. Marquardsen 2008, S. 53), also nur um ein Surrogat der gesuchten und gewünschten öffentlichen Anerkennung durch Integration in die Arbeitsgesellschaft. Das macht diese Ersatzformen von Anerkennung in sich brüchig (s.u.). Zu den Formen der (Selbst-) Reproduktion von „Exklusion“ gehört aber auch das, was auf den ersten Blick als Arbeitsverweigerung erscheint. Die Verfasser zeigen die Ambivalenz dieses Verhaltens eindrucksvoll am Fall von „Herrn Müller“:
„Herr Müller ist 19 Jahre alt und lebt bei seiner Mutter. Sie war schon häufiger arbeitslos und erhält zu ihrem Minijob ergänzend ALG II; eine Schwester ist Mutter und Hausfrau. Eine weitere Schwester habe es „am weitesten in der Familie gebracht“: „Ja und meine andere Schwester, die arbeitet als, keine Ahnung, jedenfalls was Besseres … Bin ich auch stolz. Die ist sehr gut … Die hat immer gelernt und alles.“ Herr Müller absolviert zum Interviewzeitpunkt eine Maßnahme, die den Hauptschulabschluss zum Ziel hat. Aus der Sicht der ARGE gehört er zu denen, die kaum Eigeninitiative zeigen und aufgrund ihres Alters sowie der Vermittlungsdefizite gefordert und gefördert werden müssen. Da Herr Müller schon mehrere Maßnahmen abgebrochen hat, gilt er als unwillig und unfähig. Der Maßnahmeträger prognostiziert, dass er den Hauptschulabschluss wiederum nicht erreichen wird, u.a. weil er häufig unentschuldigt fehlt. Das Verhältnis zu den Mitarbeitern der ARGE beschreibt Herr Müller als widersprüchlich – einerseits als Autonomieverlust, andererseits aber auch als Unterstützung: „Da sind schon ein paar, die eigentlich ganz nett sind, aber das ist halt das, was ich schon sagte, dass die von oben herab, das ist das, was nervt. Die reden halt mit Dir, als ob Du Scheiße wärst …“ (S. 26)
Bei näherer Betrachtung zeige Herr Müllers „Arbeitsverweigerung“, dass er eigentlich „richtig“ arbeiten will, anstatt in Ersatzmaßnahmen gesteckt zu werden. In seinem Verhalten diffundieren Wahrnehmungen von Chancen und von Chancenlosigkeit. Dass die Ersatzmaßnahmen, in die er gesteckt wird, Verwahrungen sind, hat er mehrmals erfahren. Er hält die ihm aufgezeigten Wege für „wenig realistisch“. Gleichzeitig aber weiß er, dass der Abbruch der Maßnahme zur Erlangung des Hauptschulabschlusses auch keine Lösung seiner Probleme ist. Damit befindet sich „Herr Müller“ eher noch an der Schwelle zu einer bewussten Orientierung auf Nichtarbeit.
Wichtig ist noch die Beobachtung, dass, sollte „Herr Müller“ aus der Maßnahme aussteigen, die dann zu erwartenden Sanktionen der Leistungskürzung nicht greifen, weil sie durch Überlebenstechniken der informellen Arbeit, durch die Familie und andere sozialen Kontakte zumindest teilweise kompensiert werden können.
Konsequenzen für den Unterricht
Wenn man der Meinung ist: so geht es nicht, man kann unseren Studierenden in der Hauptschule nicht dauernd diese Zerrspiegel des bürgerlichen Vorurteils über die Unterschichten vorhalten, ergeben sich für Prüfung und Unterricht folgende Optionen:
Man lässt die Finger von Problemthemen. Man reagiert auf zweifellos vorhandene und problematische Tendenzen der Kultur von Unterschichten-Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Ignorieren. Das ließe sich so nur rechtfertigen, wenn in einer Lerngruppe solche aus der Sicht der Mittelschichten anrüchigen Verhaltensweisen nicht vertreten wären. Das dürfte eher ausnahmsweise der Fall sein.
Man setzt auf einen Perspektivenmix: Es gibt auch Erfahrungen der Erfolgs: Bewährungen in der Schule, neue Jobs, Entdeckung neuer Möglichkeiten und Entwicklung neuer Fähigkeiten. Das wäre realistischer im Blick auf die Zusammensetzung unserer Hauptschulklasse und käme dem pädagogischen Optimismus entgegen. Die stabileren unter den Studierenden mit einem konkreten und beharrlich verfolgten Ziel setzten die Themen, bestimmen das Unterrichtsklima und reißen die skeptischen und schwankenden, deren Unterrichtsbeteiligung eher diskontinuierlich ist, mit. Das wäre schön, das kann sogar mal funktionieren, aber nicht immer.
Aber auch in diesem nicht sehr wahrscheinlichen Fall stellt sich die Frage, wie mit den weniger schönen und braven Verhaltensweisen im Unterricht umgegangen werden kann. Diese Frage wird unabweisbar dann, wenn es sich um Studierende handelt, die nicht freiwillig gekommen sind, um ein selbstgesetztes Bildungsziel zu erreichen, sondern die von der Arbeitsagentur die Auflage bekommen haben, unser Bildungsangebot wahrzunehmen. Und wenn die Klasse, wie dies an einigen Schulen bereits der Fall war, ein Kooperationsprojekt ist, kann es sein, dass nur solche Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen ihr angehören.
In einem solchen Fall ist es vorgekommen, dass der Kooperationspartner von unseren Kolleginnen und Kollegen verlangte, dass man auf keinen Fall über die geringen Chancen eines Hauptschulabschlusses im Unterricht reden dürfe, denn das würde die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Maßnahme nur demotivieren. Dumm war nur, dass eben diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bald befürchteten, dass ihre Hoffnungen in die Maßnahme sich nicht erfüllten, und damit ihre zunehmenden Fehlzeiten begründeten. Auch die, die freiwillig in unsere Hauptschulklassen kommen, können die Frage nach der Perspektive über den Hauptschulabschluss hinaus nicht verdrängen und nicht immer gelingt es ihnen, angesichts möglicher nicht sehr rosiger Aussichten rational mit der Institution Schule umzugehen. Dies gelingt am ehesten denen, die schon eine klare Perspektive über den Hauptschulabschluss hinaus haben. [9]
Man kann also gar nicht die Frage umgehen, ob es eine Alternative zum Beaufsichtigungsdiskurs, der die Abschlussprüfungen Deutsch beherrscht, und zur Problemtabuisierung gibt.
Man könnte den Beaufsichtigungsdiskurs natürlich einfach umwerten und dem konservativen Blick auf die Unteren als Barbaren das romantische Bild vom mehr oder weniger edlen Wilden entgegensetzen. Die symbolischen Praktiken und Gewaltrituale sind allerdings roh und brutal und wenig edel. Man kann sogar feststellen: sie haben „eine reproduktive Funktion hinsichtlich der konservativen Ideologie“ (und der bestehenden Verhältnisse) (Willis 1982, S. 271). Kochs Wahlkampf in Hessen 2007/08 ist nicht an der Zurückweisung dieser Ideologie gescheitert, sondern daran, dass ihm nachgewiesen wurde, dass seine Sparpolitik nicht nur Sozialstaatsfunktionen, sondern auch die des Sicherheitsstaates so untergraben hat, dass die von ihm eingeforderten Maßnahmen des Überwachens und Strafens unzulänglicher umgesetzt werden als in anderen Bundesländern. Kann es daher etwas anderes geben, als die Praktiken der Körperinszenierung und des Rauschs, des Eskapismus und der Störungen, des Machismo, der Schlägereien und der Einschüchterung als „unvernünftig“ und „barbarisch“ zu verdammen und den Beck zu machen: „Wascht euch, rasiert euch, kämmt euch und hört auf, (uns) zu stinken!“?
Für den Unterricht in der (Abend-) Hauptschule ist es von entscheidender Bedeutung, über diese Alternativen der Beaufsichtigung und Ermahnung, der Umwertung und Romantisierung oder des Ignorierens und Laufenlassens hinauszukommen. Die vielen gut gemeinten Fortbildungen und pädagogischen Tage zum Aufmerksamkeitsmanagement oder zur Methodenvielfalt kann man sich schenken, wenn man sich um diese Problematik drückt bzw. sie gar nicht erst wahrnimmt.
Die einfachsten Konsequenzen wären:
– Mehr Texte präsentieren, in denen die Betroffenen selbst zur Sprache kommen, in denen sie mehr sind als stumme Objekte, über die gesprochen und verfügt werden muss.
– Ernstmachen mit der Einsicht, dass auch das Leben von Troublemakern nicht von morgens bis abends im Trouble-Machen besteht.
Die schwierigen Fragen betreffen die gesamte Unterrichtsorganisation: Wie reagieren wir auf Störungen? Wie gehen wir vor, ohne zu ignorieren und zu beleidigen, und vermeiden dabei „jede simplistische Sympathiebekundung“ (Willis 1982, S. 272)? Wie stärken wir Einsicht und Illusionslosigkeit, ohne zu demotivieren und zu entmutigen? Wie motivieren wir, ohne Illusionen zu schaffen? Die Logik des hier im Anschluss an die Kritik Skizzierten legt es nahe, Fertigkeiten und Disziplin über die Durchführung einer Art sozialer Selbstanalyse zu fördern, die die Verschränkung von Einsichten und Selbstausschluss deutlich macht.
Mögliche Themen, mit deren Bearbeitung man diese Selbstanalyse erreichen könnte, wären:
– Rolle von Qualifikationen und die Bedeutung von Arbeit für die Studierenden
– Ihr Verhältnis zu geistiger und manueller Arbeit
– Die Verknüpfung von Tätigkeiten mit Geschlechterimages
– Rolle von Selbstbildern bei der Bewertung von Tätigkeiten und bei der Konfrontation mit Anforderungen; ist ihre Akzeptanz oder Zurückweisung auf Rationalität oder Irrationalität gegründet?
– Was bedeuten Störungen, Schlägereien, Eskapaden und was kommt dabei zum Ausdruck?
– Was bedeuten Cliquen und Freundschaften, was sind ihre Stärken und Schwächen?
Die Bearbeitung dieser Themen würde voraussetzen, dass die Lehrerinnen und Lehrer etwas über prekäre Lebensverhältnisse und ihre kulturell-symbolische Aneignung wüssten, um etwa auffällige und für sich allein genommen strikt zu verurteilende Verhaltensweisen auf diese kulturelle Ebene in ihrer relativen Einheit hin ‚lesen’ und verstehen zu können, anstatt sich davon nur persönlich beleidigt und abgestoßen zu fühlen. (HDH)
_________________________________________________________
[1] Wie unsinnig die Bezeichnung „öffentliche Soziologie“ ist, zeigt sich schon daran, wenn man sie mit ihrem Gegenteil konfrontiert: Ist alle bisherige/andere Soziologie „privat“ oder „geheim“? Haben nicht längst vor Bude und Nolte Ansätze des Fachs existiert, die sich „der prinzipiellen Erörterung öffentlicher Fragen“ (Bude 2008, S. 7) gewidmet haben? Lebt Soziologie – bei Strafe ihres Untergangs – nicht vielmehr davon, „öffentliche Fragen“ zu behandeln, im Einzelnen und Besonderen das Allgemeine zu entdecken, begrifflich zu arbeiten, um empirische Sachverhalte zu erklären?
[2] Das Wort wurde von Harald Schmitt popularisiert. Diejenigen, die sich heute über ein vermeintliches „Unterschichtenfernsehen“ mokieren, haben in den 80 er Jahren alles getan, die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten als an Hochkultur orientiertes, elitäres „Studienratsfernsehen“ zu attackieren und delegitimieren. Gestützt auf die „Kirch-Kohl-Allianz“ wurde aber 1982 eine Medienpolitik verfolgt, die dazu geführt hat, dass die Bundesrepublik heute mit mehr als 30 Privatsendern über das europaweit umfassendste Angebot verfügt: Mängel 2008, S. 111. Diese Medien orientieren sich an „Quoten“, d.h. sie bedienen eine Bevölkerungsgruppe, die größer als die Unterschichten ist, wie immer man diese quantitativ fasst (vgl. auch Winkler 2007, S. 117 f.)
[3] Hirschman identifiziert an der reaktionären Kritik an den Fortschritten der Freiheit seit 1789 drei rhetorische Hauptstrategien: eine Sinnverkehrungsthese, eine Vergeblichkeitsthese und eine Gefährdungsthese. Orientiert an T. H. Marshalls Drei-Jahrhunderte-Schema der Menschenrechte (individuelle Freiheitsrechte im 18., staatsbürgerliche Partizipationsrechte im 19. und soziale Anspruchsrechte im 20. Jahrhundert) zeigt er, wie diesen drei Entwicklungsschüben der Menschenrechte drei reaktionäre Wellen folgen. Das von ihm berücksichtigte Material ordnet er dann unter die genannten rhetorischen Strategien. Dabei fällt ihm auf: „fast jeder Gedanke, der eine Zeitlang aus dem allgemeinen Gesichtskreis verschwunden war, wird leicht mit einer neuen Einsicht verwechselt.“ (Ebd., S. 37)
[4] Zitiert nach Bultmann 2001, S.50. Bultmann zeigt in seinem instruktiven Aufsatz, wie die neoliberal gewendeten sozialdemokratischen Parteien in den 90er Jahren alle noch vorhandenen Verknüpfungsversuche zwischen Chancengleichheit und gesellschaftlicher Emanzipation und Gleichheit aufgelöst haben. Mit zum Teil demselben Material, aber ohne Bezug auf Bultmann: Solga 2005, S. 48 ff. - Auch der Berliner Professor für Historische Erziehungswissenschaft Heinz-Elmar Tenorth wendet sich, ähnlich wie Bude, gegen die „Illusion“ und das „unseriöse Versprechen“, durch Bildungschancen soziale Ungleichheit beseitigen zu wollen. Deutlicher aber als Bude zeigt Tenorths Argumentation, zu welchen Konsequenzen das „aufklärte falsche Bewusstsein“ seine Anleihen bei kritischer Gesellschaftsanalyse treibt. Weil reformistische Bildungspolitik nicht erreicht, was sie erreichen zu wollen vorgibt, lässt man sie am besten gleich ganz sein. Den „Risikogruppen“ des Bildungssystems sei ohnehin nicht zu helfen, da ihnen die „Grundeinstellung“ fehle und sie stattdessen dem Fatalismus und der Gewalt anhingen. Bildung sei in diesem Milieu weder verankert noch geachtet. In dieser Situation könne man nichts anderes tun, als das bestehende Bildungssystem aufrechtzuerhalten: „Man darf kein Bildungssystem installieren, in dem man die Eltern dafür bestraft, dass sie an die Bildungskarrieren ihrer Kinder denken. Und genau das tut man, wenn man zum Beispiel das Gymnasium abschafft.“ (Tenorth 2008, S. 37)
[5] Mit „schulgescheit“ werden (nicht nur in Hessen) Menschen bezeichnet, die in der Schule sehr gut waren, aber im Leben gescheitert sind bzw. eine eher bescheidene, wenig glamouröse Berufslaufbahn eingeschlagen haben.
[6] In den letzten Jahren sind die Jungen als Problemgruppe im Kontrast zu den Mädchen als Bildungsgewinnerinnen entdeckt oder erfunden worden. Merkwürdigerweise nehmen aber diese ‚defizitären’ Jungen immer noch die höheren und besser bezahlten Berufspositionen ein als die Mädchen. Offenbar eine weitere Form des Auseinandertretens von Schulerziehung und Produktion bzw. Beruf.
[7] Es wäre interessant zu untersuchen, inwieweit das Freizeitverhalten von beschäftigten Jugendlichen eingeschränkt oder verändert wird, wenn Jugendliche keine Beschäftigung finden. Eine Folie böte Willis 1991.
[8] Zu Castel vgl. Castel 2000; eine gute Einführung nicht nur in die französische Prekarisierungsforschung und –theorie gibt Stefanie Hürtgen 2008. Hinweise im oben zitierten Forschungsbericht finden sich auf den Seiten 12-14.
[9] Hierzu ausführlicher der Infobrief der Landesfachgruppe Erwachsenenbildung der GEW Hessen Nr. 20, August 2008: Wie lange noch Abendhauptschule?
Online-Flyer Nr. 172 vom 12.11.2008
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE