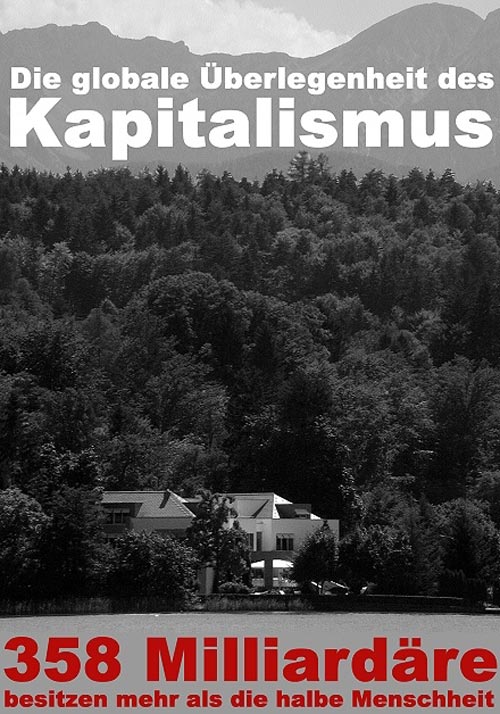Einflussreiche Bürger wollen die soziale Spaltung der Stadt Köln verhindern
Sturm gegen das Jüdische Museum
Von Werner Rügemer
„Es brodelt in der Bürgerschaft“ – so titelte der Kölner Stadt-Anzeiger am 4. Januar 2013 auf der ersten Seite des Lokalteils. Ein Foto zeigt Werner Peters in seinem Arbeitszimmer vor einem wandgroßen Gemälde des Malers Andreas Schulze. Der Eigentümer eines kleinen Hotels und Kunstfreund hat eine Internet-Kampagne gegen den 52 Millionen Euro teuren Bau des Jüdischen Museum gestartet. Weil es in der Bürgerschaft „brodelt“, brauche es, so Peters/Kölner Stadt-Anzeiger, „nur noch eine Initialzündung, um den Protest ingang zu setzen“. In der schweren Finanzkrise dürfe sich die Stadt solche Prestigeprojekte nicht leisten.

Bauplanung Archäologische Zone Jüdisches Museum
Quelle: wikipedia Archäologische Zone Köln
Zur brodelnden Bürgerschaft holte der Stadt-Anzeiger auch Karl-Heinz Pütz hinzu, den Organisator des „Arsch-huh Zäng usseinander“-Konzerts (zu deutsch: Hintern hoch Zähne auseinander, kölsche Initiative gegen Rassismus). „Wir haben in Köln eine Generation junger Menschen im Alter von 16 bis 20 Jahren, die drohen uns aus der Stadtgesellschaft wegzukippen“, wird er zitiert. Deshalb dürfe das Jüdische Museum nicht gebaut werden, sonst müsse im Sozialetat gekürzt werden. Auch Frank Deja von der Initiative „Köln kann auch anders“ macht mit. (1) Inzwischen unterstützt die Kölner CDU mit Rechtsaußen Winrich Granitzka die Initiative.
Am Kölner Jugend- und Sozialetat wird seit mindestens zwei Jahrzehnten gekürzt, jedes Jahr, und seitdem protestieren Initiativen und Betroffene dagegen, machen Alternativvorschläge. Warum „brodelt“ es aber gerade jetzt erst in der Kölner „Bürgerschaft“? Und warum gerade der Stadt-Anzeiger, der sich in seiner penetranten FDP-Ausrichtung bisher um den weniger privilegierten und „kulturfernen“ Teil der Bevölkerung nicht sorgte? Und warum steht das Jüdische Museum im Visier und andere Großprojekte nicht?
Die archäologischen Grabungen
Seit 2007 graben drei Dutzend Archäologen auf beziehungsweise unter dem geräumigen Rathausvorplatz. Hier liegt der Ursprung der Stadt Köln. Hier bauten die Römer einige Jahre nach Christi Geburt den prächtigen Palast ihres Statthalters (Prätorium). Hier residierten dann die fränkischen Könige. In Köln ist für 321 nach Christus die erste jüdische Gemeinde nördlich der Alpen nachgewiesen. Schon seit Ende des ersten Jahrhunderts, nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, waren Juden dauerhaft in Köln ansässig und gehörten zur multinationalen Stadtbevölkerung, wie man heute sagen würde.
Während der Kreuzzüge im elften Jahrhundert und während der Pest 1348 wurden Juden ermordet und vertrieben. Wieder siedelten sich Juden an, wurden wieder vertrieben, kamen wieder. Unter Napoleon erhielten sie Bürger- und Stadtrechte, was aber nicht allen christlichen Bürgern gefiel und schließlich im faschistischen Massenmord ein vorläufiges Ende fand.
Von alldem stießen die Archäologen auf eine überraschende Zahl archäologischer Funde. Sie datieren vom ersten nachchristlichen bis zum 20. Jahrhundert: Neben den teilweise schon früher ausgegrabenen Teilen, insbesondere des Prätoriums, sind das eine weitgehend erhaltene Mikwe (jüdisches Bad), Reste der Synagoge – darunter die Lesekanzel, Abfälle der koscheren Küche, Tierknochen, Keramik, Siegel, Lampen, Tierköpfe, Verzierungen, Zeichnungen, Kritzeleien auf Stein, die Einnahmeliste einer jüdischen Bäckerei. In einer Kloake fanden sich Kinderspielzeug, Medizinfläschchen, Buchbeschläge und Mobiliar einer Rabbinerfamilie.
Es fanden sich Belege – für manche Kölner erstaunlich – für die Zusammenarbeit der jüdischen Gemeinde mit dem Erzbistum: So halfen Handwerker der Dombauhütte beim Bau der Vorlesekanzel in der Synagoge. Die Juden sprachen, wie sich auf mehreren Dutzend Schiefertafeln zeigt, das kölsche Platt und verfassten deutschsprachige Texte mit hebräischen Buchstaben. So sind etwa Teile eines Ritterepos erhalten, in dem der Ritter bei seiner Dame auf mittelhochdeutsch und in hebräischen Lettern anfragt „Wölt ir mich bi uch slafe lan.“ Ist doch hübsch, nicht wahr?
Ein ganzes Stadtviertel mit Gassen und Mauerresten wurde sichtbar, in dem christliche und jüdische Häuser eng nebeneinander lagen und das jüdische Leben über Jahrhunderte in das der Stadtgesellschaft „integriert“ war. Köln war im 12. und 13. Jahrhundert die größte Stadt Europas, ebenso bedeutsam war die Kölner jüdische Gemeinde. Jüdische Kaufleute mit ihren internationalen Verbindungen gehörten zu den Kreditgebern der Stadt, des Erzbistums und von Klöstern. Hochstehende Juden beschäftigten christliches Dienstpersonal.
Die Ausgrabungen werden von Historikern, Archäologen und Museumsleuten weltweit begleitet. 2007 wurde ein wissenschaftlicher Beirat berufen. 2011 wurden die Ergebnisse in einem internationalen Kolloquium im Kölner Rathaus vorgestellt. Inzwischen hat die Stadt dazu eine Dokumentation mit 400 Abbildungen veröffentlicht. Darin werden die wichtigsten Funde beschrieben. Aber auch die Stadtgeschichte, Ratsbeschlüsse, öffentliche Auseinandersetzungen und die Konzeption von Archäologischer Zone und Museum sind enthalten. Prof. Samuel Gruber, Direktor des Jewish Heritage Council of World Monuments von der Syracuse University (New York) urteilte, es handle sich um „die wichtigste und größte Ausgrabung in Europa für jüdische Geschichte“.
Rathausvorplatz

Modell des jüdischen Museums (3) zwischen dem Rathaus (1), dem Spanischen Bau (2) und dem Wallraf-Richartz-Museum (4)
NRhZ-Archiv
Die Ausgrabungen der Archäologischen Zone liegen auf dem Rathausvorplatz zum Teil offen, zum Teil sind sie durch ein Zelt provisorisch überdeckt. Die Zone soll, so die Planung, organisch mit einem darüber zu errichtenden Jüdischen Museum verbunden werden. Das Interesse in Bevölkerung und von außerhalb ist schon bisher groß, bis Mai 2012 haben 560.000 registrierte Besucher an den unterirdischen Führungen in der noch etwas unbequem begehbaren Zone teilgenommen, über 700.000 haben an Führungen außen am Zaun teilgenommen. Doch die Umsetzung des Gesamtprojekts stagniert, mit dem Bau des Museums wurde noch gar nicht begonnen. Warum? Und warum jetzt der Protest der Brodel-Bürger?
Jüdisches Museum – zwei unterschiedliche Konzepte
Die Ausgrabungen – 1953 begonnen und immer wieder unterbrochen - werden seit Beginn 2007 endlich systematisch vorgenommen. Grabungsleiter Sven Schütte ist Beamter der Stadt Köln. Der Archäologe hat als Leiter des Amtes für Bodendenkmalspflege seit den 90er Jahren am Konzept der Ausgrabungen und des Museums gearbeitet. Es ist sozialhistorisch ausgerichtet und betont das wie auch immer geartete, friedliche wie feindliche Zusammen und Gegeneinander von Juden und Einheimischen. Schüttes Team entwickelte das integrative Konzept als „historische Visitenkarte der Stadt Köln“.
Hansgerd Hellenkemper, Byzantinist, Vorsitzender der Archäologischen Gesellschaft Köln, bis 2010 Direktor des Römisch-Germanischen Museums, hatte in einer Projektskizze ein anderes Konzept entwickelt. Er meint, die römische Geschichte sei der Ursprung und das Wesen Kölns, später habe es archäologisch nicht mehr viel Wichtiges gegeben. Diese vorgestrige Auffassung prägt heute immer noch in einflussreichen Kreisen das Selbstbild der Stadt. Mit der Beauftragung Schüttes als Grabungsleiter verbot Hellenkemper der Stadt, seine Projektskizze zu verwenden.
Schütte stellte sich mit seinem Konzept gegen den vorherrschenden Archäologen-Clan in Köln und Nordrhein-Westfalen. Der Clan wird bis heute angeführt von Heinz Günter Horn, ehemals in der Landesregierung zuständig für die Bodendenkmalpflege, seinem Nachfolger Thomas Otten und von Hansgerd Hellenkemper. Schon bei den Großprojekten der 80er und 90er Jahre (U-Bahn-Bau, Neugestaltung des Alter Markt) drängte Schütte darauf, die Gelegenheit für ausgiebige Grabungen zu nutzen, Hellenkemper als Vorgesetzter Schüttes war dagegen. Die Stadtoberen versetzten deshalb Schütte zur Strafe für mehrere Jahre ans Stadtmuseum.
Auch vor Beginn der geplanten Ausgrabungen auf dem Rathausvorplatz warnte Hellenkemper 2006, man solle nicht so viel Aufwand treiben, es seien keine neuen und sensationellen Funde zu erwarten, die Ausgrabungen könnten in einem Jahr erledigt werden. Schütte gewann mehrere Prozesse gegen die Stadt und musste wieder angemessen beschäftigt werden. Der neue Kulturdezernent Prof. Georg Quander erkannte die historische und internationale Bedeutung des Projekts und berief Schütte zum Grabungsleiter.
Die vielen und einzigartigen Grabungsfunde stützen auch Schüttes Konzept für das Jüdische Museum. Es soll über „bloße Ruinenromantik hinausgehen“. Es soll nicht, wie es in bisherigen jüdischen Museen üblich ist, vollgestopft sein mit jüdischen Ritualgegenständen. Es soll nicht ein abgetrenntes, ausschließlich religiös bestimmtes Judentum darstellen. Vielmehr wird die jüdische Geschichte vernetzt und eingebettet in die Stadtgeschichte Kölns.
Je deutlicher wurde, was in den fünf Jahren bei den Ausgrabungen herauskam, desto stärker wuchs die Kritik an Schüttes Konzept, weit über die Archäologen-Szene hinaus.
Wie das sozialhistorische Konzept ausgehebelt wurde
Zunächst wollte die „Gesellschaft zur Förderung eines Hauses und Museums der jüdischen Kultur“ das Museum finanzieren. Diese private Gesellschaft, eigens für das Kölner Jüdische Museum gegründet, schmückt sich in ihren Gremien mit Unternehmern, Honoratioren, dem Zentralrat der Juden und jüdischen Gemeinden und einem Adenauer-Enkel. Mit dabei ist Ilan Simon, Vorsitzender des Keren Hayesod Köln, einer Filiale der in Jerusalem residierenden Lobby, die weltweit Spenden für Israel sammelt. Zu den Sponsoren auch der Kölner Versammlungen von Keren Hayesod gehören die israelischen Banken Hapoalim, Leumi und Mizrahi und Israel Bonds.

Altbundespräsident Walter Scheel bekommt vom Vorsitzenden der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), Dr. Jürgen Wilhelm, den Ehrenring verliehen
Foto: LVR / Ludger Ströter
Die entscheidende Rolle spielt allerdings Dr. Jürgen Wilhelm. Er ist Vorsitzender des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) sowie der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und SPD-Kreisvorsitzender im Rheinisch-Bergischen Kreis. Ein Jahrzehnt lang war er Präsident der Freunde des Wingate-Instituts in Netanya/Israel, das sich der Förderung des „neuen jüdischen Menschen“ auf dem Gebiet des Sports widmet („Muscular Judaism“). Als Rechtsanwalt vertritt er den israelischen Immobilien-Investor Erez Adani.
Die Gesellschaft zur Förderung eines Hauses und Museums der jüdischen Kultur wollte die in Köln schon vorhandene Judaica-Sammlung ausstellen, ebenso Literatur von Juden und zum Judentum, Gebetbücher und religiöse Texte, ebenso persönliche Ritualgegenstände wie Teffillin und Gebetsschal – also all das, was in anderen jüdischen Museen auch schon ausgestellt wird und mit den Kölner archäologischen Funden nichts zu tun hat. Es war deshalb nicht verwunderlich, dass die Gesellschaft 2009 aus der Finanzierung ausstieg. Sie gab als Begründung an, dass die angekündigten Spenden zurückgezogen worden seien, die „weltweite Wirtschafts- und Finanzmarktkrise“ habe die Pläne zunichte gemacht - das scheint nicht sehr glaubwürdig.
Angesichts der fortgeschrittenen und international beachteten Ausgrabungen beschloss die Mehrheit im Kölner Stadtrat – SPD, Grüne, Linke, FDP – am 14. Juli 2011, die wesentliche Finanzierung des Museums zu übernehmen. Das sind 37 Millionen Euro. Vom Land NRW kommen 14,3 Millionen hinzu.
Auch die anderen Gegner des sozialhistorischen Konzepts blieben nicht untätig. Von Anfang an hat der Stadt-Anzeiger die Berufung Schüttes als Grabungsleiter wiederholt kritisiert. Der SPD-Oberbürgermeister Jürgen Roters schloss sich nach der Entscheidung für die öffentliche Finanzierung der Kritik zumindest zeitweise an und ging damit gegen den Kulturdezernenten Quander auf Distanz. Auch Jürgen Wilhelm und Archäologen des LVR stellten „Schüttes Methoden und Schlussfolgerungen dezidiert in Frage“.
Die Ratsmehrheit bekräftigte zwar im Dezember 2012 die öffentliche Finanzierung, beschloss aber, den Betrieb dem Landschaftsverband Rheinland zu übertragen. Damit wird das Projekt für die Bürger zwar nicht billiger, denn auch die Stadt Köln finanziert den Landschaftsverband als Mitglied mit. Viele Ratsmitglieder haben bei dieser nur finanziell begründeten Entscheidung vermutlich gar nicht gemerkt, um was es eigentlich ging. Denn des Pudels Kern liegt darin: Man hat den städtischen Beamten Schütte auf mehr oder weniger elegante Weise aus dem Projekt entfernt. Die Stadt hat so keine Entscheidung mehr über das inhaltliche Museumskonzept. Sie zahlt – Wilhelm und LVR entscheiden. Diese haben namens einer unheilvollen Allianz und mit Zustimmung einer konfliktscheuen Ratsmehrheit das Museum für ihre Vorstellungen okkupiert.
Wer hat Angst vor dem Jüdischen Museum?
Die Brodel-Bürger wollen die soziale Spaltung der Stadt abwenden und deshalb das Jüdische Museum verhindern. Pütz meint: Die Stadt habe mit Dom, romanischen Kirchen, dem Römisch-Germanischen Museum, den mittelalterlichen Mauerresten und den bisherigen Museen kulturell sowieso schon genug zu bieten. Der kölsche Volkstümler hat es sich im Klischee der römisch-katholischen Stadt gemütlich eingerichtet. Die Archäologische Zone könne erst mal zugeschüttet werden, meint er, sie könne noch 15 Jahre warten, das habe sie schon 2000 Jahre getan.
Soviel zynische Naivität bei dieser Gutmenschenheit! Denn wer jetzt das Jüdische Museum erst mal oder für 15 Jahre auf Eis legt, der unterstützt damit die herrschende, ausweglose „Spar“politik. Die würde dann so weitergehen wie bisher, und in 15 Jahren gäbe es nach dieser Logik noch weniger Geld als heute für das Museum. Und noch weniger Geld, um die soziale Spaltung zu verhindern. Übrigens würde das „Zuschütten“ der Archäologischen Zone einen zweitstelligen Millionenbetrag erfordern.
In der Brodel-Bürgerschaft gibt es einige, die nicht so naiv sind, dafür aber einflussreicher. Sie brauchen sich nicht zu outen, sie lassen andere vor. Sie haben harte Gründe, um die genaue öffentliche Präsentation jüdischer Geschichte zu fürchten. Und was mit dem Museum beginnt, könnte zudem auf die Gegenwart überspringen. Wehret den Anfängen!
Die Gesellschaft zur Förderung eines Hauses und Museums der jüdischen Kultur wurde schon genannt. Diese Gesellschaft will auch die kölnische Judenheit als mehr oder weniger geschlossene, religiös geprägte Welt darstellen. Da waren die Kölner Juden früher schon weiter: Sie gaben dem Erzbistum Kredite, um den Dombau beginnen zu können, und später war es die Bankiersfamilie derer von Oppenheim, die im 19. Jahrhundert als Hauptsponsor (neben dem preußischen Königshaus) die Vollendung der Domtürme ermöglichte!
Zu den angstvollen Gegnern sind neben den bisher Genannten vor allem der Medienpatriarch Alfred Neven Dumont und sein Clan zu zählen. Der Verleger des Kölner Stadt-Anzeigers und Chef des immerhin viertgrößten Medienimperiums der Republik wurde vor einigen Jahren in seiner israelfreundlichen Selbstherrlichkeit gestört. Der Kölner Journalist Ingo Niebel deckte auf, dass Vater Kurt Neven während der NS-Herrschaft fünf kostbare innerstädtische Grundstücke jüdischer Unternehmer in Köln aufgekauft hatte. Darauf hatte er die Verlagsgebäude für seine im NS aufblühenden Zeitungen erweitert – beispielsweise hatte seine Kölnische Zeitung während des 2. Weltkriegs ein lukratives Dauer-Massenabo für die deutsche Wehrmacht in den besetzten Staaten.
Als der Journalist Albrecht Kieser damals schrieb, der Stadt-Anzeiger sei deshalb Arisierungsprofiteur, erwirkte Alfred Neven Dumont eine einstweilige Verfügung: Sein Vater sei kein solcher Profiteur, denn er habe für die Grundstücke den „marktüblichen Preis“ bezahlt. Daran hält der Verleger bis heute fest, gestützt vom Kölner Landgericht, vom Bundesgerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht. Der Rechtsstreit hängt beim Europäischen Gerichtshof.
Als 1983 bekannt wurde, dass in der Lindenthaler Villa des Kölner Bankiers Kurt Freiherr von Schröder Anfang Januar 1933 die Kanzlerschaft Hitlers eingefädelt worden war, schlug u.a. die damalige Stadtkonservatorin Hiltrud Kier vor, in der Villa ein Dokumentationszentrum einzurichten. Der Stadt-Anzeiger war das öffentliche Sprachrohr der Gegner dieses Projekts. Zu dem Kreis derer, die da aus dem Nebel des organisierten Vergessens hätten auftauchen können, gehören in Köln so manche weitere Bankiers und Unternehmer und hochrangige Mittäter und ihre Nachfolger.
Fragen an die Brodel-Bürger
Es ist natürlich nicht zu leugnen, dass die Stadt Köln wie die meisten anderen Städte in einer „Finanzkrise“ steckt. Deshalb ist das Geld für Soziales genauso wenig vorhanden wie für das Projekt Archäologische Zone / Jüdisches Museum und für vieles andere. Insofern weisen die Brodel-Bürger auf einen wunden Punkt hin. Aber eine „Finanzkrise“ gibt es spätestens seit zwei Jahrzehnten, und seitdem werden Ausgaben gekürzt und natürlich vor allem im Sozialbereich: Die hier angeblich viel zu hohen Ausgaben stehen seitdem auch zeitgeistmäßig in der Kritik des Stadt-Anzeigers.
1994 rief der damalige sozialdemokratische Kölner Oberbürgermeister Norbert Burger zusammen mit anderen Oberbürgermeistern den „Aufstand der Städte“ aus: Gegen die sinkenden Mittelzuweisungen des Bundes und die damit auferlegten sozialen Kürzungen. Aus diesem Protest wurde natürlich nichts, weil schon damals die braven bzw. demagogischen Protestierer nicht wagten, Alternativen zu nennen, nämlich neue staatliche Einnahmen. So halten es auch der heutige Nachfolger Burgers, Genosse Jürgen Roters, und die Spar-Fetischisten der Stadtrats-Mehrheit.
Die Brodel-Bürger müssen sich bei ihrer vordergründigen Kritik an Groß- und Prestigeprojekten fragen lassen: Warum gerät bei den seit mindestens einem Jahrzehnt durchexerzierten Sparmaßnahmen im Bereich Soziales, Kultur und Infrastruktur erst und gerade jetzt das Jüdische Museum ins Visier? Warum nicht zum Beispiel das Prestigeprojekt Rheinboulevard am Deutzer Ufer, der ab Mai 2013 gebaut werden und immerhin 23 Millionen kosten soll? Wobei schon allen Beteiligten klar ist, dass er noch teurer wird und die Erhaltung zudem auf Jahrzehnte hinaus jährlich mindestens eine Million Euro kosten wird? Oder warum zum Beispiel nicht die in kurzer Zeit auf 36 Millionen angeschwollene Sanierung des Nobelrestaurants „Flora"? Das sind zudem Projekte, die erst geplant sind und noch gestoppt werden könnten. Übrigens: Das Jüdische Museum würde genauso viel kosten wie eine einzige neue U-Bahn-Haltestelle, nämlich die am Breslauer Platz!
Und warum sollen die für die Stadt so überteuerten Mieten für das Technische Rathaus Deutz und das Bezirksrathaus Nippes mit dem endgültig diskreditierten Investor Esch-Oppenheim nicht neu verhandelt werden? Warum werden seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs 2009 in Sachen neue Messehallen zweistellige Millionenbeträge verschleudert, wegen der Rücksicht auf die abgehalfterten Investoren à la Schickedanz, Familien Esch und Oppenheim und Herrn Middelhoff?
Da löst sich auch der Hinweis der Brodel-Bürger auf die sanierungsbedürftige Infrastruktur der Stadt in Nichts auf. Natürlich ist sie äußerst sanierungsbedürftig. Sie wurde jahrzehntelang kaputt„gespart“. Da hat sich was angestaut: Milliardenbedarf bei der Sanierung von maroden Schulen, Abwasserkanälen, Straßen und Brücken! Tausende Kitaplätze, Jugend- und Bürgerzentren und für die Wohnungskosten für die Arbeitslosengeld II-Bezieher und Wohngeldempfänger! Und für einen ordentlichen Köln-Pass, nachdem er jahrelang weiter herunter„gespart“ wurde! Und für die heruntergesparte Migranten- und Senioren-Beratung! Um nur eine Auswahl zu nennen. Und all das soll durch das Kürzen von 39 Millionen städtischer Mittel für das jüdische Museum plötzlich finanziert werden können?
Bei diesem vordergründigen Ausspielen „Museum gegen Soziales“ geraten die Proportionen aus dem Blick. Warum „brodelt“ es gegen das Jüdische Museum gerade jetzt, ohne dass die soziale Spaltung durch den Nichtbau verhindert würde? Diese diffuse Brodelei ist ein Anzeichen dafür, dass hier nicht der Verstand regiert, sondern etwas anderes.
Alternativen
Der Stadt-Anzeiger öffnet seine Spalten traditionell solchen Bürgerinitiativen nicht, die unabhängig sind. Alternativen, die Auswege aus der längst gescheiterten „Spar“politik weisen, werden ebenso routiniert wie gnadenlos verdrängt. So erwähnt der Stadt-Anzeiger in seinem Bürger-Brodel-Artikel zum Beispiel nicht die zum Thema gehörige Initiative des DGB Köln-Bonn-Leverkusen „Vermögenssteuer einfordern“: Ein Antrag an die Stadträte, der von Bürgern online unterstützt werden kann – während der Stadt-Anzeiger laufend Reklame für die Brodel-Bürger-Initiative macht. In Städten wie München, Göttingen, Duisburg, Leipzig, Flensburg und Ingolstadt haben die Stadträte mehrheitlich, auf Anstoß etwa der attac-Initiative „Umfairteilen-Reichtum besteuern“, beschlossen: Die Oberbürgermeister sollen sich gegenüber ihren Landesregierungen und der Bundesregierung für die Besteuerung des Reichtums einsetzen!
Das scheint des Pudels bzw. des Brodel-Protests Kern zu sein: Keine Belastung derer, die das Geld haben. Phantasie- und mutlos die Stadt weiter kaputtsparen. Die soziale Spaltung weiterlaufen lassen, begleitet von populistischen Gegen-Beschwörungen. Keine Alternativen zulassen. Brav den Stadt-Anzeiger lesen. Auch rückblickend die Integration der Juden aus der Stadtgeschichte verdrängen - und sich verbissen in historischer Selbsterblindung einigeln. (PK)
(1) Siehe NRhZ 388 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=18640
Online-Flyer Nr. 389 vom 16.01.2013