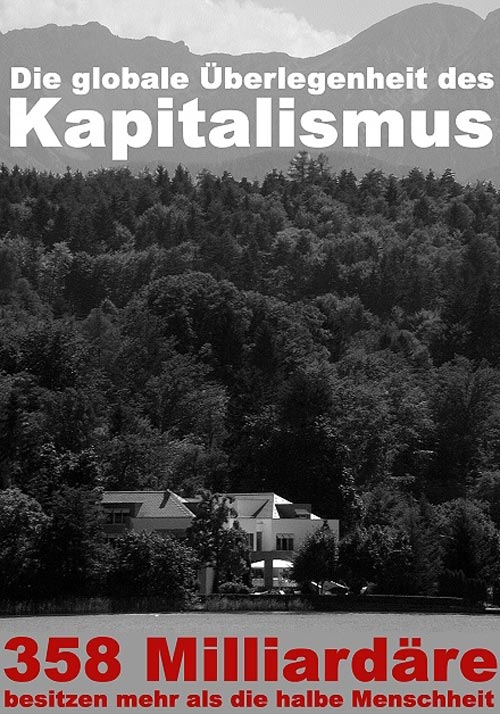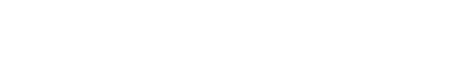SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Kultur und Wissen
Im Theater im Tunnel geht „Die Brücke“ in die dritte Spielzeit
Das Wunder von Remagen
Von Norman Liebold

Ruine der Ludendorffbrücke auf der Remagener Rheinseite mit den Flaggen von Deutschland und den USA | Foto: Norman Liebold
Walter Ullrich, Intendant der Landesbühne Rheinland-Pfalz, verarbeitete die Geschehnisse um die Eroberung der Brücke zu einem Theaterstück, das sich auf den Roman „Die Brücke von Remagen“ von Rolf Palm stützt, aber auch das Wissen von Zeitzeugen nutzt. Die Idee war, das Stück am Originalschauplatz aufzuführen, dem Eisbahntunnel, der von der Brücke in das Gestein der Erpeler Ley führt. „Ich mache das Stück, Sie machen den Tunnel“, hatte Ullrich zu Edgar Neustein gesagt, der daraufhin im November 2005 den Verein „ad Erpelle“ gründete.
Mit der Summe von 32.000 Euro und unzähligen Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit wurde das klamme Loch in das „Theater im Tunnel“ verwandelt und die Uraufführung des Stücks „Die Brücke“ bereits im Oktober 2006 möglich gemacht. Die vorsichtig angesetzten fünf Aufführungen im Jahre 2006 waren ausverkauft, 2007 waren es 20, ebenfalls bis auf den letzten Platz gefüllte Aufführungen. Am 15. August wurde das Stück für 2008 wieder aufgenommen und wird bis zum 31. August gespielt.
Im Tunnel ist es kalt – einige der Zuschauer haben sich Decken mitgebracht, die sie sich um die Schulter legen. Lockt draußen ein warmer Sommerabend in die Biergärten, sind es im Inneren des Berges gerade einmal zwölf Grad. Auch die Stimmung ist eine gänzlich andere: Der Tunnel hat etwas von einer Katakombe: Backsteingemauert hängt das Gewölbe über den Köpfen, und darüber weiß man zigtausend Tonnen Basaltgestein; er riecht leicht nach Moder und Salpeter. Gut zweihundert Sitzplätze sind in den Tunnel gebaut worden, Baustrahler malen Lichtflächen auf Backsteinrot und Betongrau. Der Tunnel zieht sich in den Berg hinein, verliert sich 300 Meter weit im Dunkel – eine Höhle, die hinter der Bühne zu warten scheint und von der man nicht wissen kann, was sie beherbergt.

Der Tunnel heute: Ein Theater – erste Zuschauer suchen sich ihre Plätze Foto: Norman Liebold
Als das Licht ausgeht und für einen Moment Dunkelheit herrscht, wird es fast unheimlich. Ein perfekter Ort, die Vergangenheit herauf zu beschwören und wirken zu lassen. Ein einzelner Spot reißt einen scharf umrissenen Lichtkreis aus dem Dunkel. Eine Landkarte ist aufgehängt, rechts ein altes Plakat: „Klagt nicht, kämpft!“ steht in Fraktur darauf. Schritte – nicht von der Bühne – schwere Stiefel kommen von hinten, vom Eingang her, aus der Richtung der Ruinen. Im Kampfanzug, Stahlhelm auf dem Kopf, tritt ein amerikanischer Soldat in den Lichtkreis und beginnt zu sprechen.
Ein gewagter Anfang: Leutnant Karl Heinz Timmermann, gespielt vom 29jährigen Robert Christott, spricht einen mehr als viertelstündigen Monolog, erklärt die Situation, beschreibt Lage und Zustand der Kriegsfronten – übrigens in einer hervorragenden schauspielerischen Leistung, wie auch die des restlichen Ensembles. Und es gelingt Christott, dass das Publikum gebannt bis zum letzten Wort lauscht. Denn, auch wenn er mit dem Zeigestock vor der Karte steht, er hat nichts Lehrerhaftes: Da steht ein Mensch mit einer Geschichte, und er zitiert kein Schulbuch, sondern schildert persönliches Kriegserleben.
Timmermanns Vater war Deutscher, Deserteur aus Liebe zu Maria, mit der er nach Amerika ging – der Sohn kommt als Soldat zurück, steht über dem Rhein, erinnert sich, dass er hier schon einmal war – auf den Schultern des Vaters. „Riesengroß“ hat er genau an der Stelle schon einmal über das Rheintal geschaut. Man nimmt Timmermann seine Geschichte ab. Wenn er erzählt, wie er die Tür eines Hauses eintritt und den verängstigten Bewohnern als Mensch begegnet, versucht, mit der Angst umzugehen und das richtige zu tun, wirkt er authentisch. „Der Sohn eines Deserteurs“, der zurückkehrend zeigen will, was er kann, verhindert Heldenpathos von vornherein und macht neugierig auf die Geschichten, die er zu erzählen hat.

Alltag im Tunnel: Kriegsanekdoten bei zu dünnem Kaffee (Hitlerjungen und Flakhelfer gespielt von Dollmann, Birkner Grosch, Musekamp, Ullrich)
Foto: Friedhelm Schulz [1]
Das vielleicht ist das Herausragende am Stück. „Die Brücke“ erzählt von Menschen: Im Tunnel sitzen eine handvoll Wehrmachtssoldaten und Flüchtlinge, während die Front der Amerikaner auf der anderen Seite aufmarschiert. Mit schiefem Grinsen wird die Waffenliste durchgegangen: Aus aller Herren Länder zusammengewürfelt italienische, russische, tschechische Maschinengewehre, Granatwerfer, Panzerfäuste – nur leider keine passende Munition. Vom Volkssturm sind gerade einmal zehn Leute aufgetaucht, und während im „Soldatensender West“ die Reichspropaganda von Siegen und heldenhaften Schlachten kratzt und krächzt, sitzt man hier im Tunnel und ärgert sich über zu dünnen Kaffee, erinnert sich schwärmend an eine Silvestertorte mit Marmelade aus der Erpeler Marmeladenfabrik. Ein linientreuer Hitlerjunge wirft bei Mangel an Begeisterung Wehrkraftzersetzung vor, ein anderer hat die Nase gestrichen voll von Krieg und Führer und den ganzen Durchhalteparolen. Bissig werden Materialmängel und sinnfreie Befehle kommentiert: „Es wäre zum Lachen, wenn es nicht um den Endsieg ginge.“
Doch niemand glaubt mehr an Endsiege, man steht auf verlorenem Posten: Je drei Soldaten sind in den Türmen der Ludendorffbrücke stationiert, während von Meckenheim her die amerikanische Front näher rückt. Die Situation im Tunnel ist glaubhaft, die Charaktere mit Liebe fürs Detail gestaltet und mit Einfühlungsvermögen gespielt. Das „Wunder von Remagen“ ist kein Wunder, es sind menschliche Schicksale, es ist Materialmangel, es sind Verkettungen von zum Teil absurder Zufälle, wie sie das Leben zu allen Zeiten – und oft nicht ohne Humor – schreibt. Vielleicht dadurch wieder ein tatsächliches Wunder, das den Krieg um Monate verkürzt und so unzählige Menschenleben rettet.
Das Stück zeigt nicht zuletzt auch die Absurdität des Kriegs und auf einer anderen Ebene von Politik im Allgemeinen: So taucht zu Fuß und allein ein Major Scheller – gespielt von Matthias Kiel – auf und fordert von Hauptmann Bratge (Heiko Haynert) das Kommando über die Brücke. Keiner weiß irgendetwas davon, man schielt auf seine Hand, um vielleicht einen amerikanischen Spion am rechts- statt linkshändig getragenen Ehering zu erkennen, fragt nach Papieren, Generälen und Unterschriften, während die ganze Situation immer mehr ins Absurde abgleitet.

Befehlsrangeleien: Major Scheller (Mitte Kiel) und Hauptmann Bratge (rechts Haynert) | Foto: Friedhelm Schulz [1]
Bratge und Scheller liefern sich schon fast amüsante Rangeleien um die Befehlsgewalt: Während Scheller die Brücke unbedingt offen halten will, weil er an irgendwelche ominösen Truppenverbände glaubt, die die Amerikaner wie zwischen „Hammer und Amboss“ zermalmen sollen, will der ehemalige Kommandeur Bratge die Sprengung sofort vornehmen, weil er einsieht, dass hier nichts mehr zu retten ist. Keine mit Pathos aufgeladenen Kämpfe, hier werden sich Dienstvorschriften vorzitiert und auf Weisungen des „Führers“ gepocht – und letztlich wird das Gerangel gleich zwiefach in seiner ganzen Idiotie gezeigt.
Lakonisch kommentiert einer der Soldaten: Wird die Brücke zu früh gesprengt, wird erschossen, und wenn sie zu spät hochgeht, droht dasselbe. Vor dem Hintergrund, dass vier von fünf Offiziere später durch das „Fliegende Standgericht West“ hingerichtet wurden und der fünfte – Hauptmann Bratge – nur überlebte, weil er sich in Kriegsgefangenschaft befand, dringt hier die Bitterkeit des Krieges, ohne mit künstlicher Betroffenheit eingehämmert zu werden, deutlich durch. Im Publikum saß neben Abgeordneten von Bundestag und Europaparlament auch Adele Zöllner, Augenzeugin der Hinrichtungen in Oberirsen, was das Dargestellte für den Zuschauer noch wiedererfahrbarer machte.
Als die Amerikaner schon auf der Brücke stehen, lenkt Major Scheller endlich ein. Was jedoch nichts ändert: Zuerst versagt die elektrische Zündanlage, dann ist die Zündschnur 20 Meter zu kurz, und als schließlich doch der Sprengstoff explodiert, zeigt sich, was der Sprengmeister schon erklärt hatte: „Wir können froh sein, dass wir überhaupt einen Knall gehört haben!“ Statt 600 Kilogramm Pioniersprengstoff waren nur 300 Kilogramm „Donarit“ vorhanden gewesen, was so viel bringt wie „Scheibenkleister“. Die Finger in den Ohren starren Soldaten, Volksstürmler und Flüchtlinge ins Publikum und sehen, dass die Brücke sich hebt, wieder senkt und schließlich unbeeindruckt stehen bleibt.

Sprengversuch. Zuerst funktioniert die elektrische Zündanlage nicht, dann ist die Zündschnur zu kurz, schließlich versagt erwartungsgemäß der Sprengstoff | Foto: Rheinzeitung [1]
Die Eroberung der Ludendorff-Brücke geht jetzt schnell – einen Augenblick später ist eine Maschinengewehrsalve zu hören. Von einer der Wände spritzt Gestein weg, Einschusslöcher sind zu sehen. Der Spezialeffekt sitzt – das Publikum fährt zusammen und ist hellwach. Einer der Volkssturmleute sackt zusammen: Willi Felder, gespielt von Winfried Esch, einziges ziviles Opfer der Aktion.
Und gleich darauf steht Leutnant Timmermann auf der Bühne. Er spricht Englisch und zieht einen der Hitlerjungen als Dolmetscher heran. Von dem symphathischen jungen Mann, den das Publikum am Anfang kennenlernte, ist zuerst wenig zu sehen. Mit vorgehaltener Waffe werden – hart, aber fair – die Bedingungen der Gefangenschaft laut Genfer Konvention erklärt, die Flüchtlinge sollen nach Hause gehen, und als Hauptmann Bratge fragt, ob er seine persönlichen Dinge holen könne, bekommt er ein „Fuck off!“ zu hören. Lacher aus dem Publikum, als Bratge den dolmetschenden Jungen fragt, ob das wohl eine Zustimmung sei.
An dieser Stelle kippt das durch seine glaubhaften Charaktere und die realistische, angenehm unpathetische Darstellung hervorragende Stück. Als nur noch der Hitlerjunge Klaus (gespielt von Frank Musekamp) und Timmermann auf der Bühne stehen, wird der Amerikaner zum Inbegriff der Menschlichkeit und zum freundlichen Befreier stilisiert. Auf deutsch lobt er den Hitlerjungen für seine Dolmetscherleistung, bietet ihm einen Kaugummi an, erklärt dem bass erstaunten Jungen in verschmitztem Kumpelton, dass „Timmermann“, wenn man das „T“ durch ein „Z“ ersetzt, ja „Zimmermann“ hieße und gestattet der Mutter des Jungen, ihn mit nach hause zu nehmen.

Blick aus dem Tunnel auf die Ludendorffbrücke kurz nach der Einnahme
Foto: William Spangle
Das ist ein wenig zuviel des Guten; im Gegensatz zu dem sonst um historische Glaubwürdigkeit bemühten Stück ist diese auffällige Szene nicht belegt und wirkt gewollt. Allerdings ist das der einzige Moment in dem 75 Minuten langen Stück, der in diesem Sinne aufstößt. Und er wird aufgewogen durch ein Detail schon fast hinterhältiger Art: Während Christott als Timmermann dem Stück durch einen abschließenden Monolog einen Rahmen verleiht, zitiert er Berthold Brecht mit „Das große Karthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten.“ Mahnend erinnert er an die beiden Kriege, die von deutschem Boden ausgingen und betont – vielleicht ein wenig lehrstückhaft, dass dies nicht noch einmal geschehen dürfe. Ob es nun bewusst gesetzt oder nicht, das Stück wird plötzlich hochaktuell und gewinnt eine weitere Ebene weit über die Bewussthaltung der nationalsozialistischen Verbrechen hinaus, denn seit 1999 sind wieder deutsche Soldaten an Kriegen beteiligt. (CH)
[1] Szenenfotos mit freundlicher Genehmigung des Kunst- und Kulturkreis Erpel e.V.
Online-Flyer Nr. 160 vom 20.08.2008
Im Theater im Tunnel geht „Die Brücke“ in die dritte Spielzeit
Das Wunder von Remagen
Von Norman Liebold

Ruine der Ludendorffbrücke auf der Remagener Rheinseite mit den Flaggen von Deutschland und den USA | Foto: Norman Liebold
Walter Ullrich, Intendant der Landesbühne Rheinland-Pfalz, verarbeitete die Geschehnisse um die Eroberung der Brücke zu einem Theaterstück, das sich auf den Roman „Die Brücke von Remagen“ von Rolf Palm stützt, aber auch das Wissen von Zeitzeugen nutzt. Die Idee war, das Stück am Originalschauplatz aufzuführen, dem Eisbahntunnel, der von der Brücke in das Gestein der Erpeler Ley führt. „Ich mache das Stück, Sie machen den Tunnel“, hatte Ullrich zu Edgar Neustein gesagt, der daraufhin im November 2005 den Verein „ad Erpelle“ gründete.
Mit der Summe von 32.000 Euro und unzähligen Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit wurde das klamme Loch in das „Theater im Tunnel“ verwandelt und die Uraufführung des Stücks „Die Brücke“ bereits im Oktober 2006 möglich gemacht. Die vorsichtig angesetzten fünf Aufführungen im Jahre 2006 waren ausverkauft, 2007 waren es 20, ebenfalls bis auf den letzten Platz gefüllte Aufführungen. Am 15. August wurde das Stück für 2008 wieder aufgenommen und wird bis zum 31. August gespielt.
Im Tunnel ist es kalt – einige der Zuschauer haben sich Decken mitgebracht, die sie sich um die Schulter legen. Lockt draußen ein warmer Sommerabend in die Biergärten, sind es im Inneren des Berges gerade einmal zwölf Grad. Auch die Stimmung ist eine gänzlich andere: Der Tunnel hat etwas von einer Katakombe: Backsteingemauert hängt das Gewölbe über den Köpfen, und darüber weiß man zigtausend Tonnen Basaltgestein; er riecht leicht nach Moder und Salpeter. Gut zweihundert Sitzplätze sind in den Tunnel gebaut worden, Baustrahler malen Lichtflächen auf Backsteinrot und Betongrau. Der Tunnel zieht sich in den Berg hinein, verliert sich 300 Meter weit im Dunkel – eine Höhle, die hinter der Bühne zu warten scheint und von der man nicht wissen kann, was sie beherbergt.

Der Tunnel heute: Ein Theater – erste Zuschauer suchen sich ihre Plätze Foto: Norman Liebold
Als das Licht ausgeht und für einen Moment Dunkelheit herrscht, wird es fast unheimlich. Ein perfekter Ort, die Vergangenheit herauf zu beschwören und wirken zu lassen. Ein einzelner Spot reißt einen scharf umrissenen Lichtkreis aus dem Dunkel. Eine Landkarte ist aufgehängt, rechts ein altes Plakat: „Klagt nicht, kämpft!“ steht in Fraktur darauf. Schritte – nicht von der Bühne – schwere Stiefel kommen von hinten, vom Eingang her, aus der Richtung der Ruinen. Im Kampfanzug, Stahlhelm auf dem Kopf, tritt ein amerikanischer Soldat in den Lichtkreis und beginnt zu sprechen.
Ein gewagter Anfang: Leutnant Karl Heinz Timmermann, gespielt vom 29jährigen Robert Christott, spricht einen mehr als viertelstündigen Monolog, erklärt die Situation, beschreibt Lage und Zustand der Kriegsfronten – übrigens in einer hervorragenden schauspielerischen Leistung, wie auch die des restlichen Ensembles. Und es gelingt Christott, dass das Publikum gebannt bis zum letzten Wort lauscht. Denn, auch wenn er mit dem Zeigestock vor der Karte steht, er hat nichts Lehrerhaftes: Da steht ein Mensch mit einer Geschichte, und er zitiert kein Schulbuch, sondern schildert persönliches Kriegserleben.
Timmermanns Vater war Deutscher, Deserteur aus Liebe zu Maria, mit der er nach Amerika ging – der Sohn kommt als Soldat zurück, steht über dem Rhein, erinnert sich, dass er hier schon einmal war – auf den Schultern des Vaters. „Riesengroß“ hat er genau an der Stelle schon einmal über das Rheintal geschaut. Man nimmt Timmermann seine Geschichte ab. Wenn er erzählt, wie er die Tür eines Hauses eintritt und den verängstigten Bewohnern als Mensch begegnet, versucht, mit der Angst umzugehen und das richtige zu tun, wirkt er authentisch. „Der Sohn eines Deserteurs“, der zurückkehrend zeigen will, was er kann, verhindert Heldenpathos von vornherein und macht neugierig auf die Geschichten, die er zu erzählen hat.

Alltag im Tunnel: Kriegsanekdoten bei zu dünnem Kaffee (Hitlerjungen und Flakhelfer gespielt von Dollmann, Birkner Grosch, Musekamp, Ullrich)
Foto: Friedhelm Schulz [1]
Das vielleicht ist das Herausragende am Stück. „Die Brücke“ erzählt von Menschen: Im Tunnel sitzen eine handvoll Wehrmachtssoldaten und Flüchtlinge, während die Front der Amerikaner auf der anderen Seite aufmarschiert. Mit schiefem Grinsen wird die Waffenliste durchgegangen: Aus aller Herren Länder zusammengewürfelt italienische, russische, tschechische Maschinengewehre, Granatwerfer, Panzerfäuste – nur leider keine passende Munition. Vom Volkssturm sind gerade einmal zehn Leute aufgetaucht, und während im „Soldatensender West“ die Reichspropaganda von Siegen und heldenhaften Schlachten kratzt und krächzt, sitzt man hier im Tunnel und ärgert sich über zu dünnen Kaffee, erinnert sich schwärmend an eine Silvestertorte mit Marmelade aus der Erpeler Marmeladenfabrik. Ein linientreuer Hitlerjunge wirft bei Mangel an Begeisterung Wehrkraftzersetzung vor, ein anderer hat die Nase gestrichen voll von Krieg und Führer und den ganzen Durchhalteparolen. Bissig werden Materialmängel und sinnfreie Befehle kommentiert: „Es wäre zum Lachen, wenn es nicht um den Endsieg ginge.“
Doch niemand glaubt mehr an Endsiege, man steht auf verlorenem Posten: Je drei Soldaten sind in den Türmen der Ludendorffbrücke stationiert, während von Meckenheim her die amerikanische Front näher rückt. Die Situation im Tunnel ist glaubhaft, die Charaktere mit Liebe fürs Detail gestaltet und mit Einfühlungsvermögen gespielt. Das „Wunder von Remagen“ ist kein Wunder, es sind menschliche Schicksale, es ist Materialmangel, es sind Verkettungen von zum Teil absurder Zufälle, wie sie das Leben zu allen Zeiten – und oft nicht ohne Humor – schreibt. Vielleicht dadurch wieder ein tatsächliches Wunder, das den Krieg um Monate verkürzt und so unzählige Menschenleben rettet.
Das Stück zeigt nicht zuletzt auch die Absurdität des Kriegs und auf einer anderen Ebene von Politik im Allgemeinen: So taucht zu Fuß und allein ein Major Scheller – gespielt von Matthias Kiel – auf und fordert von Hauptmann Bratge (Heiko Haynert) das Kommando über die Brücke. Keiner weiß irgendetwas davon, man schielt auf seine Hand, um vielleicht einen amerikanischen Spion am rechts- statt linkshändig getragenen Ehering zu erkennen, fragt nach Papieren, Generälen und Unterschriften, während die ganze Situation immer mehr ins Absurde abgleitet.

Befehlsrangeleien: Major Scheller (Mitte Kiel) und Hauptmann Bratge (rechts Haynert) | Foto: Friedhelm Schulz [1]
Bratge und Scheller liefern sich schon fast amüsante Rangeleien um die Befehlsgewalt: Während Scheller die Brücke unbedingt offen halten will, weil er an irgendwelche ominösen Truppenverbände glaubt, die die Amerikaner wie zwischen „Hammer und Amboss“ zermalmen sollen, will der ehemalige Kommandeur Bratge die Sprengung sofort vornehmen, weil er einsieht, dass hier nichts mehr zu retten ist. Keine mit Pathos aufgeladenen Kämpfe, hier werden sich Dienstvorschriften vorzitiert und auf Weisungen des „Führers“ gepocht – und letztlich wird das Gerangel gleich zwiefach in seiner ganzen Idiotie gezeigt.
Lakonisch kommentiert einer der Soldaten: Wird die Brücke zu früh gesprengt, wird erschossen, und wenn sie zu spät hochgeht, droht dasselbe. Vor dem Hintergrund, dass vier von fünf Offiziere später durch das „Fliegende Standgericht West“ hingerichtet wurden und der fünfte – Hauptmann Bratge – nur überlebte, weil er sich in Kriegsgefangenschaft befand, dringt hier die Bitterkeit des Krieges, ohne mit künstlicher Betroffenheit eingehämmert zu werden, deutlich durch. Im Publikum saß neben Abgeordneten von Bundestag und Europaparlament auch Adele Zöllner, Augenzeugin der Hinrichtungen in Oberirsen, was das Dargestellte für den Zuschauer noch wiedererfahrbarer machte.
Als die Amerikaner schon auf der Brücke stehen, lenkt Major Scheller endlich ein. Was jedoch nichts ändert: Zuerst versagt die elektrische Zündanlage, dann ist die Zündschnur 20 Meter zu kurz, und als schließlich doch der Sprengstoff explodiert, zeigt sich, was der Sprengmeister schon erklärt hatte: „Wir können froh sein, dass wir überhaupt einen Knall gehört haben!“ Statt 600 Kilogramm Pioniersprengstoff waren nur 300 Kilogramm „Donarit“ vorhanden gewesen, was so viel bringt wie „Scheibenkleister“. Die Finger in den Ohren starren Soldaten, Volksstürmler und Flüchtlinge ins Publikum und sehen, dass die Brücke sich hebt, wieder senkt und schließlich unbeeindruckt stehen bleibt.

Sprengversuch. Zuerst funktioniert die elektrische Zündanlage nicht, dann ist die Zündschnur zu kurz, schließlich versagt erwartungsgemäß der Sprengstoff | Foto: Rheinzeitung [1]
Die Eroberung der Ludendorff-Brücke geht jetzt schnell – einen Augenblick später ist eine Maschinengewehrsalve zu hören. Von einer der Wände spritzt Gestein weg, Einschusslöcher sind zu sehen. Der Spezialeffekt sitzt – das Publikum fährt zusammen und ist hellwach. Einer der Volkssturmleute sackt zusammen: Willi Felder, gespielt von Winfried Esch, einziges ziviles Opfer der Aktion.
Und gleich darauf steht Leutnant Timmermann auf der Bühne. Er spricht Englisch und zieht einen der Hitlerjungen als Dolmetscher heran. Von dem symphathischen jungen Mann, den das Publikum am Anfang kennenlernte, ist zuerst wenig zu sehen. Mit vorgehaltener Waffe werden – hart, aber fair – die Bedingungen der Gefangenschaft laut Genfer Konvention erklärt, die Flüchtlinge sollen nach Hause gehen, und als Hauptmann Bratge fragt, ob er seine persönlichen Dinge holen könne, bekommt er ein „Fuck off!“ zu hören. Lacher aus dem Publikum, als Bratge den dolmetschenden Jungen fragt, ob das wohl eine Zustimmung sei.
An dieser Stelle kippt das durch seine glaubhaften Charaktere und die realistische, angenehm unpathetische Darstellung hervorragende Stück. Als nur noch der Hitlerjunge Klaus (gespielt von Frank Musekamp) und Timmermann auf der Bühne stehen, wird der Amerikaner zum Inbegriff der Menschlichkeit und zum freundlichen Befreier stilisiert. Auf deutsch lobt er den Hitlerjungen für seine Dolmetscherleistung, bietet ihm einen Kaugummi an, erklärt dem bass erstaunten Jungen in verschmitztem Kumpelton, dass „Timmermann“, wenn man das „T“ durch ein „Z“ ersetzt, ja „Zimmermann“ hieße und gestattet der Mutter des Jungen, ihn mit nach hause zu nehmen.

Blick aus dem Tunnel auf die Ludendorffbrücke kurz nach der Einnahme
Foto: William Spangle
Das ist ein wenig zuviel des Guten; im Gegensatz zu dem sonst um historische Glaubwürdigkeit bemühten Stück ist diese auffällige Szene nicht belegt und wirkt gewollt. Allerdings ist das der einzige Moment in dem 75 Minuten langen Stück, der in diesem Sinne aufstößt. Und er wird aufgewogen durch ein Detail schon fast hinterhältiger Art: Während Christott als Timmermann dem Stück durch einen abschließenden Monolog einen Rahmen verleiht, zitiert er Berthold Brecht mit „Das große Karthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten.“ Mahnend erinnert er an die beiden Kriege, die von deutschem Boden ausgingen und betont – vielleicht ein wenig lehrstückhaft, dass dies nicht noch einmal geschehen dürfe. Ob es nun bewusst gesetzt oder nicht, das Stück wird plötzlich hochaktuell und gewinnt eine weitere Ebene weit über die Bewussthaltung der nationalsozialistischen Verbrechen hinaus, denn seit 1999 sind wieder deutsche Soldaten an Kriegen beteiligt. (CH)
[1] Szenenfotos mit freundlicher Genehmigung des Kunst- und Kulturkreis Erpel e.V.
Online-Flyer Nr. 160 vom 20.08.2008