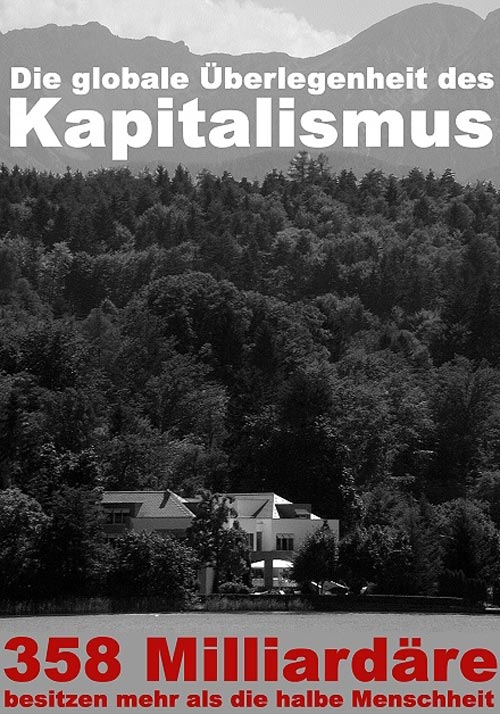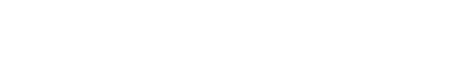SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Literatur
Die Debatten der Lyrikszene
Stürme im literarischen Wasserglas
Von Gerrit Wustmann
Rund dreihundert Lyrikleser gebe es in Deutschland, hat Thomas Kling einmal vorgerechnet und damit Hans Magnus Enzensbergers Zahl von rund dem Vierfachen stark nach unten gedrückt. Ich schätze, dass diese Schätzung in etwa richtig liegt. Sie kommt darauf hinaus, dass die Lyrikszene sich selbst liest, ergänzt von einer kaum nennenswerten Schicht kulturell und sprachlich interessierter Rezipienten. Eben dieses traurige Bild einer kulturell verarmenden Gesellschaft zeichnet auch die Debattenkultur der Szene: Sie dreht sich um sich selbst, ohne nennenswerte Außenwirkung. Um es mit Robert Musil zu sagen: „Woraus bemerkenswerter Weise nichts hervorgeht“. Aber damit zitiere ich einen Prosaautor, und ich hoffe, dass mir das nicht als Foul angerechnet wird. Denn gegen die Prosaschreiber holt Mesch mächtig aus: Die hätten „keine Ahnung vom Werk ihrer Kollegen“. Das ist natürlich Unsinn. Der Unterschied ist möglicherweise der, dass Prosaautoren sich nicht in ewigem Palaver über ihre Werke, sich selbst und die Kollegen ergehen, sondern sich in erster Linie aufs Schreiben ihrer Erzählungen und Romane konzentrieren. Obwohl die junge deutsche Lyrik floriert wie selten zuvor, wünscht man sich bisweilen, die Lyriker täten eben das: In erster Linie die Gedichte sprechen lassen.
Der Schall der Debatte
Stefan Mesch streift durch die Lyrik im Onlinezeitalter, die eben dieses Gemisch aus Dichtung und Diskussion präsentiert, das vielleicht manchen Leser abschreckt. Da mosert Mesch, zugegeben nicht zu Unrecht, darüber, dass die Benutzerführung des Poetenladens suboptimal sei. Ja, und was bringt uns das? Richtig, schon wieder nichts. Und der durchschnittliche ZEIT-Leser hat noch weniger davon, denn anstatt zum lyrischen Stöbern und Entdecken wird er eher dazu angeregt, angesichts des Gemäkels Abstand zu wahren. Iris Radisch hat das Publikum im Sommer 2007 schon mit einem erstaunlich unkenntnisgeladenen Artikel davon abgehalten, Zugang zur Lyrik zu finden. Man hätte meinen sollen, dass einer, der aus der Szene kommt, es besser macht. Er hätte ja stattdessen über Lyrik schreiben und ein paar der wirklich herausragenden jungen Talente vorstellen können. Aber der Schall der Debatte scheint ihm wichtiger zu sein.
In einem Leserkommentar zu Meschs Artikel verweist die Poetenladen-Redaktion darauf, dass Mesch sich dort vor Jahren beworben habe und abgelehnt wurde. Man kann hier Zusammenhänge erkennen, muss es aber nicht. Ich habe mich vor Jahren einmal mit einigen Gedichten bei der von Mesch mitherausgegebenen Bellatriste beworben, ohne je eine Antwort zu erhalten. Seinerzeit hat es mich gefuchst, mittlerweile ist es mir egal. Vielleicht waren auch die von mir eingereichten Gedichte schlecht, ich weiß es nicht mehr. Damals hatte diese kleine aber beachtliche Redaktion erstmals in den überregionalen Feuilletons auf sich aufmerksam gemacht, als sie eine wirklich hervorragende Ausgabe mit Schwerpunkt Lyrik und Lyrikdebatte herausgab.
Was so hoffnungsvoll begann, wurde zu eben jenem lahmen Tanz um die eigene Achse. Selbst das wäre verzeihlich, würde der Truppe nicht inzwischen etwas Elitäres anhaften (ich lasse meinen Eindruck, sollte ich mich irren, gerne korrigieren). Das spürt man daran, dass es in der „Community“ inzwischen zwei Debattenlager gibt: Das „offene“ und das „Bellalager“, das sich weitestgehend auf Autoren aus dem Dunstkreis der Hildesheimer beschränkt. Dieses Lager debattiert nicht „mit den Anderen“, sondern allerhöchstens über sie, eine Haltung, die auch in Meschs Einwurf spürbar ist. Man kann sich nichtmal drüber ärgern – nur wundern. Bis heute lese ich die Bella gerne, aber sie ist im Vergleich mit anderen „jungen“ Literaturzeitschriften nichts Besonderes. Man kann darin großartige Entdeckungen machen (bezogen auf Lyrik und Prosa), findet aber auch vieles, das mit Wasser gekocht ist. Letzten Endes ist das mit jeder Anthologie so, ob gedruckt oder digital. Ich spüre das verstärkt, seit ich die Lyrikreihe in der NRhZ herausgebe – natürlich ist meine Auswahl subjektiv, natürlich bevorzuge ich diejenigen Autorinnen und Autoren, deren Werke mich begeistern, in mir etwas auslösen, mich nachdenklich stimmen, mich zum Weiterlesen animieren, und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen unserer täglich rund 5500 Leser ähnlich geht. Zu sehen, dass die NRhZ in der Lyrikszene wahrgenommen wird, ist schön - zu sehen, dass die Lyrik in der NRhZ auch außerhalb der Szene wahrgenommen würde, wäre noch schöner.
Modisch-lyrisches Blabla
Es gibt bei der Auswahl eines, das ich vermeide: modisch-lyrisches Blabla. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass zuviel über Lyrik und Lyriker und Lyriker-Egos palavert wird, oder ob es ein Trend ist. Aber neben den zahlreichen beeindruckenden Talenten finde ich auf jeder einschlägigen Website, in jeder Anthologie, vom „Jahrbuch“ über „Lyrik von Jetzt“, dieses Blabla. Ich meine damit eine Lyrik, die sich so sehr um sich selbst zu drehen scheint wie die Debatten. Ich meine damit nicht Ulf Stolterfohts "unverständliche" Lyrik, für die er im "Jahrbuch 2008" plädierte. Austauschbare, belanglose, beliebige Lyrik mit immer wieder gleichen Motive in nur scheinbar origineller sprachlicher Ausführung, wohinter sich bei mehrmaligem Lesen rein gar nichts verbirgt, brauchen wir nicht. Ein Kunde bei Amazon machte bei einem Lyrikband von Houellebecq mal das Experiment, dass er Verse aus drei oder vier unterschiedlichen Gedichten zu einem neuen zusammenfügte. Bei der Lyrik, von der ich spreche und die ich ärgerlich finde, je öfter sie mir begegnet, funktioniert das auch: Man kann sie demontieren, willkürlich neu arrangieren, und keiner würde was merken, mitunter vermutlich nichtmal die Autoren selbst. Das geht aber eben nur mit schlechter Lyrik, denn gute ist nicht austauschbar. Ein gutes, ein wirklich gutes Gedicht ist eine Einheit, variierbar vielleicht, optimierbar vielleicht, aber wenn man ein Element entfernt, dann bricht es in sich zusammen.
In den gegenwärtigen Debatten ist es ebenso wie in der beliebigen Lyrik, die nicht objektiv schlecht ist. Aber gut zu sein, das gaukelt sie (auch durch behauptete Unverständlichkeit) nur vor. Vielleicht liegt das daran, dass ihre Schöpfer gar nicht wissen, worüber und wie sie eigentlich schreiben sollen. Vielleicht liegt es daran, dass sie gerne um den heißen Brei herum debattieren, das aber erst dürfen, wenn sie ihren eigenen Brei in den großen Topf gekippt haben. Man weiß es nicht, und es ist auch nicht wichtig.
Was wichtig ist
Wichtig ist, dass es gute, dass es fabelhafte, brillante Lyrik gibt und dass sowohl die junge als auch die alte Generation sehr Lesenswertes schreibt. Darauf kommt es an. Dem Leser, der auf die Debatten stößt, und der sich ob des Fragezeichens wundert, das die Ratlosigkeit ihm comichaft auf den Schädel zeichnet, sei gesagt, dass er die Debatten getrost ignorieren kann. Lieber soll er in aller Ruhe in den Gedichten selbst stöbern. Da wird er auf viele zu Recht etablierte und sich gerade etablierende Namen treffen, und vielleicht wird er die eine oder andere Entdeckung machen, von der die Szene selbst noch gar keine Notiz genommen hat.
Wenn manch einer nur halb soviel Energie in seine Lyrik stecken würde, wie er in seine Kommentare, Glossen und Poetiken (oder das, was als solche verstanden werden will) steckt, wäre viel gewonnen.
(GW)
Notiz: Eigentlich hatte ich mich nie in diese Debatten einmischen wollen. Nun hab ich es doch getan. Hoffentlich zum letzten Mal.
Online-Flyer Nr. 215 vom 18.09.2009
Die Debatten der Lyrikszene
Stürme im literarischen Wasserglas
Von Gerrit Wustmann
Rund dreihundert Lyrikleser gebe es in Deutschland, hat Thomas Kling einmal vorgerechnet und damit Hans Magnus Enzensbergers Zahl von rund dem Vierfachen stark nach unten gedrückt. Ich schätze, dass diese Schätzung in etwa richtig liegt. Sie kommt darauf hinaus, dass die Lyrikszene sich selbst liest, ergänzt von einer kaum nennenswerten Schicht kulturell und sprachlich interessierter Rezipienten. Eben dieses traurige Bild einer kulturell verarmenden Gesellschaft zeichnet auch die Debattenkultur der Szene: Sie dreht sich um sich selbst, ohne nennenswerte Außenwirkung. Um es mit Robert Musil zu sagen: „Woraus bemerkenswerter Weise nichts hervorgeht“. Aber damit zitiere ich einen Prosaautor, und ich hoffe, dass mir das nicht als Foul angerechnet wird. Denn gegen die Prosaschreiber holt Mesch mächtig aus: Die hätten „keine Ahnung vom Werk ihrer Kollegen“. Das ist natürlich Unsinn. Der Unterschied ist möglicherweise der, dass Prosaautoren sich nicht in ewigem Palaver über ihre Werke, sich selbst und die Kollegen ergehen, sondern sich in erster Linie aufs Schreiben ihrer Erzählungen und Romane konzentrieren. Obwohl die junge deutsche Lyrik floriert wie selten zuvor, wünscht man sich bisweilen, die Lyriker täten eben das: In erster Linie die Gedichte sprechen lassen.
Der Schall der Debatte
Stefan Mesch streift durch die Lyrik im Onlinezeitalter, die eben dieses Gemisch aus Dichtung und Diskussion präsentiert, das vielleicht manchen Leser abschreckt. Da mosert Mesch, zugegeben nicht zu Unrecht, darüber, dass die Benutzerführung des Poetenladens suboptimal sei. Ja, und was bringt uns das? Richtig, schon wieder nichts. Und der durchschnittliche ZEIT-Leser hat noch weniger davon, denn anstatt zum lyrischen Stöbern und Entdecken wird er eher dazu angeregt, angesichts des Gemäkels Abstand zu wahren. Iris Radisch hat das Publikum im Sommer 2007 schon mit einem erstaunlich unkenntnisgeladenen Artikel davon abgehalten, Zugang zur Lyrik zu finden. Man hätte meinen sollen, dass einer, der aus der Szene kommt, es besser macht. Er hätte ja stattdessen über Lyrik schreiben und ein paar der wirklich herausragenden jungen Talente vorstellen können. Aber der Schall der Debatte scheint ihm wichtiger zu sein.
In einem Leserkommentar zu Meschs Artikel verweist die Poetenladen-Redaktion darauf, dass Mesch sich dort vor Jahren beworben habe und abgelehnt wurde. Man kann hier Zusammenhänge erkennen, muss es aber nicht. Ich habe mich vor Jahren einmal mit einigen Gedichten bei der von Mesch mitherausgegebenen Bellatriste beworben, ohne je eine Antwort zu erhalten. Seinerzeit hat es mich gefuchst, mittlerweile ist es mir egal. Vielleicht waren auch die von mir eingereichten Gedichte schlecht, ich weiß es nicht mehr. Damals hatte diese kleine aber beachtliche Redaktion erstmals in den überregionalen Feuilletons auf sich aufmerksam gemacht, als sie eine wirklich hervorragende Ausgabe mit Schwerpunkt Lyrik und Lyrikdebatte herausgab.
Was so hoffnungsvoll begann, wurde zu eben jenem lahmen Tanz um die eigene Achse. Selbst das wäre verzeihlich, würde der Truppe nicht inzwischen etwas Elitäres anhaften (ich lasse meinen Eindruck, sollte ich mich irren, gerne korrigieren). Das spürt man daran, dass es in der „Community“ inzwischen zwei Debattenlager gibt: Das „offene“ und das „Bellalager“, das sich weitestgehend auf Autoren aus dem Dunstkreis der Hildesheimer beschränkt. Dieses Lager debattiert nicht „mit den Anderen“, sondern allerhöchstens über sie, eine Haltung, die auch in Meschs Einwurf spürbar ist. Man kann sich nichtmal drüber ärgern – nur wundern. Bis heute lese ich die Bella gerne, aber sie ist im Vergleich mit anderen „jungen“ Literaturzeitschriften nichts Besonderes. Man kann darin großartige Entdeckungen machen (bezogen auf Lyrik und Prosa), findet aber auch vieles, das mit Wasser gekocht ist. Letzten Endes ist das mit jeder Anthologie so, ob gedruckt oder digital. Ich spüre das verstärkt, seit ich die Lyrikreihe in der NRhZ herausgebe – natürlich ist meine Auswahl subjektiv, natürlich bevorzuge ich diejenigen Autorinnen und Autoren, deren Werke mich begeistern, in mir etwas auslösen, mich nachdenklich stimmen, mich zum Weiterlesen animieren, und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen unserer täglich rund 5500 Leser ähnlich geht. Zu sehen, dass die NRhZ in der Lyrikszene wahrgenommen wird, ist schön - zu sehen, dass die Lyrik in der NRhZ auch außerhalb der Szene wahrgenommen würde, wäre noch schöner.
Modisch-lyrisches Blabla
Es gibt bei der Auswahl eines, das ich vermeide: modisch-lyrisches Blabla. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass zuviel über Lyrik und Lyriker und Lyriker-Egos palavert wird, oder ob es ein Trend ist. Aber neben den zahlreichen beeindruckenden Talenten finde ich auf jeder einschlägigen Website, in jeder Anthologie, vom „Jahrbuch“ über „Lyrik von Jetzt“, dieses Blabla. Ich meine damit eine Lyrik, die sich so sehr um sich selbst zu drehen scheint wie die Debatten. Ich meine damit nicht Ulf Stolterfohts "unverständliche" Lyrik, für die er im "Jahrbuch 2008" plädierte. Austauschbare, belanglose, beliebige Lyrik mit immer wieder gleichen Motive in nur scheinbar origineller sprachlicher Ausführung, wohinter sich bei mehrmaligem Lesen rein gar nichts verbirgt, brauchen wir nicht. Ein Kunde bei Amazon machte bei einem Lyrikband von Houellebecq mal das Experiment, dass er Verse aus drei oder vier unterschiedlichen Gedichten zu einem neuen zusammenfügte. Bei der Lyrik, von der ich spreche und die ich ärgerlich finde, je öfter sie mir begegnet, funktioniert das auch: Man kann sie demontieren, willkürlich neu arrangieren, und keiner würde was merken, mitunter vermutlich nichtmal die Autoren selbst. Das geht aber eben nur mit schlechter Lyrik, denn gute ist nicht austauschbar. Ein gutes, ein wirklich gutes Gedicht ist eine Einheit, variierbar vielleicht, optimierbar vielleicht, aber wenn man ein Element entfernt, dann bricht es in sich zusammen.
In den gegenwärtigen Debatten ist es ebenso wie in der beliebigen Lyrik, die nicht objektiv schlecht ist. Aber gut zu sein, das gaukelt sie (auch durch behauptete Unverständlichkeit) nur vor. Vielleicht liegt das daran, dass ihre Schöpfer gar nicht wissen, worüber und wie sie eigentlich schreiben sollen. Vielleicht liegt es daran, dass sie gerne um den heißen Brei herum debattieren, das aber erst dürfen, wenn sie ihren eigenen Brei in den großen Topf gekippt haben. Man weiß es nicht, und es ist auch nicht wichtig.
Was wichtig ist
Wichtig ist, dass es gute, dass es fabelhafte, brillante Lyrik gibt und dass sowohl die junge als auch die alte Generation sehr Lesenswertes schreibt. Darauf kommt es an. Dem Leser, der auf die Debatten stößt, und der sich ob des Fragezeichens wundert, das die Ratlosigkeit ihm comichaft auf den Schädel zeichnet, sei gesagt, dass er die Debatten getrost ignorieren kann. Lieber soll er in aller Ruhe in den Gedichten selbst stöbern. Da wird er auf viele zu Recht etablierte und sich gerade etablierende Namen treffen, und vielleicht wird er die eine oder andere Entdeckung machen, von der die Szene selbst noch gar keine Notiz genommen hat.
Wenn manch einer nur halb soviel Energie in seine Lyrik stecken würde, wie er in seine Kommentare, Glossen und Poetiken (oder das, was als solche verstanden werden will) steckt, wäre viel gewonnen.
(GW)
Notiz: Eigentlich hatte ich mich nie in diese Debatten einmischen wollen. Nun hab ich es doch getan. Hoffentlich zum letzten Mal.
Online-Flyer Nr. 215 vom 18.09.2009