SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Literatur
Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 13
Max - Jahrgang 27
Von Lutz Köhlert

Am nächsten Tag rollt die Arbeit wieder. Dreiundzwanzig Waggons werden gefördert, man hat vom Vortag noch etwas aufzuarbeiten.
Dann gewöhnt man sich an den neuen Rhythmus. Es macht sogar ein besseres Gefühl, etwas zu schaffen, als nur zu faulenzen. Wenn das auch mancher nicht wahrhaben will.
Überraschend werden zu abends um sechs alle im Lager zusammengetrommelt. Ingenieur Lejeune kommt, der Obersteiger Gomez und natürlich Mauser. Der übersetzt etwa folgendes: Weil manche viel arbeiten, andere wenig, soll Leistung belohnt werden. Drei Gruppen werden gebildet, die für ihre Arbeit verantwortlich sind, immer zwei Mann in der Schießschicht, zwei Mann Räumschicht, ein Mann Verbau und ein Schieber über Tage. Jedes Mal sechs. Holzplatz, Koks, Brecher und Ofen können nicht getrennt werden, sondern werden gemeinsam einbezogen. Die Prämien sollen so aussehen: Wenn eine Gruppe acht Waggons fördert, bekommt sie Zusatzverpflegung wie bisher. Weniger als acht Waggons – kein Supplement. Für jeden Waggon mehr als acht bekommt jeder in der Gruppe fünf Francs zusätzlich! (Das ist absolut betrachtet nicht gerade viel, bedeutet aber für die Gefangenen eine ganze Menge.) Bei weniger als sechs Waggons werden die fehlenden von der Leistung des nächsten Tages abgezogen.
Das System ist nicht so kompliziert wie es scheint, aber es beginnt ein eifriges Rechnen. Schließlich sind aber die meisten einverstanden, selbst die faulen Köppe, denn acht Waggons (wenn auch für sechs Mann) hören sich nicht so schlimm an wie vierundzwanzig insgesamt.
Spannend wird die Einteilung der Gruppen. Als Hauer in der Schießschicht sollen Willi Breitenbach, Hein Skroszny und Heinz Frömmich arbeiten. Sie sind gleichzeitig Brigadiers und suchen sich die Mitarbeiter aus.
Willi Breitenbach nimmt sich Reinhard Balke, Skroszny seinen liebsten Streitpartner Emil, und Frömmich nimmt sich überraschenderweise Max.
Der hat widersprüchliche Gefühle. Einerseits ist er geschmeichelt, und er kann sicherlich von Frömmich eine Menge lernen. Frömmich macht auch den Eindruck, daß er mit seinen Leuten durch dick und dünn ginge. Andererseits ist er sehr autoritär. Max wird da nicht viel zu sagen haben. Aber er hat sich bisher nie gefürchtet, wenn nötig auch Vorgesetzten zu widersprechen, und Frömmich ist nicht einmal Vorgesetz-ter, sondern nur in gewisser Weise respektheischend – und ja auch zweifellos erfahrener als Max. Als erstes nimmt er Max mit zur Witwe Lacombe, bei der er eine Jalousie reparieren soll.
Es ist nicht ohne einen gewissen Altruismus, daß Frömmich Max zur Witwe mitnimmt, denn die angenehmeren Nebenarbeiten oder freundlicheren und großzügigeren Auftrag-geber sind allgemein begehrt, und niemand will sich selber unbequeme Konkurrenten schaffen. Später wird Frömmich Max dafür halten, allerdings mehr als Favoriten der Witwe. Frömmich hat schon einmal das Gärtchen der molligen, freundlichen und rundum anziehenden Madame aufgeräumt und wird es in Zukunft noch intensiver betreiben. Er war dafür zum Abendessen eingeladen worden und hatte, strategisch gedacht, andere Vergütungen abgelehnt. Dieses Mal wird also Max in die Gastlichkeit der Witwe einbezogen und fühlt sich wohl in der heimeligen und kulturvollen Umgebung, die sich so auffällig von dem Verfallscharme der Rattenburg und dem grobschlächtigen Benehmen seiner Gefährten abhebt.
Max erfreut sich auch einer herzerwärmenden und ein wenig prickelnden Aufmerksamkeit seitens der zwölfjährigen blonden Tochter der Witwe, Germaine, der er mit Charme und Ritterlichkeit zu begegnen versucht. Das bringt ihm seitens Madame Lacombes einen schelmisch drohenden Finger und die Warnung ein: „Monsieur, ne me faites-pas de souci!“, wobei erotische Absichten von Max weiter entfernt sind als der Mond, und die Witwe ist mehr als doppelt so alt wie Max, gehört für ihn also eigentlich in ein vergangenes Jahrhundert.
Die Schießschicht hat ihre eigene Ordnung. Der Hauer der Schießschicht ist der King der Truppe. Bohren vor Granit und Quarz ist eine der härtesten Arbeiten, die es gibt. Vor Quarz müssen die Bohrkronen alle zehn Minuten ausgewechselt werden. Die Schicht beginnt zehn Uhr abends und dauert, wenn es schlimm kommt, bis sechs Uhr früh. So lange dauert sie selten, denn das Schichtgestein ist weicher Dreck, nur durchzogen von Quarzadern, die wieder Antimonoxyd mit sich führen. Den Tag über hat man dann frei für Schlaf, Spaziergänge oder Arbeiten, die Geld bringen.
Der Steiger hat angezeichnet, wo und wie gebohrt und geschossen wird. Der Hauer bestimmt Anzahl, Lage und Tiefe der Bohrlöcher, acht bis zwölf, sechzig bis einhundert-zwanzig Zentimeter tief. Der Kumpel karrt Bohrhammer, Preßluftschläuche und Gezähe, Dynamit, Zündschnur und Sprengkapseln heran.
Preßluft erzeugt ein zentraler Kompressor, von dem aus die Schläuche bis in den Vortrieb gezerrt werden. Gebohrt wird mit einem Sechzehn-Kilo-Eisenklotz, einem Preßlufthammer. Wenn ihm die Preßluft Leben einbläst, wird aus dem Klotz ein brüllendes Raubtier, das sich mit langen Stahlzähnen in die Eingeweide des Berges frißt. Er speit ätzende Staubwolken, denn es gibt keine Wasserspülung, und will den klammernden Händen entspringen. Auch künstliche Belüftung kennt die Mine nicht. Gegen den Staub bindet man sich einen feuchten Schwamm vor Mund und Nase. Der rutscht dauernd herab und wird deshalb weggelassen, und die Lungen saugen mühsam Sauerstoff aus den Staubwolken. Der Staub verklebt mit Schweiß und bildet eine schmierige graue Schicht auf der Haut.
Max’ Kumpel Willi wird ein paar Jahre nach seiner Heimkehr, noch nicht vierzigjährig, an seiner Staublunge sterben.
Zwölf Löcher sind gebohrt, Heinz Frömmich stellt den Hammer ab. Das Knattern des Kompressors schlurrt noch schwach durch den Stollen und wirkt in der plötzlichen Stille überlaut. Max wirft die Stützgabel beiseite, und Frömmich klinkt den Bohrstahl aus und betrachtet die Bohrkrone. Sie ist plattgeschlagen. „Weich wie ’n Käse! Wir härten die näch-sten selber. Gib das Dynamit rüber.“ Max reicht ihm die gummiartigen gelben Stangen. Frömmich stopft mit einem Stock zunächst drei von ihnen in jedes Loch. Dann verlangt er: „Knallzündschnur und Sprengkapseln!“ Er schneidet die Zündschnüre auf verschiedene Längen, damit die Kern-ladung als erste zündet, die Randladungen eine Sekunde später. So schafft der zuerst herausgesprengte Kern Platz für das seitlich herausbrechende Erz. Vorsichtig schiebt Frömmich die Sprengkapseln auf die Enden der Zündschnüre. Die drückt er dann in eine vierte Stange Dynamit für jedes Loch und schiebt sie vorsichtig hinein. „Kannst du verdäm-men“, weist er Max an. Der mischt aus Abwasserschlamm und Gesteinsstaub eine Art Mörtel, den er in die Bohrlöcher drückt und sie so verklebt.
Frömmich verbindet inzwischen die Knallzündschnüre, die das Zündfeuer schlagartig weitergeben, mit einer zwei Meter langen, langsam brennenden Zündschnur, die er im Stollen auslegt. Max wirft das Werkzeug in den Hunt und schiebt ihn bis zum nächsten Querstollen.
Frömmich begutachtet die Löcher, prüft nochmals die Verbindung der Zündschnüre, schaut sich um, ob etwas liegengeblieben ist, und sagt dann zu Max: „Warte am Querstollen, falls meine Lampe ausgeht.“ Dann entzündet er die Schnur mit der Grubenlampe. Sie sprüht auf und der Funke beginnt, sich durch die Schnur zu fressen.
Frömmich hastet bis zum Querstollen und zieht Max tiefer hinein. Beide hocken sich hin, öffnen den Mund und stecken sich die Finger in die Ohren. Der Luftdruck der Explosion kommt Sekundenbruchteile vor dem Donner und läßt ihre Kleidung flattern.
Sie sind wider Willen zusammengezuckt, jetzt grinsen sie sich an.
Eine dicke Qualmwolke wälzt sich durch den Stollen und hüllt sie ein. Max muß husten. Zum Glück zieht ein schwaches Wetter aus dem Quertrieb in Richtung Hauptstollen und nimmt den Qualm langsam mit.
Sie warten drei, vier Minuten, der Qualm lichtet sich. Sie gehen vorsichtig zur Schießstelle, im schwindenden Qualm Verbau und Stollen musternd. Der ist jetzt einen guten Meter länger. Abraum und Erz sind in einem fast sauberen Rechteck herausgebrochen und bilden einen großen Hau-fen. Frömmich ist zufrieden: „Da kann die Frühschicht mindestens zehn, vielleicht sogar zwölf Waggons raushauen. Schmelzer soll nicht mit Ausreden kommen!“ Er kramt eine in ein Taschentuch gewickelte Uhr aus der Jackentasche: „Halb zwei. Nicht schlecht. Denn mal los! Sind wir Viertel nach zwei zu Hause.“ Max holt den Waggon heran, sie werfen das Werkzeug hinein und machen sich auf den Weg.
Mit größerer Bewegungsfreiheit, den alltäglichen Begegnun-gen und dem „Guten Tag!“ und „Guten Abend!“ entwickeln sich engere Beziehungen zu den Dorfbewohnern. Die Ge-fangenen werden mehr und mehr heimisch, sie werden mehr und mehr akzeptiert, in dem Maße, wie sie sich als hilfswillig, fleißig und geschickt erweisen. Man kennt die meisten Ge-sichter und ist oft selbst bekannter, als man das weiß. Man grüßt die junge, hübsche Frau des Ingenieurs und Frau Mauser, sagt zu dem Obersteiger Gomez und zum Zimmermann García „Salut!“, tauscht ein Lächeln und ein paar unbeholfene Worte mit der Witwe Lacombe oder ihrer Tochter Germaine, wenn man in dem kleinen Kramladen eine Nähnadel, eine Rolle Garn oder ein paar Schnürsenkel kaufen will. Natürlich wird, entsprechend der gesellschaftlichen Ordnung des Dorfes, Monsieur le Curé besonders aufmerksam gegrüßt, auch wenn man sich daraus keinen unmittelbaren Nutzen verspricht. Der Priester ist schließlich – nach der Jungfrau Maria – der Mittelsmann zum Lieben Gott. So wird der unmittelbare Nachbar der Gefangenen, der Schweinehändler Cauchon, auch seinem Renommee entsprechend, geschnitten, weil er ein Geizhals und Meckerer ist und die Gefangenen durch immer neue Beschwerden über ihr Benehmen, ihren Gesang, ihr Lachen, ihre Rücksichtslosigkeit und überhaupt ihre Anwesenheit nervt. Aber damit er sich nicht ganz grundlos ereifert, werfen sie ihm gelegentlich ein paar ausgelutschte Feigenschalen, eine Kippe oder eine leere Flasche auf seinen Hof. Er scheucht dann seine verschreckte Frau, den Unrat zu beseitigen, und stellt die leere Flasche in den Keller, um sie bei der nächsten Kelter zu verwenden.
Allgemein betrachtet, erkennen die Dorfbewohner in den Gefangenen Menschen, die sich nicht wesentlich von ihnen selbst unterscheiden. Unterschwellig aber verstehen sie sie auch als eine Art Heloten, die arbeitswillig und billig sind und deren Fähigkeiten und Fertigkeiten man sich zunutze machen muß. Mehr persönliche, engere und intimere Beziehungen, die hier und da wohl entstehen, bleiben unter der Decke.
Die Männer übernehmen also in ihrer Freizeit mehr und mehr Arbeiten für die Leute im Dorf. Die häufigsten Tätigkeiten sind Holz zerkleinern, Gärten roden und um-graben oder Transporte aller Art. Zunächst werden solche Leistungen mit Lebensmitteln bezahlt, einem Abend-brot beim Auftraggeber, einem Brot, einer Flasche Wein oder Raki, ein selbstgebrannter Treberschnaps, oder auch Zigaretten. Mit fortschreitender Zeit und für handwerklich schwierige oder besonders schwere Arbeiten gibt es auch Geld. ‚Richtiges‘ Geld, kein ‚Lagergeld‘. Der zunehmende Bedarf an billigen Arbeitskräften steigert den Lohn mit der Zeit.
Da kann es denn passieren, daß Max und Bodo, die eine Fuhre Möbel verladen haben, sich weigern, auch abzuladen, wenn sie nicht jeder pro Stunde zwanzig oder auch dreißig Francs bekommen. Der Wirt des Bistros, um den es sich in diesem Fall handelt, rückt zähneknirschend das Geld heraus, weil er für reguläre Arbeitskräfte das Drei- oder Vierfache bezahlen müßte, und beeilt sich beim nächsten Mal, das Entgelt vor Beginn der Arbeit genauer auszuhandeln.
Es sei daran erinnert, daß die Gefangenen für die schwere Arbeit in der Mine täglich ganze fünf Francs bar bekommen, in Lagergeld, und weitere fünf Francs auf ein Konto. Der Gegenwert für fünf Francs ist eine Gauloise – eine einzelne Zigarette, nicht etwa eine Schachtel! – oder ein Viertelliter Wein.
Die Männer beweisen aber durchaus Sinn für soziale Gerechtigkeit. Sie machen die Preise nach dem Auftraggeber. Während die immer freundliche Witwe Lacombe mit ihrer netten Tochter Germaine für das Aufräumen des Schuppens vielleicht zehn Francs für die Stunde bezahlt, vielleicht sogar nur ein kräftiges Abendessen, muß der dicke Wirt des Bistros dafür die dreißig Francs berappen. Manche Persönlichkeiten unterliegen unterschiedlichen Bewertungen. Im Pfarrer zum Beispiel sehen die einen einen heiligen Mann, der nicht gerupft werden darf, während andere in ihm ein Mitglied der Oberschicht sehen, das es sich leisten kann, einen armen Gefangenen großzügig zu entlohnen.
Max hält sich in diesem Fall mehr in der Mitte. Die hilfreiche Tat steht allerdings unter einem bösen Stern. Als er gemeinsam mit Bodo Schmude für Monsieur le Curé Holz zerkleinert, springt die Säge aus dem Schnitt und reißt ihm häßlich die Finger auf. Er weiß nicht recht, ob er das als Strafe für seinen Mangel an Devotion sehen soll. Jedenfalls eilt der Pfarrer mit ihm zum unweit wohnenden Arzt, der die Finger mit Wasserstoffsuperoxyd reinigt und verbindet. Die Arbeit ist zwar für dieses Mal beendet, aber Monsieur le Curé lädt seine Holzarbeiter dennoch zum Abendessen an seinen Tisch.
Es gibt auch Arbeiten, die Spaß machen. Als der Frühling schon zu riechen ist, kommt eine Anfrage aus dem Bistro de la Montagne nach zwei Hilfskellnern für ein Festessen. Bei allem Interesse an einem zusätzlichen Verdienst gibt es tiefsitzende Vorbehalte dagegen, sich zum Helfer und Helfershelfer, ‚Diener oder Sklaven‘, zum ‚Kollaborateur‘ der Franzosen zu machen. Wegen solcher Vorbehalte lehnen manche Arbeiten ab, die eine zu große Nähe zum Arbeitgeber verlangen. Auch gegen das Kellnern gibt es solche Vorurteile.
Als sich Frieda Külow um Aufmerksamkeit bemüht, herrscht in der Guten Stube ein buntes Treiben: „Hört mal her!“ Aber Emil und Skroszny streiten sich weiter darum, ob der Roßschlächter in Pillkallen Slavomir oder Lubomil geheißen hat. Balke, Breitenbach und Schmelzer dreschen Skat. Frömmich hämmert an einem Fünffrancsstück herum, aus dem er einen Siegelring machen will. Frieda muß lauter werden, so daß seine Stimme in den Diskant rutscht: „Ruhe im Puff! Alle mal herhören!“ Der Lärm verebbt. „Es gibt was zu verdienen. Der Wirt vom Bistro braucht Ostersonnabend zwei Hilfskellner für eine größere Feier, Verlobung oder so was. Zehn Francs die Stunde und satt zu essen! Wer hat Lust?“
Balke winkt ab: „Kellnern? Mich rumkommandieren lassen? Ich bin doch nicht deren Fußabtreter!“
Frieda wundert sich: „Na hör mal! Kellnern ist doch ein ehrenwerter Beruf.“
Schmelzer dagegen hat schon ganz gierige Augen: „Ich mach’ das gerne! Kann man sich doch mal den Wanst vollschlagen!“ Schmelzer ist ein Apotheker aus Konstanz. Er ist um die Fünfzig, ein hagerer Mann, aber immer hungrig. Nur die aus seinem Vollbart gierig hervorglänzenden Lippen könnten ein Hinweis sein. Er leidet echt unter der mageren Lagerkost. Im Umgang ist er mitteilsam, zudringlich und geschwätzig und bei akademischer Bildung besserwisserisch.
Frömmich bremst ihn ab: „Du Freßsack! Wenn wir dich da hinschicken, versaust du uns das ganze Renommee!“
Schmelzer will aufbegehren: „Erlaube mal!“
„Halt dein’ Mund!“ fährt ihm Frömmich in die Parade. „Das mit dem Kellnern ist so ’ne Sache. Es gibt schmierige, arrogante, pomadige, raffgierige, verfressene, aber auch eifrige und bemühte Kellner. Und deshalb ist das hier so was wie ein öffentlicher Auftritt ‚der Gefangenen‘. Wir müssen gut überlegen, wer da hingeht.“
Schmelzer verteidigt sich wütend: „Ich lass’ mir doch von dir nicht vorschreiben, ob ich da hingehen darf!“
Frieda versucht zu vermitteln: „Die Anfrage ist aber nicht an dich ergangen! Heinz hat recht. Die Kellner sind sozusagen unsere Repräsentanten. Sie müssen anständig aussehen, sie müssen sich anständig benehmen und sie müssen ein bißchen flott bei der Arbeit sein.“
Sigi stänkert: „Nu brich dir mal keine Verzierung ab! Wir werden uns für die Franzosen doch nicht den Arsch aufreißen.“
Frieda: „Du bist sowieso nicht gefragt! Ich schlage vor, daß wir die beiden Jungen schicken. Max und Bodo, seid ihr einverstanden?“
„Na klar!“
„Aber immer.“
Frieda: „Was zieht ihr an?“
Max: „Meine Khakihose und meinen Kolani.“
Zu Bodo: „Und du?“
„Hm ..., ja ...“ Bodo schaut ein bißchen hilflos an sich herunter. „Meine Amibluse ..., wenn die frisch gewaschen ist, sieht sie prima aus! Und die Hosen.“ Er deutet auf seine Gummistiefel: „Aber andere Schuhe habe ich nicht.“
„Machste die Hose über die Stiefel. Und ihr benehmt euch anständig!“
„Sonst kriegt ihr was hinter die Ohren!“ ergänzt Skroszny die ,Dienstanweisung‘.
Max nimmt sich vor, auf Bodo aufzupassen.
Damit ist die Diskussion erledigt, und Schmelzer drückt sich wieder in seine Ecke.
Der Auftrag wird ohne den üblichen Neid den beiden Jungen zugesprochen, weil sie nicht von dem engstirnigen Nationalstolz der ‚Erwachsenen‘ befallen sind.
Zum Fest im Bistro de la Montagne erscheinen etwa dreißig Personen zwischen sechs und achtzig Jahren. Sie sind festlich gekleidet. Die Männer tragen einen Schlips um den zu engen Kragen und eine Jacke, die sie so bald wie möglich ausziehen. Die Knaben haben lange Hosen an. Die Frauen sind in Seidenkleider mit und ohne Rüschen gewickelt, die über allen, meist kräftig ausgeprägten, Rundungen spannen. Die kleinen Mädchen tragen Puppenkleider. Wie ein schwarzer Rabe hockt Monsieur le Curé in seiner Soutane zwischen den bunten Vögeln.
Das Fest ist ein Essen mit vielen Gängen und Pausen, in denen man raucht und tanzt, und mit noch mehr Getränken. Für Stimmung sorgen die Musettewalzer eines Akkordeonspielers, mit vielen Trillern, Triolen und Kaprio-len. Keiner hört hin, doch der Rhythmus der Musik vereint alle in einer angeregten, stimmungsträchtigen Heiterkeit. Mancher behält bei Tisch seine Baskenmütze auf, mancher schiebt im Mund mit dem Messer nach, es kann auch sein, daß jemand seine Zigarre sorgfältig an den Tellerrand legt, um zwischendurch einen Happen zu essen. An der Tafel wird nichts übelgenommen, es geht üppig, laut und fröhlich zu.
Max allerdings findet die Tischsitten korrekturbedürftig. Auch er und Bodo Schmude sind gewaschen und gebügelt. Schließlich gibt es im Camp ein altes Holzkohle-Bügeleisen unter Tünnes’ Aufsicht, das stark benutzt wird. Man betreibt es freilich nicht mit Holzkohle, sondern stellt es einfach auf die heiße Herdplatte. Bodo trägt ein sauberes Khakihemd zu den gebügelten Hosen, die in die Gummistiefel gestopft sind. Bei ihrer Altersbuntheit fällt ein sorgfältig auf den Hintern gesetzter Flicken kaum auf. Max hat seine Amihose an und einen blauen Kolani, das knapp sitzende Oberbekleidungs-stück der Matrosen, allerdings ohne das eigentlich vorge-schriebene, aber schwer zu knüpfende schwarze Halstuch mit dem koketten weißen Schleifchen.
Sie pendeln mit Speisen, Getränken und leerem Geschirr zwischen der Küche und der Festtafel hin und her. Anfangs ist Max sein kaum die Glatze tarnender Stoppelhaarschnitt peinlich, aber da das niemand anderen stört und niemand darüber Bemerkungen macht, vergißt er ihn bald.
Wenn zufällig nichts aufzutragen oder abzuräumen ist, lehnen die beiden am Durchgang zur Küche, wo auf einem Tischchen für sie zwei Gläser Rotwein stehen. Bodo schaut sich um, ob er beobachtet wird, und zieht ein in eine Serviette gewickeltes Hühnerbein aus der Tasche und beißt hinein. Obwohl vermutlich kaum jemand von der Gesellschaft etwas dagegen hätte, ist das dem pingeligen Max peinlich: „Mußt du jetzt fressen? Wir kriegen doch nachher was!“
Schmude kaut ungerührt: „Was ich habe, das hab’ ich. Ich verstehe gar nicht, warum die andern das hier nicht machen wollten. Essen, trinken, flotte Weiber und Musik – und mal raus aus der Bude.“
Max ist nicht ganz so unbefangen: „Beim Arbeitsdienst und bei der Marine habe ich mich immer darum gedrückt, Ordonnanz oder Putzer zu spielen.“
Das versteht Schmude nicht: „Schön blöde! Das waren doch die Druckposten.“
Max ging es nie darum, sich zu drücken. Er wollte zwar nicht unbedingt den Heldentod sterben, aber gedrückt vor einem Einsatz hätte er sich nicht. Nur auf ein U-Boot wollte er nach Möglichkeit nicht gehen, auch nicht in einen Panzer. Der Gedanke, in so einem Blechsarg zu stecken, war ihm unheimlich und unerträglich. Dabei war es dann im Kesselraum des ‚Hans Lody‘ auch nicht gemütlicher. Bei Hochdruck-Heißdampf von einhundertzwanzig Atü und sechshundert Grad wäre er bei einer Havarie in Sekundenschnelle gedünstet worden.
„Ich mache nicht gerne den Fußabtreter für andere“, erklärt er Bodo. Der wechselt das Thema: „Hier kannste Studien machen, was?“ überlegt er. „Wie die essen, rumkrümeln, sich auf den Tisch fläzen – zwischendurch qualmen und schwofen.“ Max wundert sich, daß ausgerechnet Bodo Schmude die Tischsitten beklagt.
Der ist aber schon wieder bei seinem Lieblingsthema: „Würde mich nicht wundern, wenn sie zwischen zwei Gängen auch schnell mal ’ne Nummer schieben.“
„Du kannst wohl über nischt anderes als Thema eins reden, wie?“
Der Wirt unterbricht das Gespräch und ruft aus dem Küchendurchgang: „Garçons! Le prochain plat. Vite, vite!“
Bodo versteckt den Rest seines Hühnerbeins, und Max beeilt sich, in die Küche zu kommen: „Oui, monsieur le patron ...“ Bodo latscht mit „Immer mit der Ruhe“ pomadig hinterher.
In der Küche brodelt und brutzelt es. Der große Herd speit Glut, ein Dutzend großer und kleiner Töpfe drängen sich um die Feuerlöcher und blasen Dampf. Auf dem großen Tisch häufen sich Gemüse, Früchte und Fleisch, Speck, Öl und Kräuter. Zwei dralle Frauen putzen, schneiden zurecht, würzen, sieben, kneten und klappern mit Brettern, Messern und Deckeln.
Das Mädchen, das Max in der Kirche gesehen hat, ist dabei, Gemüse zu zerkleinern. Als er sie beim Hereinkommen anblickt, lächelt sie ihm zu, ohne die Arbeit zu unterbrechen. Er lächelt zurück, und eine warme Welle durchflutet sein Herz.
Der Wirt, ein dicker Mann mit Stirnglatze und durchtriebenem Blick, weist Max und Schmude die Schüsseln mit Coq au vin, die sie hineintragen sollen: „Ceux-ci! Et dépêchez-vous!“
Das Mädchen schaut Max nach, als er im Saal verschwindet, und als er sie beim Hereinkommen wieder anlächelt, hält sie für einen Augenblick mit der Arbeit inne, um zurückzulächeln. Der Patron hat den Blickwechsel bemerkt und schnauzt sie an: „Ne rêve-pas, Marie-Paule! Bouge-toi! Les clients attendent le prochain plat.“ Das Mädchen wendet sich schnell ab und trägt das zerkleinerte Gemüse zum Herd, wo es angebraten werden soll.
Marie-Paule heißt sie also.
Jetzt erst sieht Max, daß sie eine schiefe Schulter hat. Er wendet den Blick nicht von ihr ab, aber sein Lächeln ge-friert.
Körperliche Mißbildungen sind Max unangenehm. Er bemitleidet solche Menschen, aber er möchte sich nicht mit ihnen abgeben. Scheinbar notwendige Rücksichtnahmen bringen ihn in Verlegenheit, obwohl er begreift, daß Behinderte als vollwertige Menschen betrachtet werden und keine besondere Rücksichtnahme wollen, sofern ihre Behinderung sie nicht unbedingt erfordert.
Als sie sich wieder umwendet, dreht er rasch den Kopf weg, um ihren Augen nicht zu begegnen, und eilt mit der nächsten Schüssel zurück in den Saal. Später versucht er, sie unbemerkt zu betrachten, und sie weicht seinen Blicken aus und schaut unentwegt auf ihre Arbeit.
Ihre Erscheinung ist freundlich und lieblich, die Lippen sind voll und rot, die langen braunen Haare hat sie zu einer Schnecke hochgesteckt, die nackten Arme sind sanft gerundet und doch kräftig. Ihre schiefe Schulter beeinträchtigt ihre Bewegungen nicht und erscheint ihm zunehmend unwe-sentlich. Ein kleiner Schönheitsfehler. Dafür bemerkt er unter ihrer zu großen Küchenschürze eine schlanke, flinke Gestalt mit ausgeprägten weiblichen Rundungen.
Seine Gefühle sind aufgestört, wirr und widersprüchlich, seine Gedanken wandern ab, zu anderen Mädchen, die er irgendwann einmal betrachtet hat. Doch die Vergleiche mißlingen. Marie-Paule beherrscht seine Vorstellungen.
Spät geht Max noch ein paar Schritte durchs Dorf, um seine Gefühle und Gedanken, die durcheinanderpurzeln, zu sortieren: Ein hübsches, freundliches Mädchen, das ihn offenbar mag – ein kleiner Haltungsfehler, der den Kameraden Anlaß zum Spotten sein wird –, aber sie mag ihn und er fühlt sich angezogen von ihr – was wird der Dorf-tratsch dazu sagen?
Die Luft ist nach einem warmen Tag frisch geworden. Sie bewahrt noch die Düfte des nahen Frühlings. Der Himmel ist sternenklar. Man möchte zu ihnen emporschweben.
Zwei große Erlebnisse beschäftigen Max: Erstens, daß es gemeinsam gelingen kann, wenn man sich einig ist, wesentliche Interessen durchzusetzen, also handelndes Subjekt, nicht nur Objekt der Ereignisse zu sein, und als Zweites, daß die Zuneigung zu einem Mädchen ein ganz persönliches, verwirrendes, widersprüchliches Erlebnis sein kann.
So in Gedanken ist Max durch das Dunkel des Ortes geschlendert. Jetzt bleibt er stehen, um festzustellen, wo er ist. Er überlegt, ob er noch zum Kirchberg hinaufgehen und einen Blick auf das schlafende Dorf werfen soll, als er eine kleine Gestalt bemerkt, die von der Straße her, etwa vom Bistro auf ihn zukommt. Er ahnt mehr als er erkennt, daß es Marie-Paule ist. Sein Herz schlägt plötzlich heftig. Er hat den Wunsch, sie möge ihn ansprechen, andererseits fürchtete er sich davor, ihr im Dunkeln entgegenzutreten. Die Situation erscheint ihm zu intim. Die Dunkelheit würde sie beide in einen gemeinsamen Mantel hüllen, und Max fürchtet diese Nähe, obwohl er sie sich sehr wünscht. Er weiß nicht, ob er dem Wunsch widerstehen kann, sie in die Arme zu schließen, und er scheut ihre Reaktion, gleich ob sie ihn zurückweist oder auch ihrerseits umarmt. Er wendet sich zur Seite und tritt ins Gebüsch des Seitenwegs, wo er sich still verhält in der Hoffnung, daß sie das nicht bemerkt habe.
Marie-Paule kommt vorbei und verlangsamt den Schritt, dann aber geht sie doch weiter geradeaus.
Max ist zugleich erleichtert und enttäuscht. Er schilt sich einen Idioten, weil er dem harmlosen Verlangen nicht nachgegeben hat, sie zu begrüßen.
Mitten im März, die Mandel- und Maulbeerbäume blühen und die Sonne wärmt, fällt unerwartet Schnee. Er ist naß und schwer. Mit dicken Flocken legt er sich über Wege, Dächer, Bäume und Sträucher. Er klebt auf den Zweigen und zwingt sie hinab zur Erde. Was sich nicht biegen läßt, zerbricht er. Die Telefonleitungen werden unter seiner Last zu armdicken Tauen. Die Drähte ächzen, aber sie reißen nicht. Die Masten müssen die Leitungen von Hang zu Hang über das Tal hinweg tragen und sind der Last nicht gewachsen. Sie werden vom Schnee krummgezogen und neigen sich zur Erde wie Grashalme. Der Winter neidet dem Frühling seinen Auftritt.
Die Alten sagen, einen solchen Schnee hat es seit dreißig Jahren nicht gegeben. Die Menschen müssen durch dicke nasse Watte stapfen, und ohne Gummistiefel bekommen sie nasse Füße. Von den Gefangenen haben nur Skroszny und Schmude Gummistiefel. Schmudes haben Löcher.
Der Schnee hat die Luft abgekühlt, und morgens haben die Männer Reif auf der Bettdecke. Der Schnee macht es schwierig, Koks von der Halde aufzulesen. Abends heizen sie wieder mit Grubenkoks.
Zum Glück hält sich der Schnee nicht lange, nach zwei Tagen ist er verschwunden. Wo das Wasser schlecht abfließt, pampt der Lehmboden eine Woche lang knöcheltief. Der Bach schwillt zu einem reißenden, lehmbraunen Flüßchen an, in dem man keine Wäsche mehr waschen kann. Doch das Frühjahr kommt unaufhaltsam.(PK)
Lesen Sie die Fortsetzung des biografischen Romans in der kommenden Ausgabe, oder - bequemer - bestellen Sie das Buch bei edition winterwork
Online-Flyer Nr. 306 vom 15.06.2011
Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 13
Max - Jahrgang 27
Von Lutz Köhlert

Am nächsten Tag rollt die Arbeit wieder. Dreiundzwanzig Waggons werden gefördert, man hat vom Vortag noch etwas aufzuarbeiten.
Dann gewöhnt man sich an den neuen Rhythmus. Es macht sogar ein besseres Gefühl, etwas zu schaffen, als nur zu faulenzen. Wenn das auch mancher nicht wahrhaben will.
Überraschend werden zu abends um sechs alle im Lager zusammengetrommelt. Ingenieur Lejeune kommt, der Obersteiger Gomez und natürlich Mauser. Der übersetzt etwa folgendes: Weil manche viel arbeiten, andere wenig, soll Leistung belohnt werden. Drei Gruppen werden gebildet, die für ihre Arbeit verantwortlich sind, immer zwei Mann in der Schießschicht, zwei Mann Räumschicht, ein Mann Verbau und ein Schieber über Tage. Jedes Mal sechs. Holzplatz, Koks, Brecher und Ofen können nicht getrennt werden, sondern werden gemeinsam einbezogen. Die Prämien sollen so aussehen: Wenn eine Gruppe acht Waggons fördert, bekommt sie Zusatzverpflegung wie bisher. Weniger als acht Waggons – kein Supplement. Für jeden Waggon mehr als acht bekommt jeder in der Gruppe fünf Francs zusätzlich! (Das ist absolut betrachtet nicht gerade viel, bedeutet aber für die Gefangenen eine ganze Menge.) Bei weniger als sechs Waggons werden die fehlenden von der Leistung des nächsten Tages abgezogen.
Das System ist nicht so kompliziert wie es scheint, aber es beginnt ein eifriges Rechnen. Schließlich sind aber die meisten einverstanden, selbst die faulen Köppe, denn acht Waggons (wenn auch für sechs Mann) hören sich nicht so schlimm an wie vierundzwanzig insgesamt.
Spannend wird die Einteilung der Gruppen. Als Hauer in der Schießschicht sollen Willi Breitenbach, Hein Skroszny und Heinz Frömmich arbeiten. Sie sind gleichzeitig Brigadiers und suchen sich die Mitarbeiter aus.
Willi Breitenbach nimmt sich Reinhard Balke, Skroszny seinen liebsten Streitpartner Emil, und Frömmich nimmt sich überraschenderweise Max.
Der hat widersprüchliche Gefühle. Einerseits ist er geschmeichelt, und er kann sicherlich von Frömmich eine Menge lernen. Frömmich macht auch den Eindruck, daß er mit seinen Leuten durch dick und dünn ginge. Andererseits ist er sehr autoritär. Max wird da nicht viel zu sagen haben. Aber er hat sich bisher nie gefürchtet, wenn nötig auch Vorgesetzten zu widersprechen, und Frömmich ist nicht einmal Vorgesetz-ter, sondern nur in gewisser Weise respektheischend – und ja auch zweifellos erfahrener als Max. Als erstes nimmt er Max mit zur Witwe Lacombe, bei der er eine Jalousie reparieren soll.
*
Es ist nicht ohne einen gewissen Altruismus, daß Frömmich Max zur Witwe mitnimmt, denn die angenehmeren Nebenarbeiten oder freundlicheren und großzügigeren Auftrag-geber sind allgemein begehrt, und niemand will sich selber unbequeme Konkurrenten schaffen. Später wird Frömmich Max dafür halten, allerdings mehr als Favoriten der Witwe. Frömmich hat schon einmal das Gärtchen der molligen, freundlichen und rundum anziehenden Madame aufgeräumt und wird es in Zukunft noch intensiver betreiben. Er war dafür zum Abendessen eingeladen worden und hatte, strategisch gedacht, andere Vergütungen abgelehnt. Dieses Mal wird also Max in die Gastlichkeit der Witwe einbezogen und fühlt sich wohl in der heimeligen und kulturvollen Umgebung, die sich so auffällig von dem Verfallscharme der Rattenburg und dem grobschlächtigen Benehmen seiner Gefährten abhebt.
Max erfreut sich auch einer herzerwärmenden und ein wenig prickelnden Aufmerksamkeit seitens der zwölfjährigen blonden Tochter der Witwe, Germaine, der er mit Charme und Ritterlichkeit zu begegnen versucht. Das bringt ihm seitens Madame Lacombes einen schelmisch drohenden Finger und die Warnung ein: „Monsieur, ne me faites-pas de souci!“, wobei erotische Absichten von Max weiter entfernt sind als der Mond, und die Witwe ist mehr als doppelt so alt wie Max, gehört für ihn also eigentlich in ein vergangenes Jahrhundert.
*
Die Schießschicht hat ihre eigene Ordnung. Der Hauer der Schießschicht ist der King der Truppe. Bohren vor Granit und Quarz ist eine der härtesten Arbeiten, die es gibt. Vor Quarz müssen die Bohrkronen alle zehn Minuten ausgewechselt werden. Die Schicht beginnt zehn Uhr abends und dauert, wenn es schlimm kommt, bis sechs Uhr früh. So lange dauert sie selten, denn das Schichtgestein ist weicher Dreck, nur durchzogen von Quarzadern, die wieder Antimonoxyd mit sich führen. Den Tag über hat man dann frei für Schlaf, Spaziergänge oder Arbeiten, die Geld bringen.
Der Steiger hat angezeichnet, wo und wie gebohrt und geschossen wird. Der Hauer bestimmt Anzahl, Lage und Tiefe der Bohrlöcher, acht bis zwölf, sechzig bis einhundert-zwanzig Zentimeter tief. Der Kumpel karrt Bohrhammer, Preßluftschläuche und Gezähe, Dynamit, Zündschnur und Sprengkapseln heran.
Preßluft erzeugt ein zentraler Kompressor, von dem aus die Schläuche bis in den Vortrieb gezerrt werden. Gebohrt wird mit einem Sechzehn-Kilo-Eisenklotz, einem Preßlufthammer. Wenn ihm die Preßluft Leben einbläst, wird aus dem Klotz ein brüllendes Raubtier, das sich mit langen Stahlzähnen in die Eingeweide des Berges frißt. Er speit ätzende Staubwolken, denn es gibt keine Wasserspülung, und will den klammernden Händen entspringen. Auch künstliche Belüftung kennt die Mine nicht. Gegen den Staub bindet man sich einen feuchten Schwamm vor Mund und Nase. Der rutscht dauernd herab und wird deshalb weggelassen, und die Lungen saugen mühsam Sauerstoff aus den Staubwolken. Der Staub verklebt mit Schweiß und bildet eine schmierige graue Schicht auf der Haut.
Max’ Kumpel Willi wird ein paar Jahre nach seiner Heimkehr, noch nicht vierzigjährig, an seiner Staublunge sterben.
Zwölf Löcher sind gebohrt, Heinz Frömmich stellt den Hammer ab. Das Knattern des Kompressors schlurrt noch schwach durch den Stollen und wirkt in der plötzlichen Stille überlaut. Max wirft die Stützgabel beiseite, und Frömmich klinkt den Bohrstahl aus und betrachtet die Bohrkrone. Sie ist plattgeschlagen. „Weich wie ’n Käse! Wir härten die näch-sten selber. Gib das Dynamit rüber.“ Max reicht ihm die gummiartigen gelben Stangen. Frömmich stopft mit einem Stock zunächst drei von ihnen in jedes Loch. Dann verlangt er: „Knallzündschnur und Sprengkapseln!“ Er schneidet die Zündschnüre auf verschiedene Längen, damit die Kern-ladung als erste zündet, die Randladungen eine Sekunde später. So schafft der zuerst herausgesprengte Kern Platz für das seitlich herausbrechende Erz. Vorsichtig schiebt Frömmich die Sprengkapseln auf die Enden der Zündschnüre. Die drückt er dann in eine vierte Stange Dynamit für jedes Loch und schiebt sie vorsichtig hinein. „Kannst du verdäm-men“, weist er Max an. Der mischt aus Abwasserschlamm und Gesteinsstaub eine Art Mörtel, den er in die Bohrlöcher drückt und sie so verklebt.
Frömmich verbindet inzwischen die Knallzündschnüre, die das Zündfeuer schlagartig weitergeben, mit einer zwei Meter langen, langsam brennenden Zündschnur, die er im Stollen auslegt. Max wirft das Werkzeug in den Hunt und schiebt ihn bis zum nächsten Querstollen.
Frömmich begutachtet die Löcher, prüft nochmals die Verbindung der Zündschnüre, schaut sich um, ob etwas liegengeblieben ist, und sagt dann zu Max: „Warte am Querstollen, falls meine Lampe ausgeht.“ Dann entzündet er die Schnur mit der Grubenlampe. Sie sprüht auf und der Funke beginnt, sich durch die Schnur zu fressen.
Frömmich hastet bis zum Querstollen und zieht Max tiefer hinein. Beide hocken sich hin, öffnen den Mund und stecken sich die Finger in die Ohren. Der Luftdruck der Explosion kommt Sekundenbruchteile vor dem Donner und läßt ihre Kleidung flattern.
Sie sind wider Willen zusammengezuckt, jetzt grinsen sie sich an.
Eine dicke Qualmwolke wälzt sich durch den Stollen und hüllt sie ein. Max muß husten. Zum Glück zieht ein schwaches Wetter aus dem Quertrieb in Richtung Hauptstollen und nimmt den Qualm langsam mit.
Sie warten drei, vier Minuten, der Qualm lichtet sich. Sie gehen vorsichtig zur Schießstelle, im schwindenden Qualm Verbau und Stollen musternd. Der ist jetzt einen guten Meter länger. Abraum und Erz sind in einem fast sauberen Rechteck herausgebrochen und bilden einen großen Hau-fen. Frömmich ist zufrieden: „Da kann die Frühschicht mindestens zehn, vielleicht sogar zwölf Waggons raushauen. Schmelzer soll nicht mit Ausreden kommen!“ Er kramt eine in ein Taschentuch gewickelte Uhr aus der Jackentasche: „Halb zwei. Nicht schlecht. Denn mal los! Sind wir Viertel nach zwei zu Hause.“ Max holt den Waggon heran, sie werfen das Werkzeug hinein und machen sich auf den Weg.
Mit größerer Bewegungsfreiheit, den alltäglichen Begegnun-gen und dem „Guten Tag!“ und „Guten Abend!“ entwickeln sich engere Beziehungen zu den Dorfbewohnern. Die Ge-fangenen werden mehr und mehr heimisch, sie werden mehr und mehr akzeptiert, in dem Maße, wie sie sich als hilfswillig, fleißig und geschickt erweisen. Man kennt die meisten Ge-sichter und ist oft selbst bekannter, als man das weiß. Man grüßt die junge, hübsche Frau des Ingenieurs und Frau Mauser, sagt zu dem Obersteiger Gomez und zum Zimmermann García „Salut!“, tauscht ein Lächeln und ein paar unbeholfene Worte mit der Witwe Lacombe oder ihrer Tochter Germaine, wenn man in dem kleinen Kramladen eine Nähnadel, eine Rolle Garn oder ein paar Schnürsenkel kaufen will. Natürlich wird, entsprechend der gesellschaftlichen Ordnung des Dorfes, Monsieur le Curé besonders aufmerksam gegrüßt, auch wenn man sich daraus keinen unmittelbaren Nutzen verspricht. Der Priester ist schließlich – nach der Jungfrau Maria – der Mittelsmann zum Lieben Gott. So wird der unmittelbare Nachbar der Gefangenen, der Schweinehändler Cauchon, auch seinem Renommee entsprechend, geschnitten, weil er ein Geizhals und Meckerer ist und die Gefangenen durch immer neue Beschwerden über ihr Benehmen, ihren Gesang, ihr Lachen, ihre Rücksichtslosigkeit und überhaupt ihre Anwesenheit nervt. Aber damit er sich nicht ganz grundlos ereifert, werfen sie ihm gelegentlich ein paar ausgelutschte Feigenschalen, eine Kippe oder eine leere Flasche auf seinen Hof. Er scheucht dann seine verschreckte Frau, den Unrat zu beseitigen, und stellt die leere Flasche in den Keller, um sie bei der nächsten Kelter zu verwenden.
Allgemein betrachtet, erkennen die Dorfbewohner in den Gefangenen Menschen, die sich nicht wesentlich von ihnen selbst unterscheiden. Unterschwellig aber verstehen sie sie auch als eine Art Heloten, die arbeitswillig und billig sind und deren Fähigkeiten und Fertigkeiten man sich zunutze machen muß. Mehr persönliche, engere und intimere Beziehungen, die hier und da wohl entstehen, bleiben unter der Decke.
Die Männer übernehmen also in ihrer Freizeit mehr und mehr Arbeiten für die Leute im Dorf. Die häufigsten Tätigkeiten sind Holz zerkleinern, Gärten roden und um-graben oder Transporte aller Art. Zunächst werden solche Leistungen mit Lebensmitteln bezahlt, einem Abend-brot beim Auftraggeber, einem Brot, einer Flasche Wein oder Raki, ein selbstgebrannter Treberschnaps, oder auch Zigaretten. Mit fortschreitender Zeit und für handwerklich schwierige oder besonders schwere Arbeiten gibt es auch Geld. ‚Richtiges‘ Geld, kein ‚Lagergeld‘. Der zunehmende Bedarf an billigen Arbeitskräften steigert den Lohn mit der Zeit.
Da kann es denn passieren, daß Max und Bodo, die eine Fuhre Möbel verladen haben, sich weigern, auch abzuladen, wenn sie nicht jeder pro Stunde zwanzig oder auch dreißig Francs bekommen. Der Wirt des Bistros, um den es sich in diesem Fall handelt, rückt zähneknirschend das Geld heraus, weil er für reguläre Arbeitskräfte das Drei- oder Vierfache bezahlen müßte, und beeilt sich beim nächsten Mal, das Entgelt vor Beginn der Arbeit genauer auszuhandeln.
Es sei daran erinnert, daß die Gefangenen für die schwere Arbeit in der Mine täglich ganze fünf Francs bar bekommen, in Lagergeld, und weitere fünf Francs auf ein Konto. Der Gegenwert für fünf Francs ist eine Gauloise – eine einzelne Zigarette, nicht etwa eine Schachtel! – oder ein Viertelliter Wein.
Die Männer beweisen aber durchaus Sinn für soziale Gerechtigkeit. Sie machen die Preise nach dem Auftraggeber. Während die immer freundliche Witwe Lacombe mit ihrer netten Tochter Germaine für das Aufräumen des Schuppens vielleicht zehn Francs für die Stunde bezahlt, vielleicht sogar nur ein kräftiges Abendessen, muß der dicke Wirt des Bistros dafür die dreißig Francs berappen. Manche Persönlichkeiten unterliegen unterschiedlichen Bewertungen. Im Pfarrer zum Beispiel sehen die einen einen heiligen Mann, der nicht gerupft werden darf, während andere in ihm ein Mitglied der Oberschicht sehen, das es sich leisten kann, einen armen Gefangenen großzügig zu entlohnen.
Max hält sich in diesem Fall mehr in der Mitte. Die hilfreiche Tat steht allerdings unter einem bösen Stern. Als er gemeinsam mit Bodo Schmude für Monsieur le Curé Holz zerkleinert, springt die Säge aus dem Schnitt und reißt ihm häßlich die Finger auf. Er weiß nicht recht, ob er das als Strafe für seinen Mangel an Devotion sehen soll. Jedenfalls eilt der Pfarrer mit ihm zum unweit wohnenden Arzt, der die Finger mit Wasserstoffsuperoxyd reinigt und verbindet. Die Arbeit ist zwar für dieses Mal beendet, aber Monsieur le Curé lädt seine Holzarbeiter dennoch zum Abendessen an seinen Tisch.
Es gibt auch Arbeiten, die Spaß machen. Als der Frühling schon zu riechen ist, kommt eine Anfrage aus dem Bistro de la Montagne nach zwei Hilfskellnern für ein Festessen. Bei allem Interesse an einem zusätzlichen Verdienst gibt es tiefsitzende Vorbehalte dagegen, sich zum Helfer und Helfershelfer, ‚Diener oder Sklaven‘, zum ‚Kollaborateur‘ der Franzosen zu machen. Wegen solcher Vorbehalte lehnen manche Arbeiten ab, die eine zu große Nähe zum Arbeitgeber verlangen. Auch gegen das Kellnern gibt es solche Vorurteile.
Als sich Frieda Külow um Aufmerksamkeit bemüht, herrscht in der Guten Stube ein buntes Treiben: „Hört mal her!“ Aber Emil und Skroszny streiten sich weiter darum, ob der Roßschlächter in Pillkallen Slavomir oder Lubomil geheißen hat. Balke, Breitenbach und Schmelzer dreschen Skat. Frömmich hämmert an einem Fünffrancsstück herum, aus dem er einen Siegelring machen will. Frieda muß lauter werden, so daß seine Stimme in den Diskant rutscht: „Ruhe im Puff! Alle mal herhören!“ Der Lärm verebbt. „Es gibt was zu verdienen. Der Wirt vom Bistro braucht Ostersonnabend zwei Hilfskellner für eine größere Feier, Verlobung oder so was. Zehn Francs die Stunde und satt zu essen! Wer hat Lust?“
Balke winkt ab: „Kellnern? Mich rumkommandieren lassen? Ich bin doch nicht deren Fußabtreter!“
Frieda wundert sich: „Na hör mal! Kellnern ist doch ein ehrenwerter Beruf.“
Schmelzer dagegen hat schon ganz gierige Augen: „Ich mach’ das gerne! Kann man sich doch mal den Wanst vollschlagen!“ Schmelzer ist ein Apotheker aus Konstanz. Er ist um die Fünfzig, ein hagerer Mann, aber immer hungrig. Nur die aus seinem Vollbart gierig hervorglänzenden Lippen könnten ein Hinweis sein. Er leidet echt unter der mageren Lagerkost. Im Umgang ist er mitteilsam, zudringlich und geschwätzig und bei akademischer Bildung besserwisserisch.
Frömmich bremst ihn ab: „Du Freßsack! Wenn wir dich da hinschicken, versaust du uns das ganze Renommee!“
Schmelzer will aufbegehren: „Erlaube mal!“
„Halt dein’ Mund!“ fährt ihm Frömmich in die Parade. „Das mit dem Kellnern ist so ’ne Sache. Es gibt schmierige, arrogante, pomadige, raffgierige, verfressene, aber auch eifrige und bemühte Kellner. Und deshalb ist das hier so was wie ein öffentlicher Auftritt ‚der Gefangenen‘. Wir müssen gut überlegen, wer da hingeht.“
Schmelzer verteidigt sich wütend: „Ich lass’ mir doch von dir nicht vorschreiben, ob ich da hingehen darf!“
Frieda versucht zu vermitteln: „Die Anfrage ist aber nicht an dich ergangen! Heinz hat recht. Die Kellner sind sozusagen unsere Repräsentanten. Sie müssen anständig aussehen, sie müssen sich anständig benehmen und sie müssen ein bißchen flott bei der Arbeit sein.“
Sigi stänkert: „Nu brich dir mal keine Verzierung ab! Wir werden uns für die Franzosen doch nicht den Arsch aufreißen.“
Frieda: „Du bist sowieso nicht gefragt! Ich schlage vor, daß wir die beiden Jungen schicken. Max und Bodo, seid ihr einverstanden?“
„Na klar!“
„Aber immer.“
Frieda: „Was zieht ihr an?“
Max: „Meine Khakihose und meinen Kolani.“
Zu Bodo: „Und du?“
„Hm ..., ja ...“ Bodo schaut ein bißchen hilflos an sich herunter. „Meine Amibluse ..., wenn die frisch gewaschen ist, sieht sie prima aus! Und die Hosen.“ Er deutet auf seine Gummistiefel: „Aber andere Schuhe habe ich nicht.“
„Machste die Hose über die Stiefel. Und ihr benehmt euch anständig!“
„Sonst kriegt ihr was hinter die Ohren!“ ergänzt Skroszny die ,Dienstanweisung‘.
Max nimmt sich vor, auf Bodo aufzupassen.
Damit ist die Diskussion erledigt, und Schmelzer drückt sich wieder in seine Ecke.
Der Auftrag wird ohne den üblichen Neid den beiden Jungen zugesprochen, weil sie nicht von dem engstirnigen Nationalstolz der ‚Erwachsenen‘ befallen sind.
*
Zum Fest im Bistro de la Montagne erscheinen etwa dreißig Personen zwischen sechs und achtzig Jahren. Sie sind festlich gekleidet. Die Männer tragen einen Schlips um den zu engen Kragen und eine Jacke, die sie so bald wie möglich ausziehen. Die Knaben haben lange Hosen an. Die Frauen sind in Seidenkleider mit und ohne Rüschen gewickelt, die über allen, meist kräftig ausgeprägten, Rundungen spannen. Die kleinen Mädchen tragen Puppenkleider. Wie ein schwarzer Rabe hockt Monsieur le Curé in seiner Soutane zwischen den bunten Vögeln.
Das Fest ist ein Essen mit vielen Gängen und Pausen, in denen man raucht und tanzt, und mit noch mehr Getränken. Für Stimmung sorgen die Musettewalzer eines Akkordeonspielers, mit vielen Trillern, Triolen und Kaprio-len. Keiner hört hin, doch der Rhythmus der Musik vereint alle in einer angeregten, stimmungsträchtigen Heiterkeit. Mancher behält bei Tisch seine Baskenmütze auf, mancher schiebt im Mund mit dem Messer nach, es kann auch sein, daß jemand seine Zigarre sorgfältig an den Tellerrand legt, um zwischendurch einen Happen zu essen. An der Tafel wird nichts übelgenommen, es geht üppig, laut und fröhlich zu.
Max allerdings findet die Tischsitten korrekturbedürftig. Auch er und Bodo Schmude sind gewaschen und gebügelt. Schließlich gibt es im Camp ein altes Holzkohle-Bügeleisen unter Tünnes’ Aufsicht, das stark benutzt wird. Man betreibt es freilich nicht mit Holzkohle, sondern stellt es einfach auf die heiße Herdplatte. Bodo trägt ein sauberes Khakihemd zu den gebügelten Hosen, die in die Gummistiefel gestopft sind. Bei ihrer Altersbuntheit fällt ein sorgfältig auf den Hintern gesetzter Flicken kaum auf. Max hat seine Amihose an und einen blauen Kolani, das knapp sitzende Oberbekleidungs-stück der Matrosen, allerdings ohne das eigentlich vorge-schriebene, aber schwer zu knüpfende schwarze Halstuch mit dem koketten weißen Schleifchen.
Sie pendeln mit Speisen, Getränken und leerem Geschirr zwischen der Küche und der Festtafel hin und her. Anfangs ist Max sein kaum die Glatze tarnender Stoppelhaarschnitt peinlich, aber da das niemand anderen stört und niemand darüber Bemerkungen macht, vergißt er ihn bald.
Wenn zufällig nichts aufzutragen oder abzuräumen ist, lehnen die beiden am Durchgang zur Küche, wo auf einem Tischchen für sie zwei Gläser Rotwein stehen. Bodo schaut sich um, ob er beobachtet wird, und zieht ein in eine Serviette gewickeltes Hühnerbein aus der Tasche und beißt hinein. Obwohl vermutlich kaum jemand von der Gesellschaft etwas dagegen hätte, ist das dem pingeligen Max peinlich: „Mußt du jetzt fressen? Wir kriegen doch nachher was!“
Schmude kaut ungerührt: „Was ich habe, das hab’ ich. Ich verstehe gar nicht, warum die andern das hier nicht machen wollten. Essen, trinken, flotte Weiber und Musik – und mal raus aus der Bude.“
Max ist nicht ganz so unbefangen: „Beim Arbeitsdienst und bei der Marine habe ich mich immer darum gedrückt, Ordonnanz oder Putzer zu spielen.“
Das versteht Schmude nicht: „Schön blöde! Das waren doch die Druckposten.“
Max ging es nie darum, sich zu drücken. Er wollte zwar nicht unbedingt den Heldentod sterben, aber gedrückt vor einem Einsatz hätte er sich nicht. Nur auf ein U-Boot wollte er nach Möglichkeit nicht gehen, auch nicht in einen Panzer. Der Gedanke, in so einem Blechsarg zu stecken, war ihm unheimlich und unerträglich. Dabei war es dann im Kesselraum des ‚Hans Lody‘ auch nicht gemütlicher. Bei Hochdruck-Heißdampf von einhundertzwanzig Atü und sechshundert Grad wäre er bei einer Havarie in Sekundenschnelle gedünstet worden.
„Ich mache nicht gerne den Fußabtreter für andere“, erklärt er Bodo. Der wechselt das Thema: „Hier kannste Studien machen, was?“ überlegt er. „Wie die essen, rumkrümeln, sich auf den Tisch fläzen – zwischendurch qualmen und schwofen.“ Max wundert sich, daß ausgerechnet Bodo Schmude die Tischsitten beklagt.
Der ist aber schon wieder bei seinem Lieblingsthema: „Würde mich nicht wundern, wenn sie zwischen zwei Gängen auch schnell mal ’ne Nummer schieben.“
„Du kannst wohl über nischt anderes als Thema eins reden, wie?“
Der Wirt unterbricht das Gespräch und ruft aus dem Küchendurchgang: „Garçons! Le prochain plat. Vite, vite!“
Bodo versteckt den Rest seines Hühnerbeins, und Max beeilt sich, in die Küche zu kommen: „Oui, monsieur le patron ...“ Bodo latscht mit „Immer mit der Ruhe“ pomadig hinterher.
In der Küche brodelt und brutzelt es. Der große Herd speit Glut, ein Dutzend großer und kleiner Töpfe drängen sich um die Feuerlöcher und blasen Dampf. Auf dem großen Tisch häufen sich Gemüse, Früchte und Fleisch, Speck, Öl und Kräuter. Zwei dralle Frauen putzen, schneiden zurecht, würzen, sieben, kneten und klappern mit Brettern, Messern und Deckeln.
Das Mädchen, das Max in der Kirche gesehen hat, ist dabei, Gemüse zu zerkleinern. Als er sie beim Hereinkommen anblickt, lächelt sie ihm zu, ohne die Arbeit zu unterbrechen. Er lächelt zurück, und eine warme Welle durchflutet sein Herz.
Der Wirt, ein dicker Mann mit Stirnglatze und durchtriebenem Blick, weist Max und Schmude die Schüsseln mit Coq au vin, die sie hineintragen sollen: „Ceux-ci! Et dépêchez-vous!“
Das Mädchen schaut Max nach, als er im Saal verschwindet, und als er sie beim Hereinkommen wieder anlächelt, hält sie für einen Augenblick mit der Arbeit inne, um zurückzulächeln. Der Patron hat den Blickwechsel bemerkt und schnauzt sie an: „Ne rêve-pas, Marie-Paule! Bouge-toi! Les clients attendent le prochain plat.“ Das Mädchen wendet sich schnell ab und trägt das zerkleinerte Gemüse zum Herd, wo es angebraten werden soll.
Marie-Paule heißt sie also.
Jetzt erst sieht Max, daß sie eine schiefe Schulter hat. Er wendet den Blick nicht von ihr ab, aber sein Lächeln ge-friert.
Körperliche Mißbildungen sind Max unangenehm. Er bemitleidet solche Menschen, aber er möchte sich nicht mit ihnen abgeben. Scheinbar notwendige Rücksichtnahmen bringen ihn in Verlegenheit, obwohl er begreift, daß Behinderte als vollwertige Menschen betrachtet werden und keine besondere Rücksichtnahme wollen, sofern ihre Behinderung sie nicht unbedingt erfordert.
Als sie sich wieder umwendet, dreht er rasch den Kopf weg, um ihren Augen nicht zu begegnen, und eilt mit der nächsten Schüssel zurück in den Saal. Später versucht er, sie unbemerkt zu betrachten, und sie weicht seinen Blicken aus und schaut unentwegt auf ihre Arbeit.
Ihre Erscheinung ist freundlich und lieblich, die Lippen sind voll und rot, die langen braunen Haare hat sie zu einer Schnecke hochgesteckt, die nackten Arme sind sanft gerundet und doch kräftig. Ihre schiefe Schulter beeinträchtigt ihre Bewegungen nicht und erscheint ihm zunehmend unwe-sentlich. Ein kleiner Schönheitsfehler. Dafür bemerkt er unter ihrer zu großen Küchenschürze eine schlanke, flinke Gestalt mit ausgeprägten weiblichen Rundungen.
Seine Gefühle sind aufgestört, wirr und widersprüchlich, seine Gedanken wandern ab, zu anderen Mädchen, die er irgendwann einmal betrachtet hat. Doch die Vergleiche mißlingen. Marie-Paule beherrscht seine Vorstellungen.
*
Spät geht Max noch ein paar Schritte durchs Dorf, um seine Gefühle und Gedanken, die durcheinanderpurzeln, zu sortieren: Ein hübsches, freundliches Mädchen, das ihn offenbar mag – ein kleiner Haltungsfehler, der den Kameraden Anlaß zum Spotten sein wird –, aber sie mag ihn und er fühlt sich angezogen von ihr – was wird der Dorf-tratsch dazu sagen?
Die Luft ist nach einem warmen Tag frisch geworden. Sie bewahrt noch die Düfte des nahen Frühlings. Der Himmel ist sternenklar. Man möchte zu ihnen emporschweben.
Zwei große Erlebnisse beschäftigen Max: Erstens, daß es gemeinsam gelingen kann, wenn man sich einig ist, wesentliche Interessen durchzusetzen, also handelndes Subjekt, nicht nur Objekt der Ereignisse zu sein, und als Zweites, daß die Zuneigung zu einem Mädchen ein ganz persönliches, verwirrendes, widersprüchliches Erlebnis sein kann.
So in Gedanken ist Max durch das Dunkel des Ortes geschlendert. Jetzt bleibt er stehen, um festzustellen, wo er ist. Er überlegt, ob er noch zum Kirchberg hinaufgehen und einen Blick auf das schlafende Dorf werfen soll, als er eine kleine Gestalt bemerkt, die von der Straße her, etwa vom Bistro auf ihn zukommt. Er ahnt mehr als er erkennt, daß es Marie-Paule ist. Sein Herz schlägt plötzlich heftig. Er hat den Wunsch, sie möge ihn ansprechen, andererseits fürchtete er sich davor, ihr im Dunkeln entgegenzutreten. Die Situation erscheint ihm zu intim. Die Dunkelheit würde sie beide in einen gemeinsamen Mantel hüllen, und Max fürchtet diese Nähe, obwohl er sie sich sehr wünscht. Er weiß nicht, ob er dem Wunsch widerstehen kann, sie in die Arme zu schließen, und er scheut ihre Reaktion, gleich ob sie ihn zurückweist oder auch ihrerseits umarmt. Er wendet sich zur Seite und tritt ins Gebüsch des Seitenwegs, wo er sich still verhält in der Hoffnung, daß sie das nicht bemerkt habe.
Marie-Paule kommt vorbei und verlangsamt den Schritt, dann aber geht sie doch weiter geradeaus.
Max ist zugleich erleichtert und enttäuscht. Er schilt sich einen Idioten, weil er dem harmlosen Verlangen nicht nachgegeben hat, sie zu begrüßen.
Mitten im März, die Mandel- und Maulbeerbäume blühen und die Sonne wärmt, fällt unerwartet Schnee. Er ist naß und schwer. Mit dicken Flocken legt er sich über Wege, Dächer, Bäume und Sträucher. Er klebt auf den Zweigen und zwingt sie hinab zur Erde. Was sich nicht biegen läßt, zerbricht er. Die Telefonleitungen werden unter seiner Last zu armdicken Tauen. Die Drähte ächzen, aber sie reißen nicht. Die Masten müssen die Leitungen von Hang zu Hang über das Tal hinweg tragen und sind der Last nicht gewachsen. Sie werden vom Schnee krummgezogen und neigen sich zur Erde wie Grashalme. Der Winter neidet dem Frühling seinen Auftritt.
Die Alten sagen, einen solchen Schnee hat es seit dreißig Jahren nicht gegeben. Die Menschen müssen durch dicke nasse Watte stapfen, und ohne Gummistiefel bekommen sie nasse Füße. Von den Gefangenen haben nur Skroszny und Schmude Gummistiefel. Schmudes haben Löcher.
Der Schnee hat die Luft abgekühlt, und morgens haben die Männer Reif auf der Bettdecke. Der Schnee macht es schwierig, Koks von der Halde aufzulesen. Abends heizen sie wieder mit Grubenkoks.
Zum Glück hält sich der Schnee nicht lange, nach zwei Tagen ist er verschwunden. Wo das Wasser schlecht abfließt, pampt der Lehmboden eine Woche lang knöcheltief. Der Bach schwillt zu einem reißenden, lehmbraunen Flüßchen an, in dem man keine Wäsche mehr waschen kann. Doch das Frühjahr kommt unaufhaltsam.(PK)
Lesen Sie die Fortsetzung des biografischen Romans in der kommenden Ausgabe, oder - bequemer - bestellen Sie das Buch bei edition winterwork
Online-Flyer Nr. 306 vom 15.06.2011
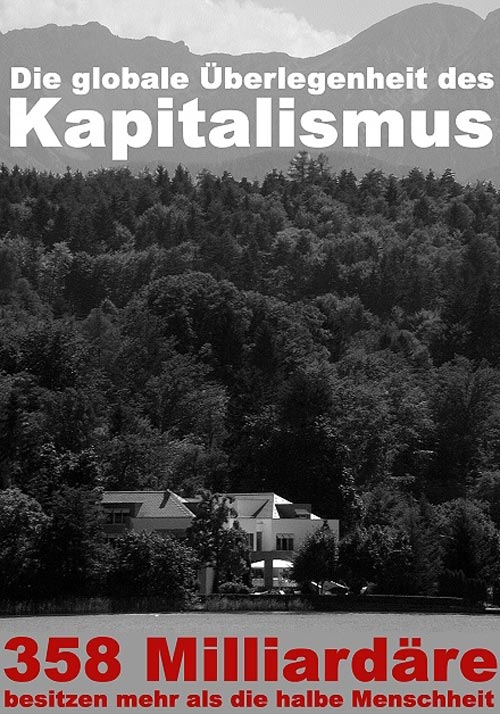

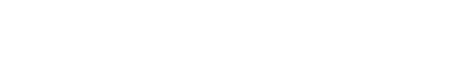













 Max, Jahrgang 1927, 16jähriger Luftwaffenhelfer, später Kadett der Kriegsmarine auf dem Zerstörer „Hans Lody“, schildert seine Erlebnisse während des Krieges und in französischer Kriegsgefangenschaft. Seine Erinnerungen kreisen um die Arbeit im Bergwerk, um die erste Liebe zu der Französin Marie-Paule, die vergeblichen Fluchten und die endliche Heimkehr in das besetzte Deutschland. Reflexionen über die Sinnlosigkeit und Grausamkeit des Krieges haben angesichts weltweiter kriegerischer Aktivitäten nichts von ihrer Aktualität verloren.
Max, Jahrgang 1927, 16jähriger Luftwaffenhelfer, später Kadett der Kriegsmarine auf dem Zerstörer „Hans Lody“, schildert seine Erlebnisse während des Krieges und in französischer Kriegsgefangenschaft. Seine Erinnerungen kreisen um die Arbeit im Bergwerk, um die erste Liebe zu der Französin Marie-Paule, die vergeblichen Fluchten und die endliche Heimkehr in das besetzte Deutschland. Reflexionen über die Sinnlosigkeit und Grausamkeit des Krieges haben angesichts weltweiter kriegerischer Aktivitäten nichts von ihrer Aktualität verloren.