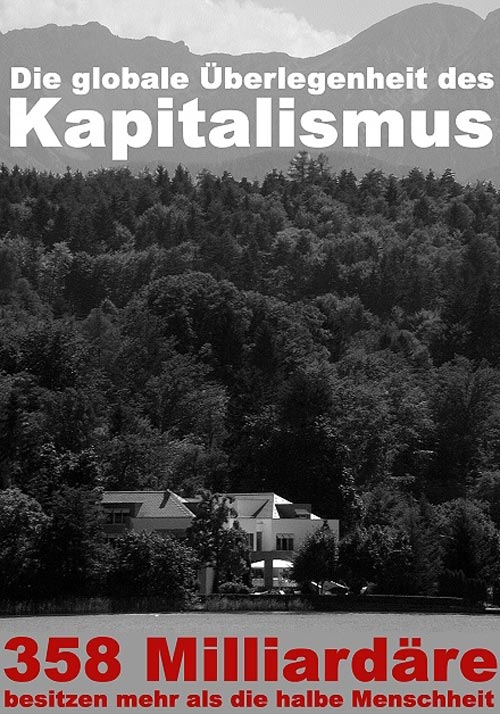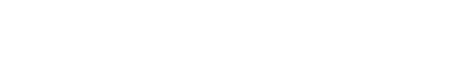SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Inland
Aufgewachsen in Ostfriesland
Eine Rückbesinnung*
Von Wolfgang Bittner
In das Siedlungshaus waren wir Anfang 1946 vom Flüchtlingsamt gegen den Willen der Besitzer einquartiert worden, eine behelfsmäßige Unterkunft. Schon als Fünfjähriger konnte ich vom Fenster aus hinter den Wiesen und Feldern den Wald sehen: Eine dunkle Wand am Horizont, eher indigo-blau als grün, sehnsuchtserzeugend. Außerdem sah man das Barackenlager, das ganz in der Nähe lag, ein Biotop sozusagen für die merkwürdigsten Vögel. Das Lazarett war inzwischen aufgelöst worden, und neben den vielen Flüchtlingen und Heimatvertriebenen lebten dort auch Menschen, die mit ihrer Situation im Schatten einer sich neu formierenden Gesellschaft nicht zurechtkamen.
Eine schwere Zeit. Die Einwohnerzahl von Wittmund, wohin es uns durch Zufall verschlug, hatte sich nach dem Krieg durch den Zustrom aus den Ostgebieten um fast zweitausend Menschen erhöht. Daraus ergaben sich natürlich Probleme, denn abgesehen von den Belastungen für die einheimische Bevölkerung, sind Fremde, noch dazu in diesem Ausmaß, nirgendwo gern gesehen. Und die Streitigkeiten der Erwachsenen fanden ihre Fortsetzung unter den Kindern und Jugendlichen, die nicht selten mit Steinen und Knüppeln aufeinander losgingen.
Schlägereien waren an der Tagesordnung. Es wurden Banden gebildet, die sich bekämpften. Am Stadtrand fanden regelrechte Schlachten zwischen den Kindern der Einheimischen und denen der Flüchtlinge statt. Zeitweise war es schwierig, zur Schule zu gelangen, ohne verprügelt zu werden. Im Sommer angelten und badeten wir im Fluss vor der Stadt und lernten ganz nebenbei schwimmen. Wir tauchten nach weggeworfenen Waffen, mit denen wir Krieg spielten, wie es uns vorgemacht worden war.
Als die Situation in der Siedlung, in der überwiegend ehemalige SA-Leute wohnten, für uns wie für die Wirtsleute unerträglich wurde, zogen wir in das Lager um, wo wir in einer der Baracken drei Zimmer erhielten. Manchmal kamen andere Heimatvertriebene vorbei, und die Männer erzählten sich ihre Kriegserlebnisse, die zumeist glorifiziert wurden, oder man sprach wehmütig von »Zuhause«, das war die verlorene Heimat im Osten, in die man irgendwann zurückkehren würde. Die meisten empfanden das Kriegsende als eine furchtbare Niederlage, unverdient, denn man hatte ja sein Letztes gegeben, um zu siegen. Über die Gräuel, die man selber erfahren oder anderen angetan hatte, wurde nicht gesprochen, selten über Hitler und die nationalsozialistische Ideologie.
Nach und nach beruhigte sich die Situation, niemand musste mehr verhungern oder erfrieren. Vielen der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen wurde klar, dass die deutschen Ostgebiete für lange Zeit, wenn nicht für immer, verloren waren. Sie gingen in die Großstädte und ins Ruhrgebiet, wo es Arbeit gab; manche gründeten Firmen oder heirateten in einheimische Familien ein. Hinzu kam, dass die ansässige Bevölkerung merkte, wie sehr sie durch den Zustrom der Fremden, die essen, wohnen und sich kleiden mussten, profitierte. Der Krieg wurde Vergangenheit, man begann wieder in die Zukunft zu schauen.
Mein Vater besorgte ein altes Radio, und während ich nach der Schule und dem Mittagessen meine Hausaufgaben machte, hörte ich die spannenden wie informativen Sendungen im Schulfunk. So erfuhr ich schon früh, wer Albert Einstein war, wie Kolumbus Amerika entdeckte oder welche Aufgaben ein Parlament wahrnimmt. Noch heute habe ich die Erkennungsmelodie aus der »Zauberflöte« von Mozart oder die etwas kratzige Stimme des Tierfreundes im Ohr, der kurzweilig über Zaunkönig, Blindschleiche oder Hamster plauderte. Jeden Tag hörten wir die Nachrichten, abends manchmal Hörspiele. Fernsehen gab es noch nicht, so dass viel Zeit blieb.
Sobald ich flüssig las, verschlang ich alles, was ich an Lesbarem kriegen konnte. Das waren zunächst überwiegend so genannte Groschenhefte, die wir in der Schule tauschten und unter der Bank lasen. Ich erinnere mich an Western wie Billy Jenkins, Tom Prox und Pete, an Landser-Romane und an Comics wie Tarzan, Akim und Prinz Eisenherz. Manchmal bekam ich durch Zufall anderes in die Hand, zum Beispiel Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert: »Die Küchenuhr« und »Nachts schlafen die Ratten doch«.
Auf dem Marktplatz hielt einmal in der Woche ein Bücherbus der Amerikaner, eine verhältnismäßig gut ausgestattete fahrende Bibliothek. Offenbar beabsichtigte man mit dieser Einrichtung den Demokratisierungsprozess im Nachkriegsdeutschland, das immer noch mit den Hinterlassenschaften der Nazizeit rang, zu befördern - aus heutiger Sicht und im Hinblick auf die Ergebnisse der PISA-Studie eine bemerkenswerte Kulturinitiative.
Mir erschien das damals wie ein Geschenk. Ich lieh mir Jack Londons »Wolfsblut« aus, Coopers Lederstrumpf-Geschichten, »Robinson Crusoe« von Daniel Defoe, »Die Schatzinsel« von Robert Louis Stevenson, Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer von Mark Twain sowie sämtliche Hornblower-Romane über Seeabenteuer von Cecil S. Forester. Es gab auch Bildbände über Neumexiko, Alaska und Kanada, die meine Phantasie beflügelten und die Sehnsucht nach den fernen Ländern weckten. Samenkörner, die später aufgingen, als ich Mexiko, Alaska und Kanada bereiste.
Allmählich öffnete sich der Horizont, und die Gespenster der Vergangenheit vermochten mich nicht mehr zu ängstigen. Manchmal tauchte ich tagelang ab in die Welt meiner Romanfiguren, die mir viel zu sagen hatten. Die Bücher halfen mir über die rauhe Realität mit ihren Problemen, Demütigungen und Kümmernissen hinweg. Wenn mich jemand beschimpfte, konnte ich mich mit David Copperfield trösten, dessen traurige Kindheit mir Charles Dickens vor Augen führte. Oder ich versetzte mich in die Rote Zora, die sich mit ihrer Bande elternloser Kinder an der Küste Dalmatiens Respekt verschaffte.
Als der Bücherbus nicht mehr kam, fanden sich andere Gelegenheiten. In der Stadt gab es einen Friseur, der eine Lotterie-Annahmestelle hatte. Gelegentlich musste ich dort den Toto-Schein meiner Eltern abgeben, die auf den großen Gewinn hofften, der ihnen ein besseres Leben ermöglichen würde. Bei diesem Friseur stand ein Regal mit zahlreichen Büchern, die man für ein paar Pfennige ausleihen konnte: Triviale Unterhaltungsliteratur, hin und wieder etwas Gutes, beispielsweise die Romane »Die Regulatoren in Arkansas« und »Die Flusspiraten des Mississippi« von Friedrich Gerstäcker.
Auch in der Schule bemühte man sich damals um Leseförderung. Es gab zwar keine Bibliothek, aber die Klassenlehrerin verfügte über eine Bücherkiste, die einmal wöchentlich geöffnet wurde. Jetzt ging ich mit Kapitän Ahab auf die Jagd nach dem weißen Wal, litt und triumphierte mit dem Grafen von Monte-Christo, besuchte Onkel Tom in seiner Hütte in Kentucky, tauchte mit Kapitän Nemo 20.000 Meilen tief ins Meer und ritt als Kurier des Zaren durch Russland. In den Ferien arbeitete ich in einer Wäscherei und beim Bauern auf dem Feld, um mir das Geld für ein Fahrrad zu verdienen.
Eines Tages gab mir die Lehrerin ein ungewöhnlich dickes Buch mit dem Titel »Die Ahnen«, das ich widerwillig mit nach Hause nahm, dann jedoch in wenigen Tagen durchlas. Es handelte vom Schicksal einer Familie von der Germanenzeit bis zur Neuzeit. Das fand ich spannend, ebenso den Roman »Soll und Haben«, in dem derselbe Autor, Gustav Freytag, von den Irrwegen und der schließlichen Läuterung eines jungen Breslauer Kaufmanns erzählt.
Inzwischen war das Lager nahezu aufgelöst. Zurückgeblieben waren ein paar Familien und einige Einzelgänger, die den Absprung in die neue Zeit des beginnenden Wirtschaftswunders nicht geschafft hatten, sowie einige so genannte Asoziale. Meine Eltern, die mit der »Niedersächsischen Heimstätte« ein Haus bauen wollten, nachdem mein Vater bei einer Behörde Arbeit gefunden hatte, blieben ebenfalls bis das Haus fertig war. Ein seltsam buntes Leben.
Nebenan wohnte Albert Hoffmann, ein ehemaliger Mühlenbesitzer, mit seiner Frau, die durch aparte Hüte in der kleinbürgerlichen Umgebung auffiel und sichtlich unter ihrem sozialen Abstieg litt. Ein paar Baracken weiter hauste der etwas unheimliche Adolf Beier, der KZ-Wärter gewesen war, wie gemunkelt wurde, und trotz seines Rheumas gegen geringes Entgelt Gartenarbeit verrichtete. Die kinderreiche Familie Kasunke machte dadurch von sich reden, dass gelegentlich Hausdurchsuchungen stattfanden, der älteste Sohn mit einer Beinprothese aus der Fremdenlegion zurückkehrte und Herr Kasunke für einige Zeit ins Gefängnis wanderte. Ein ehemaliger Fliegermajor bot Nachhilfeunterricht in Mathematik an, Fräulein Zielinski erhielt häufig wechselnden Herrenbesuch, vor allem englischer Besatzungssoldaten, und beim Herrn Baron fanden geheimnisvolle Séancen statt. Dann gab es noch einen früheren Stabsarzt, der eine kleine, womöglich illegale Praxis betrieb, und einen zurückgebliebenen französischen Kriegsgefangenen, der mit einer hübschen blonden Krankenschwester zusammenlebte. Im Sommer kam der Zirkus auf den alten Appellplatz, der nun als Sportplatz genutzt wurde, und an der Landstraße kampierten Zigeuner.
Meine Eltern hatten einen Garten angelegt, in dem wir Kartoffeln, Bohnen, Erbsen, Gemüse und Kräuter anbauten und für den ich immer mehr zuständig wurde, denn meinem Vater machte noch seine Kriegsverletzung zu schaffen. Oft arbeitete ich während meiner gesamten freien Zeit in diesem Garten, dessen Erträge uns über die andauernde finanzielle Misere hinweghalfen. Geld war knapp, wir rechneten im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Pfennig. Dennoch erinnere ich mich an ausgelassene Feste im Kreise anderer Vertriebener und an sommerliche Ausflüge in die Fischerdörfer am nahe gelegenen Meer. Man versuchte sich einzurichten, so gut es ging.
Wenn ich nicht in der Schule war, im Garten arbeitete oder las, stromerte ich in den umliegenden Feldern und im Wald herum, beobachtete Tiere, baute mir Höhlen und sammelte im Sommer Beeren und Pilze. Ich freundete mich mit den beiden Söhnen des Försters an, die mir zeigten, wo sich die Kreuzottern sonnten und wo Pfifferlinge, Haselnüsse und Esskastanien wuchsen. Außerdem liehen sie mir ihre sämtlichen Karl-May-Bände. Zwischen den Betonbrocken eines gesprengten Schießstandes spielten wir Winnetou und Old Shatterhand, schossen mit dem Luftgewehr auf leere Konservendosen.
Der Förster und seine Frau betrieben nebenher eine kleine Landwirtschaft, und wenn die Söhne helfen mussten, schloss ich mich ihnen an. Das Heu war einzubringen, der Stall auszumisten, die Kühe waren zu melken, Kartoffeln und Rüben zu ernten. Zur Belohnung gab es manchmal eine Einladung zum Abendessen, das besonders reichhaltig ausfiel, wenn geschlachtet worden war. Außerdem erfuhr ich viel über die Natur, über die Jagd und die Hege. Ein großes Erlebnis war es, einen Hasen zu schießen, den ich sogar mit nach Hause nehmen durfte. Der Wald wurde mir so vertraut, dass ich Förster werden wollte.
Als ich vierzehn Jahre alt war, wurde im oberen Stockwerk der alten Volksschule eine Stadtbibliothek eingerichtet, deren eifriger und begeisterter Benutzer ich bald war. Auf meine Frage hin empfahl mir der Bibliothekar Hemingways Roman »Wem die Stunde schlägt«, den ich in wenigen Tagen verschlang. Es folgten »Vater Goriot« von Balzac, »Schuld und Sühne« von Dostojewski, »Die Buddenbrooks« von Thomas Mann, »Der Steppenwolf« von Hermann Hesse, Romane von Heinrich Böll, Anna Seghers, Max Frisch, Jean-Paul Sartre, Theodor Fontane, Franz Kafka und vielen anderen Autoren, die mich unterhielten, überraschten und faszinierten. Das war wieder eine neue Welt, die sich mir öffnete, eine Welt voller Einsichten, philosophischer Reflexionen und unendlicher Möglichkeiten. Jetzt beschloss ich, Schriftsteller zu werden.
Im Deutschunterricht lasen wir damals Goethe, Schiller, Kleist und Lessing, auch »Pole Poppenspäler« von Theodor Storm und von Annette von Droste-Hülshoff die Novelle »Die Judenbuche«, die ich ziemlich langweilig fand. Meistens ging ich gern zur Schule, war auch ein guter Schüler. Da es in der Stadt kein Gymnasium gab und für Schulgeld und Fahrtkosten ohnehin kein Geld übrig war, besuchte ich die Mittelschule. Dass einige Lehrer ehemalige Nazis waren, störte mich nicht und wurde mir erst viel später bewusst. Ich bemühte mich, nicht aufzufallen und ging im Übrigen meiner Wege. Das Abitur holte ich dann Mitte der sechziger Jahre in Abend- und Fernkursen neben der Arbeit nach.
Aber immer wieder Kränkungen und Erniedrigungen. Als wir im Unterricht einmal über den Krieg sprachen und ich von den Schrecken der Besetzung Oberschlesiens durch die Rote Armee berichten wollte, unterbrach mich die Lehrerin, eine Bauerntochter, mit den Worten: »Hier sind auch ein paar Bomben gefallen.« Und als mein Vater einmal in kleinem Kreis erwähnte, dass meine Gleiwitzer Großeltern vermögend waren, entgegnete ihm ein Einheimischer: »Jaja, ihr hattet doch alle fünfzig Hektar Luft hinterm Haus und Parkett im Wohnzimmer«, worauf meine Mutter in Tränen ausbrach. Das machte mich traurig und wütend zugleich.
Viel Unverständnis damals, häufig noch unterschwellige Feindseligkeit und Missgunst, viele Auseinandersetzungen. Die große Familie, die in Schlesien verwurzelt war, hatte sich in alle Winde verstreut, nicht wenige waren tot oder durch die Kriegsereignisse traumatisiert, so auch meine Eltern. Als meine Mutter mit mir in Ostfriesland ankam, war sie 26 Jahre alt, und erst heute kann ich ermessen, welches Heimweh sie manchmal quälte, und wie groß die Sehnsucht nach ihren Eltern gewesen sein muss. Wir lebten lange als Fremde am Rande des Existenzminimums. Erst nach Jahren begannen sich die Verhältnisse für uns halbwegs zu normalisieren, und es dauerte nochmals einige Jahre, bis ich begriff, dass wir unser Leben - jedenfalls in Friedenszeiten und bis zu einem gewissen Grad - selber einzurichten vermögen.
*Dem Beitrag liegt ein Vortrag von Wolfgang Bittner zugrunde, der am 29. Juli 65 Jahre alt wird und in Ostfriesland aufgewachsen ist. Eine Sammlung mit Essays und Vorträgen des Autors ist soeben unter dem Titel "Schreiben, Lesen, Reisen" im Athena-Verlag in Oberhausen erschienen, ISBN 3-89896-253-9, EUR 12,90.
Von Wolfgang Bittner ist auch der Roman "Niemandsland", dessen inzwischen sechstes Kapitel Sie in dieser Ausgabe lesen können.
Online-Flyer Nr. 54 vom 25.07.2006
Aufgewachsen in Ostfriesland
Eine Rückbesinnung*
Von Wolfgang Bittner
In das Siedlungshaus waren wir Anfang 1946 vom Flüchtlingsamt gegen den Willen der Besitzer einquartiert worden, eine behelfsmäßige Unterkunft. Schon als Fünfjähriger konnte ich vom Fenster aus hinter den Wiesen und Feldern den Wald sehen: Eine dunkle Wand am Horizont, eher indigo-blau als grün, sehnsuchtserzeugend. Außerdem sah man das Barackenlager, das ganz in der Nähe lag, ein Biotop sozusagen für die merkwürdigsten Vögel. Das Lazarett war inzwischen aufgelöst worden, und neben den vielen Flüchtlingen und Heimatvertriebenen lebten dort auch Menschen, die mit ihrer Situation im Schatten einer sich neu formierenden Gesellschaft nicht zurechtkamen.
Eine schwere Zeit. Die Einwohnerzahl von Wittmund, wohin es uns durch Zufall verschlug, hatte sich nach dem Krieg durch den Zustrom aus den Ostgebieten um fast zweitausend Menschen erhöht. Daraus ergaben sich natürlich Probleme, denn abgesehen von den Belastungen für die einheimische Bevölkerung, sind Fremde, noch dazu in diesem Ausmaß, nirgendwo gern gesehen. Und die Streitigkeiten der Erwachsenen fanden ihre Fortsetzung unter den Kindern und Jugendlichen, die nicht selten mit Steinen und Knüppeln aufeinander losgingen.
Schlägereien waren an der Tagesordnung. Es wurden Banden gebildet, die sich bekämpften. Am Stadtrand fanden regelrechte Schlachten zwischen den Kindern der Einheimischen und denen der Flüchtlinge statt. Zeitweise war es schwierig, zur Schule zu gelangen, ohne verprügelt zu werden. Im Sommer angelten und badeten wir im Fluss vor der Stadt und lernten ganz nebenbei schwimmen. Wir tauchten nach weggeworfenen Waffen, mit denen wir Krieg spielten, wie es uns vorgemacht worden war.
Als die Situation in der Siedlung, in der überwiegend ehemalige SA-Leute wohnten, für uns wie für die Wirtsleute unerträglich wurde, zogen wir in das Lager um, wo wir in einer der Baracken drei Zimmer erhielten. Manchmal kamen andere Heimatvertriebene vorbei, und die Männer erzählten sich ihre Kriegserlebnisse, die zumeist glorifiziert wurden, oder man sprach wehmütig von »Zuhause«, das war die verlorene Heimat im Osten, in die man irgendwann zurückkehren würde. Die meisten empfanden das Kriegsende als eine furchtbare Niederlage, unverdient, denn man hatte ja sein Letztes gegeben, um zu siegen. Über die Gräuel, die man selber erfahren oder anderen angetan hatte, wurde nicht gesprochen, selten über Hitler und die nationalsozialistische Ideologie.
Nach und nach beruhigte sich die Situation, niemand musste mehr verhungern oder erfrieren. Vielen der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen wurde klar, dass die deutschen Ostgebiete für lange Zeit, wenn nicht für immer, verloren waren. Sie gingen in die Großstädte und ins Ruhrgebiet, wo es Arbeit gab; manche gründeten Firmen oder heirateten in einheimische Familien ein. Hinzu kam, dass die ansässige Bevölkerung merkte, wie sehr sie durch den Zustrom der Fremden, die essen, wohnen und sich kleiden mussten, profitierte. Der Krieg wurde Vergangenheit, man begann wieder in die Zukunft zu schauen.
Mein Vater besorgte ein altes Radio, und während ich nach der Schule und dem Mittagessen meine Hausaufgaben machte, hörte ich die spannenden wie informativen Sendungen im Schulfunk. So erfuhr ich schon früh, wer Albert Einstein war, wie Kolumbus Amerika entdeckte oder welche Aufgaben ein Parlament wahrnimmt. Noch heute habe ich die Erkennungsmelodie aus der »Zauberflöte« von Mozart oder die etwas kratzige Stimme des Tierfreundes im Ohr, der kurzweilig über Zaunkönig, Blindschleiche oder Hamster plauderte. Jeden Tag hörten wir die Nachrichten, abends manchmal Hörspiele. Fernsehen gab es noch nicht, so dass viel Zeit blieb.
Sobald ich flüssig las, verschlang ich alles, was ich an Lesbarem kriegen konnte. Das waren zunächst überwiegend so genannte Groschenhefte, die wir in der Schule tauschten und unter der Bank lasen. Ich erinnere mich an Western wie Billy Jenkins, Tom Prox und Pete, an Landser-Romane und an Comics wie Tarzan, Akim und Prinz Eisenherz. Manchmal bekam ich durch Zufall anderes in die Hand, zum Beispiel Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert: »Die Küchenuhr« und »Nachts schlafen die Ratten doch«.
Auf dem Marktplatz hielt einmal in der Woche ein Bücherbus der Amerikaner, eine verhältnismäßig gut ausgestattete fahrende Bibliothek. Offenbar beabsichtigte man mit dieser Einrichtung den Demokratisierungsprozess im Nachkriegsdeutschland, das immer noch mit den Hinterlassenschaften der Nazizeit rang, zu befördern - aus heutiger Sicht und im Hinblick auf die Ergebnisse der PISA-Studie eine bemerkenswerte Kulturinitiative.
Mir erschien das damals wie ein Geschenk. Ich lieh mir Jack Londons »Wolfsblut« aus, Coopers Lederstrumpf-Geschichten, »Robinson Crusoe« von Daniel Defoe, »Die Schatzinsel« von Robert Louis Stevenson, Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer von Mark Twain sowie sämtliche Hornblower-Romane über Seeabenteuer von Cecil S. Forester. Es gab auch Bildbände über Neumexiko, Alaska und Kanada, die meine Phantasie beflügelten und die Sehnsucht nach den fernen Ländern weckten. Samenkörner, die später aufgingen, als ich Mexiko, Alaska und Kanada bereiste.
Allmählich öffnete sich der Horizont, und die Gespenster der Vergangenheit vermochten mich nicht mehr zu ängstigen. Manchmal tauchte ich tagelang ab in die Welt meiner Romanfiguren, die mir viel zu sagen hatten. Die Bücher halfen mir über die rauhe Realität mit ihren Problemen, Demütigungen und Kümmernissen hinweg. Wenn mich jemand beschimpfte, konnte ich mich mit David Copperfield trösten, dessen traurige Kindheit mir Charles Dickens vor Augen führte. Oder ich versetzte mich in die Rote Zora, die sich mit ihrer Bande elternloser Kinder an der Küste Dalmatiens Respekt verschaffte.
Als der Bücherbus nicht mehr kam, fanden sich andere Gelegenheiten. In der Stadt gab es einen Friseur, der eine Lotterie-Annahmestelle hatte. Gelegentlich musste ich dort den Toto-Schein meiner Eltern abgeben, die auf den großen Gewinn hofften, der ihnen ein besseres Leben ermöglichen würde. Bei diesem Friseur stand ein Regal mit zahlreichen Büchern, die man für ein paar Pfennige ausleihen konnte: Triviale Unterhaltungsliteratur, hin und wieder etwas Gutes, beispielsweise die Romane »Die Regulatoren in Arkansas« und »Die Flusspiraten des Mississippi« von Friedrich Gerstäcker.
Auch in der Schule bemühte man sich damals um Leseförderung. Es gab zwar keine Bibliothek, aber die Klassenlehrerin verfügte über eine Bücherkiste, die einmal wöchentlich geöffnet wurde. Jetzt ging ich mit Kapitän Ahab auf die Jagd nach dem weißen Wal, litt und triumphierte mit dem Grafen von Monte-Christo, besuchte Onkel Tom in seiner Hütte in Kentucky, tauchte mit Kapitän Nemo 20.000 Meilen tief ins Meer und ritt als Kurier des Zaren durch Russland. In den Ferien arbeitete ich in einer Wäscherei und beim Bauern auf dem Feld, um mir das Geld für ein Fahrrad zu verdienen.
Eines Tages gab mir die Lehrerin ein ungewöhnlich dickes Buch mit dem Titel »Die Ahnen«, das ich widerwillig mit nach Hause nahm, dann jedoch in wenigen Tagen durchlas. Es handelte vom Schicksal einer Familie von der Germanenzeit bis zur Neuzeit. Das fand ich spannend, ebenso den Roman »Soll und Haben«, in dem derselbe Autor, Gustav Freytag, von den Irrwegen und der schließlichen Läuterung eines jungen Breslauer Kaufmanns erzählt.
Inzwischen war das Lager nahezu aufgelöst. Zurückgeblieben waren ein paar Familien und einige Einzelgänger, die den Absprung in die neue Zeit des beginnenden Wirtschaftswunders nicht geschafft hatten, sowie einige so genannte Asoziale. Meine Eltern, die mit der »Niedersächsischen Heimstätte« ein Haus bauen wollten, nachdem mein Vater bei einer Behörde Arbeit gefunden hatte, blieben ebenfalls bis das Haus fertig war. Ein seltsam buntes Leben.
Nebenan wohnte Albert Hoffmann, ein ehemaliger Mühlenbesitzer, mit seiner Frau, die durch aparte Hüte in der kleinbürgerlichen Umgebung auffiel und sichtlich unter ihrem sozialen Abstieg litt. Ein paar Baracken weiter hauste der etwas unheimliche Adolf Beier, der KZ-Wärter gewesen war, wie gemunkelt wurde, und trotz seines Rheumas gegen geringes Entgelt Gartenarbeit verrichtete. Die kinderreiche Familie Kasunke machte dadurch von sich reden, dass gelegentlich Hausdurchsuchungen stattfanden, der älteste Sohn mit einer Beinprothese aus der Fremdenlegion zurückkehrte und Herr Kasunke für einige Zeit ins Gefängnis wanderte. Ein ehemaliger Fliegermajor bot Nachhilfeunterricht in Mathematik an, Fräulein Zielinski erhielt häufig wechselnden Herrenbesuch, vor allem englischer Besatzungssoldaten, und beim Herrn Baron fanden geheimnisvolle Séancen statt. Dann gab es noch einen früheren Stabsarzt, der eine kleine, womöglich illegale Praxis betrieb, und einen zurückgebliebenen französischen Kriegsgefangenen, der mit einer hübschen blonden Krankenschwester zusammenlebte. Im Sommer kam der Zirkus auf den alten Appellplatz, der nun als Sportplatz genutzt wurde, und an der Landstraße kampierten Zigeuner.
Meine Eltern hatten einen Garten angelegt, in dem wir Kartoffeln, Bohnen, Erbsen, Gemüse und Kräuter anbauten und für den ich immer mehr zuständig wurde, denn meinem Vater machte noch seine Kriegsverletzung zu schaffen. Oft arbeitete ich während meiner gesamten freien Zeit in diesem Garten, dessen Erträge uns über die andauernde finanzielle Misere hinweghalfen. Geld war knapp, wir rechneten im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Pfennig. Dennoch erinnere ich mich an ausgelassene Feste im Kreise anderer Vertriebener und an sommerliche Ausflüge in die Fischerdörfer am nahe gelegenen Meer. Man versuchte sich einzurichten, so gut es ging.
Wenn ich nicht in der Schule war, im Garten arbeitete oder las, stromerte ich in den umliegenden Feldern und im Wald herum, beobachtete Tiere, baute mir Höhlen und sammelte im Sommer Beeren und Pilze. Ich freundete mich mit den beiden Söhnen des Försters an, die mir zeigten, wo sich die Kreuzottern sonnten und wo Pfifferlinge, Haselnüsse und Esskastanien wuchsen. Außerdem liehen sie mir ihre sämtlichen Karl-May-Bände. Zwischen den Betonbrocken eines gesprengten Schießstandes spielten wir Winnetou und Old Shatterhand, schossen mit dem Luftgewehr auf leere Konservendosen.
Der Förster und seine Frau betrieben nebenher eine kleine Landwirtschaft, und wenn die Söhne helfen mussten, schloss ich mich ihnen an. Das Heu war einzubringen, der Stall auszumisten, die Kühe waren zu melken, Kartoffeln und Rüben zu ernten. Zur Belohnung gab es manchmal eine Einladung zum Abendessen, das besonders reichhaltig ausfiel, wenn geschlachtet worden war. Außerdem erfuhr ich viel über die Natur, über die Jagd und die Hege. Ein großes Erlebnis war es, einen Hasen zu schießen, den ich sogar mit nach Hause nehmen durfte. Der Wald wurde mir so vertraut, dass ich Förster werden wollte.
Als ich vierzehn Jahre alt war, wurde im oberen Stockwerk der alten Volksschule eine Stadtbibliothek eingerichtet, deren eifriger und begeisterter Benutzer ich bald war. Auf meine Frage hin empfahl mir der Bibliothekar Hemingways Roman »Wem die Stunde schlägt«, den ich in wenigen Tagen verschlang. Es folgten »Vater Goriot« von Balzac, »Schuld und Sühne« von Dostojewski, »Die Buddenbrooks« von Thomas Mann, »Der Steppenwolf« von Hermann Hesse, Romane von Heinrich Böll, Anna Seghers, Max Frisch, Jean-Paul Sartre, Theodor Fontane, Franz Kafka und vielen anderen Autoren, die mich unterhielten, überraschten und faszinierten. Das war wieder eine neue Welt, die sich mir öffnete, eine Welt voller Einsichten, philosophischer Reflexionen und unendlicher Möglichkeiten. Jetzt beschloss ich, Schriftsteller zu werden.
Im Deutschunterricht lasen wir damals Goethe, Schiller, Kleist und Lessing, auch »Pole Poppenspäler« von Theodor Storm und von Annette von Droste-Hülshoff die Novelle »Die Judenbuche«, die ich ziemlich langweilig fand. Meistens ging ich gern zur Schule, war auch ein guter Schüler. Da es in der Stadt kein Gymnasium gab und für Schulgeld und Fahrtkosten ohnehin kein Geld übrig war, besuchte ich die Mittelschule. Dass einige Lehrer ehemalige Nazis waren, störte mich nicht und wurde mir erst viel später bewusst. Ich bemühte mich, nicht aufzufallen und ging im Übrigen meiner Wege. Das Abitur holte ich dann Mitte der sechziger Jahre in Abend- und Fernkursen neben der Arbeit nach.
Aber immer wieder Kränkungen und Erniedrigungen. Als wir im Unterricht einmal über den Krieg sprachen und ich von den Schrecken der Besetzung Oberschlesiens durch die Rote Armee berichten wollte, unterbrach mich die Lehrerin, eine Bauerntochter, mit den Worten: »Hier sind auch ein paar Bomben gefallen.« Und als mein Vater einmal in kleinem Kreis erwähnte, dass meine Gleiwitzer Großeltern vermögend waren, entgegnete ihm ein Einheimischer: »Jaja, ihr hattet doch alle fünfzig Hektar Luft hinterm Haus und Parkett im Wohnzimmer«, worauf meine Mutter in Tränen ausbrach. Das machte mich traurig und wütend zugleich.
Viel Unverständnis damals, häufig noch unterschwellige Feindseligkeit und Missgunst, viele Auseinandersetzungen. Die große Familie, die in Schlesien verwurzelt war, hatte sich in alle Winde verstreut, nicht wenige waren tot oder durch die Kriegsereignisse traumatisiert, so auch meine Eltern. Als meine Mutter mit mir in Ostfriesland ankam, war sie 26 Jahre alt, und erst heute kann ich ermessen, welches Heimweh sie manchmal quälte, und wie groß die Sehnsucht nach ihren Eltern gewesen sein muss. Wir lebten lange als Fremde am Rande des Existenzminimums. Erst nach Jahren begannen sich die Verhältnisse für uns halbwegs zu normalisieren, und es dauerte nochmals einige Jahre, bis ich begriff, dass wir unser Leben - jedenfalls in Friedenszeiten und bis zu einem gewissen Grad - selber einzurichten vermögen.
*Dem Beitrag liegt ein Vortrag von Wolfgang Bittner zugrunde, der am 29. Juli 65 Jahre alt wird und in Ostfriesland aufgewachsen ist. Eine Sammlung mit Essays und Vorträgen des Autors ist soeben unter dem Titel "Schreiben, Lesen, Reisen" im Athena-Verlag in Oberhausen erschienen, ISBN 3-89896-253-9, EUR 12,90.
Von Wolfgang Bittner ist auch der Roman "Niemandsland", dessen inzwischen sechstes Kapitel Sie in dieser Ausgabe lesen können.
Online-Flyer Nr. 54 vom 25.07.2006