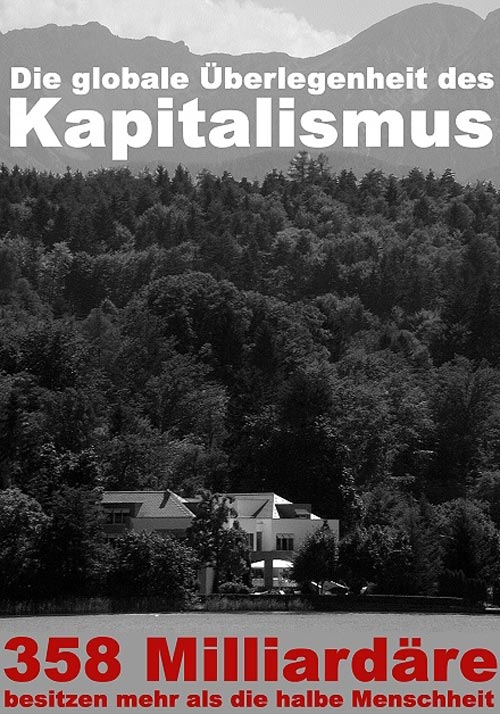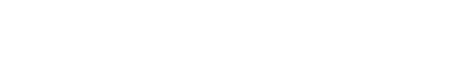SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Arbeit und Soziales
Abschied vom Zwei-Klassen-Gesundheitssystem ist ein Gebot der Vernunft
Krankes System
Von Harald Schauff
 Alle zahlen in einen Topf ein und alle erhalten etwas daraus. Die Höhe der Beiträge richtet sich im Verhältnis nach der des persönlichen Einkommens. So sieht es das Solidaritätsprinzip im Hinblick auf die Sozialversicherung vor. Umgesetzt wurde dieses in Deutschland nur recht bedingt. Gutverdiener, Selbstständige und Beamte haben seit je her ihre eigenen Sozialversicherungspötte, die von Lobby-Verbänden eisern verteidigt werden. Da hört die Solidarität mit der Bevölkerungsmehrheit auf. Höhnischerweise wird die Zwei-Klassigkeit als gerecht verkauft. Würden höhere Einkommensgruppen in den gesetzlichen Rententopf einzahlen, hätten sie gemäß ihrer höheren Beiträge auch höhere Ansprüche, so eines der fadenscheinigen Argumente. Ein Blick auf das Schweizer Rentensystem entkräftet diesen Einwand: Hier wurde für die ausgezahlten Rentenbeiträge eine Obergrenze bei etwas über 2000 Euro festgelegt. Darin besteht die Solidarität der Gutverdiener mit dem Rest der Bevölkerung.
Alle zahlen in einen Topf ein und alle erhalten etwas daraus. Die Höhe der Beiträge richtet sich im Verhältnis nach der des persönlichen Einkommens. So sieht es das Solidaritätsprinzip im Hinblick auf die Sozialversicherung vor. Umgesetzt wurde dieses in Deutschland nur recht bedingt. Gutverdiener, Selbstständige und Beamte haben seit je her ihre eigenen Sozialversicherungspötte, die von Lobby-Verbänden eisern verteidigt werden. Da hört die Solidarität mit der Bevölkerungsmehrheit auf. Höhnischerweise wird die Zwei-Klassigkeit als gerecht verkauft. Würden höhere Einkommensgruppen in den gesetzlichen Rententopf einzahlen, hätten sie gemäß ihrer höheren Beiträge auch höhere Ansprüche, so eines der fadenscheinigen Argumente. Ein Blick auf das Schweizer Rentensystem entkräftet diesen Einwand: Hier wurde für die ausgezahlten Rentenbeiträge eine Obergrenze bei etwas über 2000 Euro festgelegt. Darin besteht die Solidarität der Gutverdiener mit dem Rest der Bevölkerung.
In Deutschland gehört ‘Solidarität’ zu den gern gedroschenen Worthülsen in politischen Sonntagsreden. Sobald versucht wird, jene mit Inhalt zu füllen, setzt heftiger Gegenwind in Orkanstärke seitens Lobbyverbänden ein, welche bestehende Privilegien erbittert verteidigen. Jüngstes, viel diskutiertes, Beispiel liefert die Bürgerversicherung. Ein vernünftiges Konzept, das mit dem Zwei-Klassen-Gesundheitssystem Schluss macht, weil es ausnahmslos alle Einkommensgruppen einschließlich Beamter, Selbstständiger und Vielverdiener in einen Topf einzahlen lässt. Sollte es nicht so sein, wenn es sozial und demokratisch zugeht?
Das leuchtete auch den Sozialdemokraten ein, weshalb sie das Konzept, allen voran ihr Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, aufgriffen. Im Nu peitschte ihnen eine gigantische Woge des Unmuts entgegen: Von Privatpatienten, die Wert auf medizinische Vorzugsbehandlung legen, Chefärzten, die ein Versiegen ihrer Hauptverdienstquelle befürchten, Versicherungen, die um ihre Profite und Vertreter, die um ihre Provisionen bangen.
Tsunami der Empörung
Sie alle erkennt der bekannte Armutsforscher Christoph Butterwegge (Bericht: Neues Deutschland v. 3.1.18) im Tsunami der Empörung. Assistiert von strukturkonservativen Juristen, die für jedes Privileg scheinbar plausible Argumente finden, machten Ärztevertreter, Privatversicherer und Wirtschaftslobbyisten mobil gegen die ‘Einheitsversicherung’, die angeblich die (Gewerbe-)’Freiheit’ bedrohe. Es gehe um den Erhalt der Zwei-Klassen-Medizin, welche es Besserverdienenden und Vermögenden erlaube, in Sondersysteme auszuweichen statt Solidarität mit dem Rest der Bevölkerung zu üben.
Unter dem Druck der mächtigen Lobby-Gruppen hätte die SPD ihr Modell der Bürgerversicherung verwässert, meint Butterwegge. Privatversicherungen könnten sie als Sondertarif anbieten, die Beitragsbemessungsgrenze würde weder abgeschafft noch angehoben. Auf Vermögenseinkünfte würden nach wie vor keine Beiträge anfallen.
Eine weiteres Problem für die SPD, das Butterwegge nicht erwähnt, dürfte sein: Das Konzept wird aus den eigenen Reihen unter Beschuss genommen, u.a. von der Dienstleistungsgewerkschaft verdi, die den Verlust von Arbeitsplätzen bei den privaten Kassen fürchtet. Deren Betriebsräte demonstrierten aus diesem Grund bereits gegen die Bürgerversicherung.
Heißt also zusammengefasst: Weil neben einigen Arbeitsplätzen Privilegien, Pfründe, Profite, also Vorteile für kleinere, besser gestellte Bevölkerungsteile gefährdet sind, soll der überwiegenden Bevölkerungsmehrheit ein besseres und gerechteres Gesundheitssystem versagt bleiben. Obwohl es ein Gebot des Allgemeinwohles und demokratischer Prinzipien darstellt. Genau dieses machen die Gegner der Bürgerversicherung widersinnigerweise für den Erhalt des Zwei-Klassen-Systems geltend, womit sie uns die Quadratur des Kreises zu verkaufen versuchen.
Ein Standardargument der Versicherer lautet seit Jahren, Ärzte seien auf die höheren Honorare zur Behandlung von Privatpatienten angewiesen, um eine ‘moderne Infrastruktur’ aufrecht zu erhalten (Meldung: DER SPIEGEL 36/2017). In derselben SPIEGEL-Meldung steht ein Satz vorher zu lesen, die Zahl der Privatpatienten sei von 2011 bis 2015 von 8,98 auf 8,79 Millionen gesunken. Möglicherweise verliere die Behandlung von Privatpatienten an Bedeutung, mutmaßt der SPIEGEL.
Tamm-Tamm der Lobbyisten
Offensichtlich wird die Bedeutung der privaten Kassen infolge des lauten Tamm-Tamms ihrer Lobbyisten weit überschätzt. Sicher bekäme einige auf die ausschließliche Behandlung von Privatpatienten spezialisierte Arztpraxen Probleme bei Wegfall der privaten Krankenversicherung. In Hessen wären das z.B. 5,5 %, ein geringer Bruchteil also. Weitaus höher wäre die Anzahl der Praxen, die in Existenznöte gerieten, würde ein Drittel oder nur ein Viertel der Kassenpatienten ausbleiben.
So wird ein Schuh daraus: Die Masse des gesetzlich versicherten Kleinviehs sorgt hauptsächlich für den Mist, auf dem das gesamte Gesundheitssystem gedeiht. Die kleineren privaten Haufen können diesen nicht ansatzweise ausgleichen, auch wenn das propagandistische Gebläse der Bürgerversicherungs-Gegner das Gegenteil weismachen will.
Anders herum könnte die überwiegende Mehrheit der niedergelassenen Mediziner eher auf Privatpatienten verzichten. Tatsächlich tun dies einige bereits heute. Die ‘Frankfurter Rundschau’(27.12.17) berichtete über einen hessischen Landarzt, der sich nur noch um Kassenpatienten kümmert. An der Behandlung von Privatpatienten nervte ihn u.a. der aufwendige Schreibkram. Er musste die komplexen Behandlungsrechnungen persönlich schreiben. Dieser Aufwand habe sich bei Standarduntersuchungen für 20 Euro kaum gelohnt.
Durch Reklamationen sei zusätzlich Zeit für Kassenpatienten verloren gegangen. 80 % der Privatpatienten seien Beamte gewesen. Bestens versorgt seien manche von ihnen mit abstrusen Wünschen gekommen wie Untersuchungen nach Spurenelementen und Nahrungsmittelallergien. Die übrigen Privatpatienten seien zumeist als junge, gesunde Menschen in die Privatversicherung eingetreten, könnten jedoch später die steigenden Prämien nicht mehr zahlen. Zudem hätten sie eine hohe Selbstbeteiligung. Sie würden auf abgespeckte Billiguntersuchungen bestehen und scheuten teure Medikamente. Rehas und Psychotherapien wären häufig von Privatversicherungen ausgeschlossen. Klar, sie kosten viel und schmälern in der Bilanz die Gewinne. Diese System sei der Gesundheit nicht förderlich und ohne die Beamtenschaft tot, meint der Landarzt.
Fazit: Die Zweit-Klassigkeit besteht nicht nur zwischen gesetzlichen und privaten Kassen, sondern bereits innerhalb der letzteren. Ein weiterer Grund, endlich eine einheitliche Bürgerversicherung einzuführen. Private Kassen brauchen nicht direkt geschleift zu werden, sie können sich auf Zusatzversicherungen spezialisieren. Leider wird wohl noch einige Zeit vergehen, bis endlich ein erster zaghafter Schritt in diese Richtung erfolgt. Das Beispiel des gesetzlichen Mindestlohnes spricht hier Bände.
Harald Schauff ist Redakteur der Kölner Obdachlosen- und Straßenzeitung "Querkopf". Sein Artikel ist im "Querkopf", Ausgabe Februar 2018, erschienen.
Online-Flyer Nr. 650 vom 07.03.2018
Abschied vom Zwei-Klassen-Gesundheitssystem ist ein Gebot der Vernunft
Krankes System
Von Harald Schauff
 Alle zahlen in einen Topf ein und alle erhalten etwas daraus. Die Höhe der Beiträge richtet sich im Verhältnis nach der des persönlichen Einkommens. So sieht es das Solidaritätsprinzip im Hinblick auf die Sozialversicherung vor. Umgesetzt wurde dieses in Deutschland nur recht bedingt. Gutverdiener, Selbstständige und Beamte haben seit je her ihre eigenen Sozialversicherungspötte, die von Lobby-Verbänden eisern verteidigt werden. Da hört die Solidarität mit der Bevölkerungsmehrheit auf. Höhnischerweise wird die Zwei-Klassigkeit als gerecht verkauft. Würden höhere Einkommensgruppen in den gesetzlichen Rententopf einzahlen, hätten sie gemäß ihrer höheren Beiträge auch höhere Ansprüche, so eines der fadenscheinigen Argumente. Ein Blick auf das Schweizer Rentensystem entkräftet diesen Einwand: Hier wurde für die ausgezahlten Rentenbeiträge eine Obergrenze bei etwas über 2000 Euro festgelegt. Darin besteht die Solidarität der Gutverdiener mit dem Rest der Bevölkerung.
Alle zahlen in einen Topf ein und alle erhalten etwas daraus. Die Höhe der Beiträge richtet sich im Verhältnis nach der des persönlichen Einkommens. So sieht es das Solidaritätsprinzip im Hinblick auf die Sozialversicherung vor. Umgesetzt wurde dieses in Deutschland nur recht bedingt. Gutverdiener, Selbstständige und Beamte haben seit je her ihre eigenen Sozialversicherungspötte, die von Lobby-Verbänden eisern verteidigt werden. Da hört die Solidarität mit der Bevölkerungsmehrheit auf. Höhnischerweise wird die Zwei-Klassigkeit als gerecht verkauft. Würden höhere Einkommensgruppen in den gesetzlichen Rententopf einzahlen, hätten sie gemäß ihrer höheren Beiträge auch höhere Ansprüche, so eines der fadenscheinigen Argumente. Ein Blick auf das Schweizer Rentensystem entkräftet diesen Einwand: Hier wurde für die ausgezahlten Rentenbeiträge eine Obergrenze bei etwas über 2000 Euro festgelegt. Darin besteht die Solidarität der Gutverdiener mit dem Rest der Bevölkerung. In Deutschland gehört ‘Solidarität’ zu den gern gedroschenen Worthülsen in politischen Sonntagsreden. Sobald versucht wird, jene mit Inhalt zu füllen, setzt heftiger Gegenwind in Orkanstärke seitens Lobbyverbänden ein, welche bestehende Privilegien erbittert verteidigen. Jüngstes, viel diskutiertes, Beispiel liefert die Bürgerversicherung. Ein vernünftiges Konzept, das mit dem Zwei-Klassen-Gesundheitssystem Schluss macht, weil es ausnahmslos alle Einkommensgruppen einschließlich Beamter, Selbstständiger und Vielverdiener in einen Topf einzahlen lässt. Sollte es nicht so sein, wenn es sozial und demokratisch zugeht?
Das leuchtete auch den Sozialdemokraten ein, weshalb sie das Konzept, allen voran ihr Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, aufgriffen. Im Nu peitschte ihnen eine gigantische Woge des Unmuts entgegen: Von Privatpatienten, die Wert auf medizinische Vorzugsbehandlung legen, Chefärzten, die ein Versiegen ihrer Hauptverdienstquelle befürchten, Versicherungen, die um ihre Profite und Vertreter, die um ihre Provisionen bangen.
Tsunami der Empörung
Sie alle erkennt der bekannte Armutsforscher Christoph Butterwegge (Bericht: Neues Deutschland v. 3.1.18) im Tsunami der Empörung. Assistiert von strukturkonservativen Juristen, die für jedes Privileg scheinbar plausible Argumente finden, machten Ärztevertreter, Privatversicherer und Wirtschaftslobbyisten mobil gegen die ‘Einheitsversicherung’, die angeblich die (Gewerbe-)’Freiheit’ bedrohe. Es gehe um den Erhalt der Zwei-Klassen-Medizin, welche es Besserverdienenden und Vermögenden erlaube, in Sondersysteme auszuweichen statt Solidarität mit dem Rest der Bevölkerung zu üben.
Unter dem Druck der mächtigen Lobby-Gruppen hätte die SPD ihr Modell der Bürgerversicherung verwässert, meint Butterwegge. Privatversicherungen könnten sie als Sondertarif anbieten, die Beitragsbemessungsgrenze würde weder abgeschafft noch angehoben. Auf Vermögenseinkünfte würden nach wie vor keine Beiträge anfallen.
Eine weiteres Problem für die SPD, das Butterwegge nicht erwähnt, dürfte sein: Das Konzept wird aus den eigenen Reihen unter Beschuss genommen, u.a. von der Dienstleistungsgewerkschaft verdi, die den Verlust von Arbeitsplätzen bei den privaten Kassen fürchtet. Deren Betriebsräte demonstrierten aus diesem Grund bereits gegen die Bürgerversicherung.
Heißt also zusammengefasst: Weil neben einigen Arbeitsplätzen Privilegien, Pfründe, Profite, also Vorteile für kleinere, besser gestellte Bevölkerungsteile gefährdet sind, soll der überwiegenden Bevölkerungsmehrheit ein besseres und gerechteres Gesundheitssystem versagt bleiben. Obwohl es ein Gebot des Allgemeinwohles und demokratischer Prinzipien darstellt. Genau dieses machen die Gegner der Bürgerversicherung widersinnigerweise für den Erhalt des Zwei-Klassen-Systems geltend, womit sie uns die Quadratur des Kreises zu verkaufen versuchen.
Ein Standardargument der Versicherer lautet seit Jahren, Ärzte seien auf die höheren Honorare zur Behandlung von Privatpatienten angewiesen, um eine ‘moderne Infrastruktur’ aufrecht zu erhalten (Meldung: DER SPIEGEL 36/2017). In derselben SPIEGEL-Meldung steht ein Satz vorher zu lesen, die Zahl der Privatpatienten sei von 2011 bis 2015 von 8,98 auf 8,79 Millionen gesunken. Möglicherweise verliere die Behandlung von Privatpatienten an Bedeutung, mutmaßt der SPIEGEL.
Tamm-Tamm der Lobbyisten
Offensichtlich wird die Bedeutung der privaten Kassen infolge des lauten Tamm-Tamms ihrer Lobbyisten weit überschätzt. Sicher bekäme einige auf die ausschließliche Behandlung von Privatpatienten spezialisierte Arztpraxen Probleme bei Wegfall der privaten Krankenversicherung. In Hessen wären das z.B. 5,5 %, ein geringer Bruchteil also. Weitaus höher wäre die Anzahl der Praxen, die in Existenznöte gerieten, würde ein Drittel oder nur ein Viertel der Kassenpatienten ausbleiben.
So wird ein Schuh daraus: Die Masse des gesetzlich versicherten Kleinviehs sorgt hauptsächlich für den Mist, auf dem das gesamte Gesundheitssystem gedeiht. Die kleineren privaten Haufen können diesen nicht ansatzweise ausgleichen, auch wenn das propagandistische Gebläse der Bürgerversicherungs-Gegner das Gegenteil weismachen will.
Anders herum könnte die überwiegende Mehrheit der niedergelassenen Mediziner eher auf Privatpatienten verzichten. Tatsächlich tun dies einige bereits heute. Die ‘Frankfurter Rundschau’(27.12.17) berichtete über einen hessischen Landarzt, der sich nur noch um Kassenpatienten kümmert. An der Behandlung von Privatpatienten nervte ihn u.a. der aufwendige Schreibkram. Er musste die komplexen Behandlungsrechnungen persönlich schreiben. Dieser Aufwand habe sich bei Standarduntersuchungen für 20 Euro kaum gelohnt.
Durch Reklamationen sei zusätzlich Zeit für Kassenpatienten verloren gegangen. 80 % der Privatpatienten seien Beamte gewesen. Bestens versorgt seien manche von ihnen mit abstrusen Wünschen gekommen wie Untersuchungen nach Spurenelementen und Nahrungsmittelallergien. Die übrigen Privatpatienten seien zumeist als junge, gesunde Menschen in die Privatversicherung eingetreten, könnten jedoch später die steigenden Prämien nicht mehr zahlen. Zudem hätten sie eine hohe Selbstbeteiligung. Sie würden auf abgespeckte Billiguntersuchungen bestehen und scheuten teure Medikamente. Rehas und Psychotherapien wären häufig von Privatversicherungen ausgeschlossen. Klar, sie kosten viel und schmälern in der Bilanz die Gewinne. Diese System sei der Gesundheit nicht förderlich und ohne die Beamtenschaft tot, meint der Landarzt.
Fazit: Die Zweit-Klassigkeit besteht nicht nur zwischen gesetzlichen und privaten Kassen, sondern bereits innerhalb der letzteren. Ein weiterer Grund, endlich eine einheitliche Bürgerversicherung einzuführen. Private Kassen brauchen nicht direkt geschleift zu werden, sie können sich auf Zusatzversicherungen spezialisieren. Leider wird wohl noch einige Zeit vergehen, bis endlich ein erster zaghafter Schritt in diese Richtung erfolgt. Das Beispiel des gesetzlichen Mindestlohnes spricht hier Bände.
Harald Schauff ist Redakteur der Kölner Obdachlosen- und Straßenzeitung "Querkopf". Sein Artikel ist im "Querkopf", Ausgabe Februar 2018, erschienen.
Online-Flyer Nr. 650 vom 07.03.2018