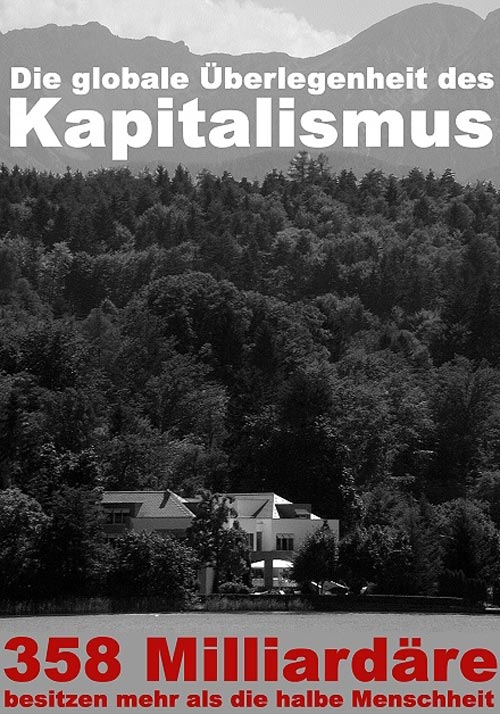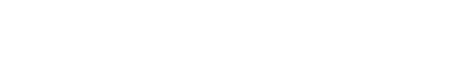SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Literatur
Aus dem Roman "Alle Wünsche werden erfüllt"
Geisterbahn Schule
Von Renate Schoof
 Nach Bettys Tod hatte sie begriffen: Ohne beruflichen Stress wären deren Seele und Körper leichter in ein gesundes Gleichgewicht zurückgekehrt. Der Schulleiter fand für das, was ablief, ein anschauliches Bild: „Wirft man Krebse in kochendes Wasser, springen sie wieder heraus. Befinden sie sich allerdings in einem Topf mit kaltem Wasser, das langsam zum Siedepunkt gebracht wird, verpassen sie den lebensrettenden Moment und lassen sich kochen.“ Vielleicht war das Unsinn. Es irritiert sie, beim Grübeln über die Krankheit Krebs an Hummer und Krebse denken zu müssen. Seinerzeit im Lehrerzimmer fragte niemand nach dem Wahrheitsgehalt des Vergleichs. Alle wussten, der Alltag an ihrer Schule war von Jahr zu Jahr stressiger geworden, und die Belastung hatte längst den Zustand massiver Selbstausbeutung erreicht.
Nach Bettys Tod hatte sie begriffen: Ohne beruflichen Stress wären deren Seele und Körper leichter in ein gesundes Gleichgewicht zurückgekehrt. Der Schulleiter fand für das, was ablief, ein anschauliches Bild: „Wirft man Krebse in kochendes Wasser, springen sie wieder heraus. Befinden sie sich allerdings in einem Topf mit kaltem Wasser, das langsam zum Siedepunkt gebracht wird, verpassen sie den lebensrettenden Moment und lassen sich kochen.“ Vielleicht war das Unsinn. Es irritiert sie, beim Grübeln über die Krankheit Krebs an Hummer und Krebse denken zu müssen. Seinerzeit im Lehrerzimmer fragte niemand nach dem Wahrheitsgehalt des Vergleichs. Alle wussten, der Alltag an ihrer Schule war von Jahr zu Jahr stressiger geworden, und die Belastung hatte längst den Zustand massiver Selbstausbeutung erreicht.
Als sie schon in B. lebte, war dieser von allen geschätzte Schulleiter mit akutem Nierenversagen aus der Schule getragen worden. Gunnar hatte ihr das geschrieben, wusste es wer weiß woher. Sie sieht ihn vor sich, den sympathischen, für das Viertel, in dem die Schule liegt, ein bisschen zu feinen Schulleiter. Sie sieht ihn vor sich, wie er auf dem Schulhof mit Akim um ein Fahrrad ringt, das der als Schläger bekannte Viertklässler einem anderen weggenommen hatte. Bevor sie einzugreifen vermochte, war der ältere Bruder des unterlegenen Schülers dazwischengegangen, und der Schulleiter konnte sein Gesicht wahren. Sie war damals aus einer Art Erstarrung, ausgelöst durch die Entscheidungsnot in ihr, erwacht. Hätte sie das Fenster öffnen und Akim beim Namen rufen müssen? Oder gleich die Polizei herbeitelefonieren? Akim, ein Schüler von Betty, der seine Mitschüler bedrohte, quälte, drangsalierte und einschüchterte. Wie oft hatte der Junge dem KOB, dem Kontaktbereichsbeamten, Besserung versprochen, ohne sich zu ändern.
Er war mit seinen zwölf Jahren zu alt für die Grundschule, aber nicht strafmündig gewesen – das eine hatte er gefühlt, das andere gewusst. Akims Vater war meist abwesend, die Mutter hilflos, die ältere Schwester bedrückt.
Betty geriet nie in Entscheidungsnot. Geistesgegenwärtig bewältigte sie die kompliziertesten Situationen. Deprimiert denkt Amelie an Herausforderungen, die die Inklusion für ihre Grundschule mit sich brachte, integrierten sie doch ohnehin ganz selbstverständlich jeden Tag Kinder aus zum Teil schwierigsten Familienverhältnissen. Abgeschreckt durch den hohen Anteil an Schülern, deren Muttersprache nicht Deutsch war, schickten viele Eltern ihre Kinder lieber in anderen Stadtteilen zur Schule, notfalls mit Trick, oder – wenn das Einkommen dafür ausreichte – auf eine Privatschule. Die Entmischung der Gesellschaft schritt voran. Es gab „bessere“ Viertel in der Stadt, in denen vierte Klassen öffentlicher Schulen fast geschlossen zum Gymnasium übertraten.
Fraglos war Betty besser mit Problemen zurechtgekommen als sie und einige andere, aber sie hatte sich dabei zu viel aufgebürdet. Wenn sich alle wegduckten, lud Betty sich die Sache auf, verantwortungsvoll und mit ihrem wunderbaren Lächeln. Nachdem sie Konrektorin geworden war, lag das Handy auf dem Frühstückstisch, wo sie zwischen zwei Schlucken Kaffee die Krankmeldungen von Kollegen entgegennahm. Pünktlich vor Unterrichtsbeginn stand der Vertretungsplan. So war sie gewesen: gewissenhaft, beliebt, unentbehrlich.
Amelie verschränkt die Hände unter dem Kopf. Wie war das eigentlich bei mir?, überlegt sie. Bin ich Lehrerin geworden, weil ich eine glückliche Schülerin war? Sie hat es gemocht, Neues zu entdecken, überhaupt etwas zu lernen, besonders wenn sie sich von Lehrern verstanden und ernstgenommen fühlte. Und das wollte sie an Schüler weitergeben, die Lust am Forschen, das Verstehen von Sachverhalten und das Verständnis füreinander. Empathie als Grundlage jeder Beziehung, das war ihr wichtig. Dass Mitgefühl zu Aufopferung werden kann, hatte sie fast zu spät gemerkt.
Wie gern hat sie Kindern Lesen und Schreiben beigebracht. Vor allem wohl, weil sie es selber als befreiend erlebt hatte, lesend flügge zu werden zu Ausflügen weit über den Horizont der eigenen beschränkten Verhältnisse hinaus. Lesen konnte Sehnsucht erzeugen nach mehr und anderem, konnte Sinn für Gerechtigkeit, Schönheit oder auch Güte und Friedfertigkeit vermitteln.
Gunnars spöttisches Gesicht bricht ein in ihre Erinnerungen an Glücksmomente im Studium und ihre ersten Jahre als Lehrerin. „Dich reizt die Planbarkeit“, hatte er gesagt, und vielleicht war es so. Der Beruf gab nicht nur ihren Tagen, sondern auch ihrem Leben Struktur. „Ordnung und Chaos sind deine Themen“, ein typischer Gunnar-Satz, wenn ihn das Drunter und Drüber in Küche oder Bad nervte. Ja, sie hatte es geliebt, Jahres- und Wochenpläne für die Schüler zu erstellen, Tag für Tag den Unterricht sorgfältig vorzubereiten. Das gab ihr eine Sicherheit, die ihr erlaubte, spontan zu sein und bei Bedarf vom Geplanten abzuweichen. Für Ordnung im eigenen Haus hatte die Kraft nicht ausgereicht.
Aufgetankt hat sie in der Stille ihres Zimmers, beim Korrigieren und bei Vorbereitungen. Ihr wird bewusst, wie sehr sie Ruhe und Sicherheit braucht, um handlungsfähig zu sein. Multitasking ist nicht ihr Ding. Ihre Schülerinnen und Schüler hatten die Atmosphäre der geregelten Ruhe im Klassenraum gemocht, sie wohl intuitiv als entspannend empfunden, als Kontrast zu dem Durcheinander und der beständigen Beschallung zu Hause. Bei Elternbesuchen musste sie darum bitten, den Fernseher auszuschalten. „Wir wollen doch miteinander sprechen“, hatte sie gesagt. „Dazu brauche ich Ihre Aufmerksamkeit.“ Als hätte das Gerät keinen Abschaltknopf, wurde häufig nur der Ton leise gedreht.
Ihre Gedanken kreisen um die Frage, wie lange Selbstausbeutung und Überbelastung auszuhalten ist, bis das „Material“ versagt, seien es die Nerven, die Nieren oder eben die Zellen, die in der Gebärmutter, in der Brust, der Lunge, im Darm oder sonst wo zu wuchern beginnen.
Kolleginnen, die das Problem für sich gelöst haben, tauchen vor ihr auf. Lea zum Beispiel verabschiedete sich innerhalb von sechs Jahren dreimal in Mutterschaftsurlaub, zum Teil mit Elternzeit. Ein gehässiger Satz, mit dem Leas Ehemann bei einem Sommerfest die Schwangerschaft kommentierte, ließ darauf schließen, dass es sich nicht um gemeinsame Familienplanung handelte.
Und bevor Cordula mit Rückenproblemen in Frührente ging, ließ sie sich ein halbes Jahr krankschreiben, um rechtliche Probleme bei der Verrentung und finanzielle Einbußen zu vermeiden. Beim Verteilen der Arbeit auf die anderen Kolleginnen half das wenig, zumal die Behörde keinen Ersatz schickte. Schule als Geisterbahn, denkt Amelie, empfindet wieder ihre Zerrissenheit zwischen Verständnis und dem Widerwillen gegen private Lösungen auf Kosten anderer. Kein Wunder, wenn der Vertretungsunterricht und die personell nicht abgesicherte Inklusion den ohnehin schon anstrengenden Alltag für alle Beteiligten unerträglich werden ließ.
Viola, die Mathematiklehrerin in ihrer Klasse, kam mit abenteuerlichen Entschuldigungen oft erst zur dritten Stunde, gelegentlich mit einem Attest. Es war ein offenes Geheimnis, dass sie trank. Dann war da noch Henry, der immer wieder fehlte, weil er eine kranke Frau und zwei kleine Kinder zu Hause betreute. Offenbar gehörte Betty zu den Krebsen, die nicht früh genug aus dem Kochtopf gesprungen waren. So hatte es ausgesehen, als sie für sich selber die Reißleine zog und sich aus einem Schulsystem beurlauben ließ, in dem Schwangerschaften junger Kolleginnen und Krankheiten älterer Chaos verursachten und Katastrophen heraufbeschworen.
Ohne Beschönigung über den Schulalltag der letzten Jahre nachzudenken hilft ihr, das spürt sie. Damals nahm sie Aggressionen, die sie sich in der Schule nicht zugestand, mit nach Hause. Irgendwo brauchte ihr Frust ein Ventil. Wenn sie mit Gunnar über die benachteiligten Kinder, deren von der Gesellschaft verratene Eltern oder die überforderten, teils desinteressierten Kollegen sprach, sagte er: „Ihr dürft das nicht hinnehmen! Wehrt euch!“ Sie weiß noch, wie gereizt sie darauf reagiert hat. Gunnar hatte ja recht gehabt, so wie er meistens recht hatte. Um aber Forderungen durchzusetzen, braucht es Energie. Und die fehlt, wenn man sich täglich verausgaben muss.
Politiker hielten verlogene Sonntagsreden, und gewerkschaftliche Initiativen, die darauf abzielten, Grundsätzliches zu ändern, liefen ins Leere. Ihrem Schulleiter wurde von der Schulaufsicht sogar Redeverbot erteilt, als er Einwände gegen die Inklusion förderungsbedürftiger Kinder in ihrer Schule, in der ohnehin jeder zweite Schüler Defizite hatte, erhob. Er war mit den Eltern betroffener Kinder für den Erhalt der nahegelegenen Förderschule eingetreten, das hatte die Behörde nicht geduldet.
Erschöpft und alltagsmüde hatte sie ihre Pflichtstunden reduzieren wollen, aber Gunnar war dagegen gewesen. Sie wusste ja selber: Der Kredit für Haus und Grundstück erforderte, dass sie mit voller Stundenzahl weiterarbeitete. Ihm erschien das unausweichlich. Wie er jetzt, ganz ohne sie, mit der Belastung zurechtkommt, weiß sie nicht, und es interessiert sie auch nicht.
Lautes Hundegebell in der Nähe zwingt sie, sich aufzusetzen. Auf dem Weg bemühen sich zwei Frauen, ihre Riesenschnauzer an straffgezogenen Leinen voneinander fernzuhalten. Sie lehnt sich mit dem Rücken an den Stamm ihres Schattenbaums und denkt: Spannend, was da alles hochkommt. Ihr Studium, ihre Wohnsituation, Jakob und die Frauen im Elsa hatten sie in der Gegenwart leben lassen, für einen kritischen Blick auf die Vergangenheit fehlte der Anlass.
Bei der Recherche im Internet hat sie gelesen, Krebs brauche viele Jahre, um auszubrechen. Und bevor Brustkrebs entdeckt werden könne, existiere er bereits mehrere Jahre. Sie begreift, dass die Zellentartung lange vor ihrem Ausstieg entstanden sein kann, in den stressigen Zeiten, die gerade vor ihrem geistigen Auge vorübergezogen sind.
In dem Beitrag stand auch, dass Entzündungen und Infektionen Krebs begünstigen. All die verschleppten Erkältungen, die Nebenhöhlenentzündungen, die kräftezehrende Bronchitis. Selbst mit einer Stimmbandentzündung hatte sie unterrichtet, tagelang Handlungsanweisungen schriftlich in den Heften oder an der Tafel gegeben. Da hatten noch die letzten Freaks in der Klasse begriffen, wie nützlich es ist, lesen und schreiben zu können. Und jetzt? Krebs als Quittung dafür, das Wohl anderer allzu oft über das eigene gestellt zu haben?
Gunnar meinte, sie liebe ihre Schülerinnen und Schüler, er fand das unprofessionell und romantisch. Es stimmte, aber sie konnte nichts dafür. Sie hat mit ihnen gejubelt und gelitten, versucht, die Dur-Stimmung herzustellen, die der Pädagoge Makarenko in seinen Büchern beschreibt. „Ich kann Schule nur ganz – oder gar nicht“, mit diesem Satz hat sie manchmal unfruchtbare Diskussionen beendet.
Wieder vollkommen bei sich und seltsam zufrieden, streckt sie sich auf ihrer Decke aus. In die Blätter zu schauen beruhigt, löst in ihr ein fast meditatives Gefühl aus. Und dass der bösartige Zellschaden, so es ihn gibt, in einer Vergangenheit entstanden sein muss, die sie hinter sich gelassen hat, stimmt sie zuversichtlich, nimmt der furchtbaren Angst ihre Schärfe.
Renate Schoof: Alle Wünsche werden erfüllt

Klappenbroschur, 275 Seiten, 16.90 Euro
Zeitgeist Verlag, Höhr-Grenzhausen 2018
Renate Schoof lebt als freie Schriftstellerin in Göttingen. Nach einer Ausbildung im Buchhandel arbeitete sie als Dokumentarin bei der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg; anschließend studierte sie Pädagogik und Germanistik und war neun Jahre als Lehrerin tätig. Von ihr erschienen bisher mehr als zwanzig Bücher, u. a. die Romane „Blauer Oktober“ und „Alle Wünsche werden erfüllt“, der Erzählungsband „In ganz naher Ferne“, das Sachbuch „Geheimnisse des Christentums – Vom verborgenen Wissen alter Bilder“ sowie die Kinder- und Jugendromane „W + M = Liebe?“ und „Wiedersehen in Berlin“.
Online-Flyer Nr. 672 vom 05.09.2018
Aus dem Roman "Alle Wünsche werden erfüllt"
Geisterbahn Schule
Von Renate Schoof
 Nach Bettys Tod hatte sie begriffen: Ohne beruflichen Stress wären deren Seele und Körper leichter in ein gesundes Gleichgewicht zurückgekehrt. Der Schulleiter fand für das, was ablief, ein anschauliches Bild: „Wirft man Krebse in kochendes Wasser, springen sie wieder heraus. Befinden sie sich allerdings in einem Topf mit kaltem Wasser, das langsam zum Siedepunkt gebracht wird, verpassen sie den lebensrettenden Moment und lassen sich kochen.“ Vielleicht war das Unsinn. Es irritiert sie, beim Grübeln über die Krankheit Krebs an Hummer und Krebse denken zu müssen. Seinerzeit im Lehrerzimmer fragte niemand nach dem Wahrheitsgehalt des Vergleichs. Alle wussten, der Alltag an ihrer Schule war von Jahr zu Jahr stressiger geworden, und die Belastung hatte längst den Zustand massiver Selbstausbeutung erreicht.
Nach Bettys Tod hatte sie begriffen: Ohne beruflichen Stress wären deren Seele und Körper leichter in ein gesundes Gleichgewicht zurückgekehrt. Der Schulleiter fand für das, was ablief, ein anschauliches Bild: „Wirft man Krebse in kochendes Wasser, springen sie wieder heraus. Befinden sie sich allerdings in einem Topf mit kaltem Wasser, das langsam zum Siedepunkt gebracht wird, verpassen sie den lebensrettenden Moment und lassen sich kochen.“ Vielleicht war das Unsinn. Es irritiert sie, beim Grübeln über die Krankheit Krebs an Hummer und Krebse denken zu müssen. Seinerzeit im Lehrerzimmer fragte niemand nach dem Wahrheitsgehalt des Vergleichs. Alle wussten, der Alltag an ihrer Schule war von Jahr zu Jahr stressiger geworden, und die Belastung hatte längst den Zustand massiver Selbstausbeutung erreicht.Als sie schon in B. lebte, war dieser von allen geschätzte Schulleiter mit akutem Nierenversagen aus der Schule getragen worden. Gunnar hatte ihr das geschrieben, wusste es wer weiß woher. Sie sieht ihn vor sich, den sympathischen, für das Viertel, in dem die Schule liegt, ein bisschen zu feinen Schulleiter. Sie sieht ihn vor sich, wie er auf dem Schulhof mit Akim um ein Fahrrad ringt, das der als Schläger bekannte Viertklässler einem anderen weggenommen hatte. Bevor sie einzugreifen vermochte, war der ältere Bruder des unterlegenen Schülers dazwischengegangen, und der Schulleiter konnte sein Gesicht wahren. Sie war damals aus einer Art Erstarrung, ausgelöst durch die Entscheidungsnot in ihr, erwacht. Hätte sie das Fenster öffnen und Akim beim Namen rufen müssen? Oder gleich die Polizei herbeitelefonieren? Akim, ein Schüler von Betty, der seine Mitschüler bedrohte, quälte, drangsalierte und einschüchterte. Wie oft hatte der Junge dem KOB, dem Kontaktbereichsbeamten, Besserung versprochen, ohne sich zu ändern.
Er war mit seinen zwölf Jahren zu alt für die Grundschule, aber nicht strafmündig gewesen – das eine hatte er gefühlt, das andere gewusst. Akims Vater war meist abwesend, die Mutter hilflos, die ältere Schwester bedrückt.
Betty geriet nie in Entscheidungsnot. Geistesgegenwärtig bewältigte sie die kompliziertesten Situationen. Deprimiert denkt Amelie an Herausforderungen, die die Inklusion für ihre Grundschule mit sich brachte, integrierten sie doch ohnehin ganz selbstverständlich jeden Tag Kinder aus zum Teil schwierigsten Familienverhältnissen. Abgeschreckt durch den hohen Anteil an Schülern, deren Muttersprache nicht Deutsch war, schickten viele Eltern ihre Kinder lieber in anderen Stadtteilen zur Schule, notfalls mit Trick, oder – wenn das Einkommen dafür ausreichte – auf eine Privatschule. Die Entmischung der Gesellschaft schritt voran. Es gab „bessere“ Viertel in der Stadt, in denen vierte Klassen öffentlicher Schulen fast geschlossen zum Gymnasium übertraten.
Fraglos war Betty besser mit Problemen zurechtgekommen als sie und einige andere, aber sie hatte sich dabei zu viel aufgebürdet. Wenn sich alle wegduckten, lud Betty sich die Sache auf, verantwortungsvoll und mit ihrem wunderbaren Lächeln. Nachdem sie Konrektorin geworden war, lag das Handy auf dem Frühstückstisch, wo sie zwischen zwei Schlucken Kaffee die Krankmeldungen von Kollegen entgegennahm. Pünktlich vor Unterrichtsbeginn stand der Vertretungsplan. So war sie gewesen: gewissenhaft, beliebt, unentbehrlich.
Amelie verschränkt die Hände unter dem Kopf. Wie war das eigentlich bei mir?, überlegt sie. Bin ich Lehrerin geworden, weil ich eine glückliche Schülerin war? Sie hat es gemocht, Neues zu entdecken, überhaupt etwas zu lernen, besonders wenn sie sich von Lehrern verstanden und ernstgenommen fühlte. Und das wollte sie an Schüler weitergeben, die Lust am Forschen, das Verstehen von Sachverhalten und das Verständnis füreinander. Empathie als Grundlage jeder Beziehung, das war ihr wichtig. Dass Mitgefühl zu Aufopferung werden kann, hatte sie fast zu spät gemerkt.
Wie gern hat sie Kindern Lesen und Schreiben beigebracht. Vor allem wohl, weil sie es selber als befreiend erlebt hatte, lesend flügge zu werden zu Ausflügen weit über den Horizont der eigenen beschränkten Verhältnisse hinaus. Lesen konnte Sehnsucht erzeugen nach mehr und anderem, konnte Sinn für Gerechtigkeit, Schönheit oder auch Güte und Friedfertigkeit vermitteln.
Gunnars spöttisches Gesicht bricht ein in ihre Erinnerungen an Glücksmomente im Studium und ihre ersten Jahre als Lehrerin. „Dich reizt die Planbarkeit“, hatte er gesagt, und vielleicht war es so. Der Beruf gab nicht nur ihren Tagen, sondern auch ihrem Leben Struktur. „Ordnung und Chaos sind deine Themen“, ein typischer Gunnar-Satz, wenn ihn das Drunter und Drüber in Küche oder Bad nervte. Ja, sie hatte es geliebt, Jahres- und Wochenpläne für die Schüler zu erstellen, Tag für Tag den Unterricht sorgfältig vorzubereiten. Das gab ihr eine Sicherheit, die ihr erlaubte, spontan zu sein und bei Bedarf vom Geplanten abzuweichen. Für Ordnung im eigenen Haus hatte die Kraft nicht ausgereicht.
Aufgetankt hat sie in der Stille ihres Zimmers, beim Korrigieren und bei Vorbereitungen. Ihr wird bewusst, wie sehr sie Ruhe und Sicherheit braucht, um handlungsfähig zu sein. Multitasking ist nicht ihr Ding. Ihre Schülerinnen und Schüler hatten die Atmosphäre der geregelten Ruhe im Klassenraum gemocht, sie wohl intuitiv als entspannend empfunden, als Kontrast zu dem Durcheinander und der beständigen Beschallung zu Hause. Bei Elternbesuchen musste sie darum bitten, den Fernseher auszuschalten. „Wir wollen doch miteinander sprechen“, hatte sie gesagt. „Dazu brauche ich Ihre Aufmerksamkeit.“ Als hätte das Gerät keinen Abschaltknopf, wurde häufig nur der Ton leise gedreht.
Ihre Gedanken kreisen um die Frage, wie lange Selbstausbeutung und Überbelastung auszuhalten ist, bis das „Material“ versagt, seien es die Nerven, die Nieren oder eben die Zellen, die in der Gebärmutter, in der Brust, der Lunge, im Darm oder sonst wo zu wuchern beginnen.
Kolleginnen, die das Problem für sich gelöst haben, tauchen vor ihr auf. Lea zum Beispiel verabschiedete sich innerhalb von sechs Jahren dreimal in Mutterschaftsurlaub, zum Teil mit Elternzeit. Ein gehässiger Satz, mit dem Leas Ehemann bei einem Sommerfest die Schwangerschaft kommentierte, ließ darauf schließen, dass es sich nicht um gemeinsame Familienplanung handelte.
Und bevor Cordula mit Rückenproblemen in Frührente ging, ließ sie sich ein halbes Jahr krankschreiben, um rechtliche Probleme bei der Verrentung und finanzielle Einbußen zu vermeiden. Beim Verteilen der Arbeit auf die anderen Kolleginnen half das wenig, zumal die Behörde keinen Ersatz schickte. Schule als Geisterbahn, denkt Amelie, empfindet wieder ihre Zerrissenheit zwischen Verständnis und dem Widerwillen gegen private Lösungen auf Kosten anderer. Kein Wunder, wenn der Vertretungsunterricht und die personell nicht abgesicherte Inklusion den ohnehin schon anstrengenden Alltag für alle Beteiligten unerträglich werden ließ.
Viola, die Mathematiklehrerin in ihrer Klasse, kam mit abenteuerlichen Entschuldigungen oft erst zur dritten Stunde, gelegentlich mit einem Attest. Es war ein offenes Geheimnis, dass sie trank. Dann war da noch Henry, der immer wieder fehlte, weil er eine kranke Frau und zwei kleine Kinder zu Hause betreute. Offenbar gehörte Betty zu den Krebsen, die nicht früh genug aus dem Kochtopf gesprungen waren. So hatte es ausgesehen, als sie für sich selber die Reißleine zog und sich aus einem Schulsystem beurlauben ließ, in dem Schwangerschaften junger Kolleginnen und Krankheiten älterer Chaos verursachten und Katastrophen heraufbeschworen.
Ohne Beschönigung über den Schulalltag der letzten Jahre nachzudenken hilft ihr, das spürt sie. Damals nahm sie Aggressionen, die sie sich in der Schule nicht zugestand, mit nach Hause. Irgendwo brauchte ihr Frust ein Ventil. Wenn sie mit Gunnar über die benachteiligten Kinder, deren von der Gesellschaft verratene Eltern oder die überforderten, teils desinteressierten Kollegen sprach, sagte er: „Ihr dürft das nicht hinnehmen! Wehrt euch!“ Sie weiß noch, wie gereizt sie darauf reagiert hat. Gunnar hatte ja recht gehabt, so wie er meistens recht hatte. Um aber Forderungen durchzusetzen, braucht es Energie. Und die fehlt, wenn man sich täglich verausgaben muss.
Politiker hielten verlogene Sonntagsreden, und gewerkschaftliche Initiativen, die darauf abzielten, Grundsätzliches zu ändern, liefen ins Leere. Ihrem Schulleiter wurde von der Schulaufsicht sogar Redeverbot erteilt, als er Einwände gegen die Inklusion förderungsbedürftiger Kinder in ihrer Schule, in der ohnehin jeder zweite Schüler Defizite hatte, erhob. Er war mit den Eltern betroffener Kinder für den Erhalt der nahegelegenen Förderschule eingetreten, das hatte die Behörde nicht geduldet.
Erschöpft und alltagsmüde hatte sie ihre Pflichtstunden reduzieren wollen, aber Gunnar war dagegen gewesen. Sie wusste ja selber: Der Kredit für Haus und Grundstück erforderte, dass sie mit voller Stundenzahl weiterarbeitete. Ihm erschien das unausweichlich. Wie er jetzt, ganz ohne sie, mit der Belastung zurechtkommt, weiß sie nicht, und es interessiert sie auch nicht.
Lautes Hundegebell in der Nähe zwingt sie, sich aufzusetzen. Auf dem Weg bemühen sich zwei Frauen, ihre Riesenschnauzer an straffgezogenen Leinen voneinander fernzuhalten. Sie lehnt sich mit dem Rücken an den Stamm ihres Schattenbaums und denkt: Spannend, was da alles hochkommt. Ihr Studium, ihre Wohnsituation, Jakob und die Frauen im Elsa hatten sie in der Gegenwart leben lassen, für einen kritischen Blick auf die Vergangenheit fehlte der Anlass.
Bei der Recherche im Internet hat sie gelesen, Krebs brauche viele Jahre, um auszubrechen. Und bevor Brustkrebs entdeckt werden könne, existiere er bereits mehrere Jahre. Sie begreift, dass die Zellentartung lange vor ihrem Ausstieg entstanden sein kann, in den stressigen Zeiten, die gerade vor ihrem geistigen Auge vorübergezogen sind.
In dem Beitrag stand auch, dass Entzündungen und Infektionen Krebs begünstigen. All die verschleppten Erkältungen, die Nebenhöhlenentzündungen, die kräftezehrende Bronchitis. Selbst mit einer Stimmbandentzündung hatte sie unterrichtet, tagelang Handlungsanweisungen schriftlich in den Heften oder an der Tafel gegeben. Da hatten noch die letzten Freaks in der Klasse begriffen, wie nützlich es ist, lesen und schreiben zu können. Und jetzt? Krebs als Quittung dafür, das Wohl anderer allzu oft über das eigene gestellt zu haben?
Gunnar meinte, sie liebe ihre Schülerinnen und Schüler, er fand das unprofessionell und romantisch. Es stimmte, aber sie konnte nichts dafür. Sie hat mit ihnen gejubelt und gelitten, versucht, die Dur-Stimmung herzustellen, die der Pädagoge Makarenko in seinen Büchern beschreibt. „Ich kann Schule nur ganz – oder gar nicht“, mit diesem Satz hat sie manchmal unfruchtbare Diskussionen beendet.
Wieder vollkommen bei sich und seltsam zufrieden, streckt sie sich auf ihrer Decke aus. In die Blätter zu schauen beruhigt, löst in ihr ein fast meditatives Gefühl aus. Und dass der bösartige Zellschaden, so es ihn gibt, in einer Vergangenheit entstanden sein muss, die sie hinter sich gelassen hat, stimmt sie zuversichtlich, nimmt der furchtbaren Angst ihre Schärfe.
Renate Schoof: Alle Wünsche werden erfüllt

Klappenbroschur, 275 Seiten, 16.90 Euro
Zeitgeist Verlag, Höhr-Grenzhausen 2018
Renate Schoof lebt als freie Schriftstellerin in Göttingen. Nach einer Ausbildung im Buchhandel arbeitete sie als Dokumentarin bei der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg; anschließend studierte sie Pädagogik und Germanistik und war neun Jahre als Lehrerin tätig. Von ihr erschienen bisher mehr als zwanzig Bücher, u. a. die Romane „Blauer Oktober“ und „Alle Wünsche werden erfüllt“, der Erzählungsband „In ganz naher Ferne“, das Sachbuch „Geheimnisse des Christentums – Vom verborgenen Wissen alter Bilder“ sowie die Kinder- und Jugendromane „W + M = Liebe?“ und „Wiedersehen in Berlin“.
Online-Flyer Nr. 672 vom 05.09.2018