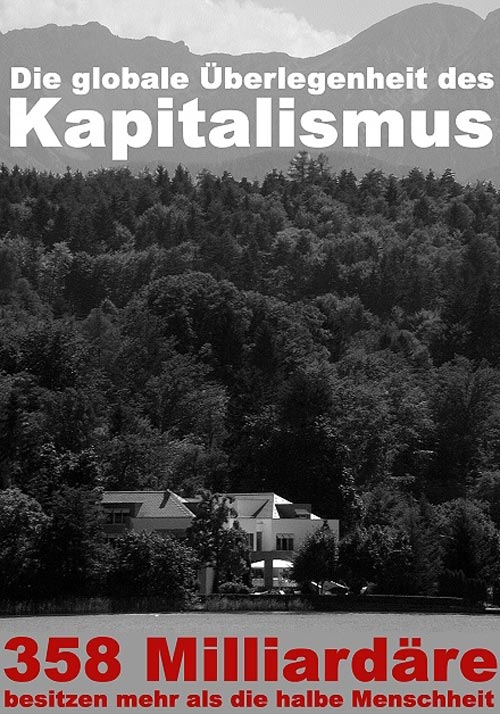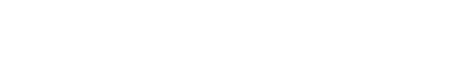SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Literatur
Aus dem Roman "Bitten der Vögel im Winter" (Auszug 3)
Polen, 1942
Von Ute Bales
 Im Zug von Berlin nach Bialystok haben sie das Abteil für sich. Obwohl sich der Herbst schon ankündigt, ist die Luft noch schwer von der Hitze und dem Staub des Sommers. Fräulein Nickel sitzt am Fenster, fächert sich mit einer Zeitung Luft zu. Sie ist erst seit wenigen Wochen dabei und macht auf Eva einen konfusen Eindruck. Sie verwechselt Termine, vertauscht Namen, irrt sich mit Akten und stellt Fragen, über die Eva nur den Kopf schütteln kann. Ihr rundes Gesicht ist erhitzt, die braunen dünnen Haare kleben am Kopf. Für die Reise hat sie alles zusammengetragen, was sie an Informationen finden konnte: „Wir sind jetzt kurz hinter Warschau. Also noch ungefähr 200 Kilometer. Ich war mal als Kind hier und erinnere mich an herrliche Kuchen und an Szaszlyk. Das sind Fleischstücke mit Zwiebeln, Paprika, Pilzen und Speck auf einem Spieß gegrillt oder Pierogi, kleine Maultaschen mit Fleisch- und Quarkfüllung, auch sehr fein. Überhaupt die polnische Wurst, besonders die geräucherte, schmeckt prima mit Bier oder Wodka.“
Im Zug von Berlin nach Bialystok haben sie das Abteil für sich. Obwohl sich der Herbst schon ankündigt, ist die Luft noch schwer von der Hitze und dem Staub des Sommers. Fräulein Nickel sitzt am Fenster, fächert sich mit einer Zeitung Luft zu. Sie ist erst seit wenigen Wochen dabei und macht auf Eva einen konfusen Eindruck. Sie verwechselt Termine, vertauscht Namen, irrt sich mit Akten und stellt Fragen, über die Eva nur den Kopf schütteln kann. Ihr rundes Gesicht ist erhitzt, die braunen dünnen Haare kleben am Kopf. Für die Reise hat sie alles zusammengetragen, was sie an Informationen finden konnte: „Wir sind jetzt kurz hinter Warschau. Also noch ungefähr 200 Kilometer. Ich war mal als Kind hier und erinnere mich an herrliche Kuchen und an Szaszlyk. Das sind Fleischstücke mit Zwiebeln, Paprika, Pilzen und Speck auf einem Spieß gegrillt oder Pierogi, kleine Maultaschen mit Fleisch- und Quarkfüllung, auch sehr fein. Überhaupt die polnische Wurst, besonders die geräucherte, schmeckt prima mit Bier oder Wodka.“
Während sich die Nickel in Rezepten ergeht und von Sauerkraut und Kümmel, Senf- und Meerrettichsoßen schwärmt, sitzt Eva am Fenster, den Kopf an die Zugscheibe gelehnt, und sieht hinaus. Es dauert, bis die Nickel das Thema ändert. „Wussten Sie, Fräulein Justin, dass Bialystok mal preußisch war, dann russisch, dann polnisch? Ich habe mich informiert. Der größte Teil der polnischen Juden hat dort gelebt. Das ist jetzt natürlich anders. Wissen Sie, dass es im Ghetto einen Judenrat gibt?“ Bisher hat Eva nur mit halbem Ohr zugehört, aber jetzt, wo die Nickel von Judenräten anfängt, wird sie aufmerksam. „Was wissen Sie denn schon über Judenräte?“ Die Nickel zieht die Augenbrauen hoch und hebt die Stimme. „Judenräte erhalten ihre Befehle von der SS. Sie befassen sich mit Bevölkerungsverzeichnissen, mit der Lebensmittelversorgung, mit Beerdigungen, auch mit dem Gesundheitswesen. Das muss ja alles organisiert sein. Sie sind auch verpflichtet, Arbeitskräfte zu liefern. Ja, stellen Sie sich vor, sie helfen bei den Evakuierungen in die Arbeitslager.“ Dann kichert sie und fügt hinzu: „Sie helfen also bei den eigenen Evakuierungen. Damit wird Personal eingespart. Einige werden ihre Positionen ganz schön ausnutzen und sich bereichern. Oder meinen Sie nicht?“ „Wer sagt das?” „Das hört man so.“ Eva weiß nicht, was sie zu diesem Gerede sagen soll. Die Fahrt macht träge und sie sieht wieder aus dem Fenster. Es dauert einen Moment, dann fängt Fräulein Nickel an in ihrer Tasche zu kramen und fragt: „Den Juden wird doch alles weggenommen, wenn sie ins Lager kommen, oder? Das müssen doch Berge von Sachen sein.“ Eva setzt sich aufrecht. Wie die Nickel redet? „Berge von Sachen sind es sicher nicht. Was sie haben, behält das Reich. Das ist ja auch nicht mehr als recht. Die Lager kosten schließlich auch was. Unterkunft, Essen, alles das. Auch der Transport. Oder glauben sie, die kaufen sich ne Fahrkarte? Was glauben Sie eigentlich?“ „Aber es ist doch eine Enteignung, oder?“ „Eine Enteignung ist im Falle eines Juden kein Diebstahl.“
Demonstrativ dreht sich Eva nach dem Fenster. Sie hat keine Lust, sich weiterhin solche Fragen anzutun. Ihr Blick geht wieder über die Landschaft, über die Hügel. Bussarde kreisen unter den Wolken. Entrückt und fern schweben sie in einer von einem Dunstschleier verhüllten Höhe. Sie kreisen und kreisen. Hin und wieder glaubt Eva ihr Gickern zu hören. Zuvor hat sie Wildgänse gesehen, einen schnatternden Schwarm, der sich keilförmig, ein Leitvogel an der Spitze, in Richtung Osten bewegt hat. Wie weit der Blick wohl sein muss, von so weit oben, denkt sie.
Die Nickel sagt nichts mehr, döst vor sich hin.
Die Fahrt ist eintönig und lang. Auch die Landschaft. Heckenumsäumte, spätsommerliche Wiesen, abgeerntete Felder, Waldstücke, manchmal Dörfer. Im Zug ist es unruhig. Auf jeder Station steigen Leute zu. Ständig poltert jemand durch den Waggon. Im Gang müssen immer zwei oder drei Leute aufstehen, um Platzsuchende durchzulassen. Der herbe Geruch schwitzender Körper mischt sich mit Zigarettenrauch. Auch Eva schwitzt. Besonders unter den Achseln. Hoffentlich gibt das keine Ränder auf der Bluse.
Sie versucht, die Ortschilder zu lesen. Manche Schilder tragen deutsche Namen. Die anderen kann sie nicht aussprechen.
Je weiter sie nach Osten kommen, desto trostloser werden Gegend und Wetter. Dunst hängt über den gefiederten Silhouetten der Wälder, verschluckt Dörfer, Häuser, Menschen. Es ist ein zäher Dunst, der in den Augen schmerzt, über dem Boden schwebt und bis Bialystok nicht aufhört. Hier und da ragen Kiefer- und Birkenwälder aus dem Weiß. Manchmal sind es Fabriken mit hohen Schornsteinen, die das Bild verschandeln.
Dr. Sophie Ehrhardt ist mit einem früheren Zug gekommen und wartet bereits auf dem Bahnsteig. Sie sieht streng aus mit den mit zwei Kämmen festgesteckten hellen Haaren und der schwarzgeränderten Brille. Ihr Rock ist zerknittert von der langen Fahrt. Winkend und mit Gepäckstücken beladen kommt sie den beiden Frauen entgegen. „Gut, dass es endlich Verstärkung gibt“, lacht sie und drückt Eva und Fräulein Nickel die Hand.
Sophie Ehrhardt ist Eva noch aus der Tübinger Zeit vertraut. Sie kennt sich aus, hat mit ihren Arbeitsgruppen monatelang tausende Zigeuner in Ostpreußen erfasst. Außerdem hat sie sich in ihrer Doktorarbeit mit Ameisenarten befasst. Sie ist sich sicher, in Bialystok einige der Abgeschobenen wiederzusehen. Eva erinnert sich an Abdrücke von Gesichtern, die die Ehrhardt bei ihrem letzten Besuch in Berlin im Gepäck hatte. Zwei Männerköpfe. Schöne Männer. Jemand hatte ihre Namen in den Gips geritzt: Albert und Johannes Bock.
Die Ehrhardt geht strengen Schrittes voran. Ihre genagelten Schuhe klacken auf dem Pflaster. Ein wortkarger Uniformierter holt sie ab, bringt sie zu einem Feldfahrzeug, mit dem er sie durch die Stadt fährt. Ein barockes Rathaus und ein imposanter Dom liegen auf dem Weg. Schön gestaltete Fassaden von Bürgerhäusern fallen auf.
An beiden Flussseiten reihen sich Fabrikanlagen aneinander. Graue Industriebauten sind es, dahinter Stoppelfelder und Brachland, kleine Gehöfte, Mietskasernen, an denen der Putz abblättert, alte Holzhäuser. Die Stadt kommt Eva entrückt und irgendwie verschwommen vor. Der Uniformierte stoppt den Wagen an einer Bushaltestelle am Stadtrand und lässt die Frauen aussteigen. Mit Händen und Füßen erklärt er ihnen die Richtung, gestikuliert und wiederholt immerzu die gleichen Worte, die niemand versteht. Dann steigt er in seinen Wagen, wendet und fährt zurück.
Alles ist schmutzig und heruntergewirtschaftet. Irgendwo blöken Schafe. Händler stehen am Wegrand. Zerlumpte Männer mit schwarzen Zähnen handeln mit Holz; Frauen mit Kopftüchern preisen dürftiges Knollengemüse an. Schmuddelige Kinder streichen um die Frauen herum, kommen näher, zupfen an Evas Mantel, jammern und bitten mit den Augen. Eva droht mit den Händen, tut so, als wolle sie sich eines der Kinder greifen. Da rennen sie kreischend auseinander.
Die Frauen folgen einem Weg mit löchrigem Pflaster, in dessen Vertiefungen Pfützen stehen. Ein Stück geht es an einem Zaun entlang, der neben einem zertrampelten Pfad verläuft, dessen Erde fast schwarz ist.
Das Gefängnis liegt am Fluss, inmitten einer unüberschaubaren Landschaft aus Erdhügeln und verwildertem Gestrüpp, und ist mit Holz- und Stacheldrahtzäunen abgeriegelt. Zwei Wachsoldaten mit Hunden und geschulterten Gewehren warten an einer Rampe. Einer schnäuzt sich die Nase, indem er mit bloßen Händen erst eins, dann das andere Nasenloch zudrückt und den Schleim auf den Weg rotzt.
Ein Aufseher in einer abgetragenen Uniform empfängt sie hinter einem Eisenportal, überprüft ihre Ausweise und salutiert. Er ist gedrungen und kurzbeinig, hat eine Stirnglatze. Eine Narbe zerteilt die linke Gesichtshälfte. Wenn er spricht, blitzt ein Goldzahn. Er stellt die Frauen zwei weiteren Mitarbeitern vor, von denen sich einer anbietet, ihnen das Gebäude zu zeigen. In schlechtem Deutsch mit stark polnischem Akzent erkundigt er sich nach der Reise und bringt sie in einen kahlen, weißgetünchten Raum, eine Art Küche mit einem Spülstein und einem Herd. Ein Tisch ist gedeckt. Eine Frau in Sträflingskleidern wischt sich die Hände an der Schürze ab und beginnt auf Zuruf des Aufsehers mit hektischen Bewegungen und knochigen Fingern Kaffee zu kochen.
„Wie viele sind hier untergebracht?“, will Eva wissen. Die Auskunft des Aufsehers ist ausweichend. „Zu viele. Hauptsächlich Ostpreußen. Massenhaft Zigeuner. Ein paar Funktionäre der Bolschewisten sind auch dabei.“ Sie setzen sich an den Tisch. Die Frau bringt Brote mit Schmalz, stellt eine dampfende Kanne auf den Tisch und verteilt Tassen. Die Ehrhardt greift als erste nach den Broten. „Also, wenn Sie mich fragen“, sagt sie und wirft Eva einen vielsagenden Blick zu, „hier gibt es nur Kriminelle.“
Später zeigt der Aufseher, der sich inzwischen als Kommandant vorgestellt hat, den Frauen den Hof und einen Teil des Gebäudes, in dem die Gefangenen untergebracht sind. Obwohl es draußen kühl ist, brütet innen die abgestandene Luft verschwitzter, verdreckter Körper in überfüllten Räumen. Von oben bis unten wird Eva fixiert. Mindestens zwölf Augenpaare aus dunklen Gesichtern verfolgen jeden ihrer Schritte. Die Pritschen stehen dreistöckig. Einen eigenen Schlafplatz hat niemand. Kleidungsstücke hängen an Nägeln an den Wänden. Vor einem vergitterten Fenster steht eine Waschschüssel mit stinkendem Wasser.
Die meisten Zellen sind leer, die Gefangenen bei der Arbeit. Nur zerlumpte Frauen mit notdürftig bekleideten Kindern sind übrig. Sie liegen zusammengekauert auf dem nackten Boden. Manche haben etwas Stroh unter sich. Eine der Frauen liegt auf einer schmutzstarrenden Steppdecke, hebt die gefalteten Hände bis über den Kopf und bettelt um Brot. Ihr Stöhnen hallt wider, schwillt an, flutet auf und ab, vermischt sich mit anderem Wimmern und Winseln. Die Kinder haben alles Kindliche eingebüßt. Eva versucht ihr Alter zu schätzen, aber das ist unmöglich. Die Haut ist gelb, die Augen sind riesig vor Hunger.
Die Zellen sind wie Pferdeställe. Eine Gefangene streckt ihre Hand aus dem Gitter. Ein Kauderwelsch aus Jiddisch und Romanes prasselt auf die Frauen nieder. Andere sitzen abgestumpft und teilnahmslos herum, heben nicht einmal den Kopf, als Eva ans Gitter klopft. Der ekelhafte Gestank nach Exkrementen und Erbrochenem, der aus ihren Kleidern strömt, nimmt Eva fast den Atem. Alles ist voll von diesem Gestank.
Eva sieht, wie Fräulein Ehrhardt schluckt. Sie selbst versucht durch den Mund zu atmen. „Ja, die Luft hier ist nicht auszuhalten“, klagt der Kommandant, der Evas Blick bemerkt hat, „aber das ist wegen der Enge hier. Wir haben absolut keinen Platz mehr. Inzwischen teilen sich mehrere Familien eine Zelle. Hoffentlich kommen bald welche weg. Es sind einfach zu viele.“ Er seufzt und wiederholt: „Hoffentlich.“
Eva drängt wieder hinaus. Zu stickig ist die Luft. „Und das Essen? Was kriegen sie zu essen?“ Dem Kommandanten behagen Evas Fragen nicht. Er verzieht das Gesicht, wobei sich der Haarstummel unter der Nase, den er dem Führer abgeguckt hat, merkwürdig verformt. „Was sollen sie schon kriegen? Ist ja schließlich keine Erholungsanstalt.“ Sie kommen an einer Zelle vorbei, in der mindestens zwölf Personen eingepfercht sind. „Sehn Sie, wie dreckig die sind. Voller Läuse und sonst was. Wir bräuchten strengere Regeln. Sonst wird es noch schlimmer. Sie lügen und stehlen, obwohl sie genau wissen, dass sie, wenn sie erwischt werden, wegkommen.“ Sie gehen entlang eines langen Flures. Alle paar Schritte wird ein Eisentor geöffnet und sobald sie durchgegangen sind, wieder verschlossen. „Die Sie hier sehen, sind weitaus gefährlicher als Juden. Alles Zigeuner. Alles Spione. Ein richtiges Nest hier. Sie arbeiten für die Partisanen. Auch für Juden und Bolschewiken. Man kann sie nicht durchschauen. Keiner kann das. Sie übertragen Krankheiten, sind voller Krätze, Läuse, Dreck. Man müsste sie ausräuchern.“
Sie gelangen in ein Nebengebäude, den Krankenbau des Lagers. Der Kommandant übergibt die Frauen an eine Häftlingsärztin und verabschiedet sich. Die Ärztin sieht aus, als ob sie nächtelang nicht geschlafen hat. Das noch junge Gesicht ist kalkweiß, tiefe Schatten liegen unter den Augen. „Wir wissen nicht, wie es hier weiter gehen soll“, sagt sie in gebrochenem Deutsch und streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. „Das ist alles zu viel. Zu viele Tote. Und wir können nichts machen. Eigentlich habe ich gar keine Zeit, Sie herumzuführen.“ Dennoch zieht sie den Kittel aus, hängt ihn über einen Stuhl. „Kommen Sie. Folgen Sie mir.“
Die Ärztin führt sie über einen langen grauen Flur, eine Treppe hinauf, auf die Kinderstation. In einem grau getünchten Krankensaal liegen an die dreißig Kinder auf Holzpritschen, zugedeckt mit fleckigen Leintüchern. Auch hier stehen der Brodem von Wunden und das Ausgeatmete zäh in der Luft. Der scharfe Geruch nach Urin mischt sich mit dem Angstgeruch der Kinder, dem Schweiß aus ungewaschenen Betten und Kleidern, den Ausdünstungen von käsigen Füßen, dem süßlichen Hauch eiternder Wunden, der Gestank von Fäkalien.
Die Kinder sind nur noch Haut und Knochen, völlig ohne Muskeln. Ein Junge kann sich kaum noch bewegen. Er wimmert vor Schmerzen. Seine dünne pergamentartige Haut scheuert an den harten Kanten des Skeletts durch, wo sie rot und entzündet ist. Bei fast allen Kindern bedeckt Krätze den Körper. Narben entstellen die Gesichter, Geschwüre ziehen sich über Münder, zerfressen die Haut, bohren sich bis auf das Zahnfleisch, höhlen Kiefer aus und durchlöchern Wangen. Sie gehen von Pritsche zu Pritsche. Die Kinder liegen da, teilnahmslos und apathisch. „Zuerst haben wir gedacht, dass es Typhus ist. Wir haben deshalb schon einige abtransportieren lassen.“ „Und? Wissen Sie inzwischen, was es ist?“ „Ja. Es ist Noma, Wasserkrebs“, erklärt die Ärztin, „eine Art Hungerseuche. Die Krankheit entsteht durch Mangel, also durch Unterernährung. Es ist eine bakterielle Erkrankung, zwar nicht ansteckend, aber leider tödlich. Sie zerfrisst innerhalb von zwei Wochen das Gesicht. Das fängt ziemlich harmlos an: mit Zahnfleischbluten und Mundgeruch. Dann entstehen harte Knoten auf der Mundschleimhaut. Sie entzünden sich, breiten sich über Wangen und Lippen aus. Das Gesicht schwillt an, Fieber und Schmerzen treten auf. An den betroffenen Stellen bildet sich Eiter und zersetzt das Gewebe. Bis in die Augenhöhlen kann das gehen. Die Verstümmelungen sehen Sie ja.“ Sie bleibt vor einem der Krankenlager stehen und zeigt auf einen Jungen, dem das halbe Gesicht fehlt. Schwarze Fliegen aasen am Mund des Kindes, fressen am eitrigen Schorf. Eva muss schlucken, so stark ist der Geruch seiner Wunden. „Was tun sie dagegen?“ „Wir können nur wenig tun. Mundspülungen zum Beispiel. Die Nahrung müsste besser werden. Und die Hygiene. Damit könnten wir die Lage verbessern. Die Kinder haben große Schwierigkeiten beim Essen und Sprechen, auch beim Atmen. Sie sterben an Blutvergiftung oder verhungern. Wenn die Kieferknochen schrumpfen, kommt es bei manchen zu einer Kieferklemme. Das heißt, die Kinder können den Mund nicht öffnen und keine Nahrung aufnehmen. Sie sterben. Vor kurzem ist ein Kind an Erbrochenem erstickt. Aber es sind nicht nur Kinder, Erwachsene haben das auch.“
Beim Essen in der Lagerkantine sind sie sich einig, dass sich die hygienischen Zustände verbessern müssen. Auch für frische Kleidung wollen sie ein Wort einlegen, vor allem für Unterwäsche. Und für bessere Nahrung. Die Ehrhardt macht Notizen für einen Bericht. Später sehen sie zu dritt Namenslisten und Akten durch, durchforsten sie nach sozial Angepassten. Aber es sind weniger als eine Handvoll Familien, die zu den guten Zigeunern gehören. Hinzu kommen ein paar fragliche Kandidaten, die sie sich ansehen wollen.
Die Aussortierten werden auf einer speziellen Liste eingetragen, die Fräulein Nickel noch am Abend dem Kommandanten übergibt. Manche der Namen sind angekreuzt, andere unterstrichen. Alle die ein Kreuzchen bekommen haben, werden auf den nächsten Tag in eine provisorisch eingerichtete Schreibstube einbestellt.
Am anderen Morgen, weit vor dem Frühstück, stehen sie schon in einer langen Schlange vor den Baracken. Ihre Gesichter sind grau und eingefallen. Zwei Aufseher mit Hunden stehen seitlich. Sie haben Gewehre geschultert und tragen Abzeichen an der Brust. Die Hunde bellen. Sie sind gut genährt und muskulös.
Einen nach dem anderen nehmen sie sich vor. Eva und Fräulein Ehrhardt übernehmen die Gespräche, Fräulein Nickel protokolliert.
Die erste, die die Schreibstube betritt, ist eine Frau in Evas Alter. Anders als die anderen hat sie helle Haut und helle Haare. Eva erschrickt. Nie zuvor hat sie einen Menschen gesehen, der ihr so ähnlich ist. So wie sie, so hat auch diese Frau von hellen Adern durchzogene Arme, eine fast durchsichtige Haut, eine ovale Gesichtsform mit einer leicht gebogenen Nase, fast unsichtbare Augenbrauen, dünne Haare von unklarer rötlichbrauner Farbe und schmale, blasse Lippen. Sogar die Hände sind ähnlich. Es sind plumpe Hände mit sehr kurzen Fingernägeln. Alles das nimmt Eva wahr, auch den scheuen Blick, die unsicheren Bewegungen. Nahezu unerträglich ist das. Am liebsten würde sie der Frau die Ähnlichkeit austreiben. Wie eine Anmaßung kommt ihr das vor. Was, wenn das gar keine Zigeunerin ist? Der Gedanke hält sich nicht, eine Antwort kann sich nicht bilden, zu schnell ist die Idee wieder verflogen. „Wieso sind Sie so hellhäutig?“, will Eva wissen und blättert in den Unterlagen, die ihr die Kommandantur überlassen hat.
Die Frau zuckt mit den Schultern. Eva fragt nach Herkunft und Eltern. Die Frau antwortet mit leiser Stimme. Eva muss genau hinhören. Dass sie aus Dresden kommt, erzählt sie, der Vater habe Geigen gebaut und Geigenunterricht gegeben. Sie selbst sei eine Sängerin und mit dem Vater in großen Städten und noblen Etablissements aufgetreten. „Wahrscheinlich im Adlon, in Berlin“, spöttelt Eva, grinst nach Fräulein Ehrhardt und sagt: „Sie sind ja alle was ganz Besonderes.“ Die Frau nickt. „Im Adlon sind wir wirklich aufgetreten. Mein Vater ist bekannt mit Louis Adlon.“ Eva ist nie im Adlon gewesen. Sie braucht diesen Luxus nicht. Aber dass diese abgemagerte Frau in einem der luxuriösesten Hotels des Reichs aufgetreten sein soll, lässt ihre Anteilnahme sofort auf den Nullpunkt sinken. „Geht es nicht noch höher? Noch feiner? Noch besser?“ Sie notiert, was ihr auffällt. Die Frau erschrickt, will etwas sagen, aber Eva lässt ihr keine Zeit und fährt dazwischen: „Keine weiteren Lügen mehr!“ Überheblich und anmaßend schreibt sie auf das Blatt. Dann fällt ihr ein, dass dieses Verhalten ein klares Anzeichen für einen Bastard ist. Wieso sonst hat die Frau auch so helles Haar und so ungewöhnlich helle Haut? Eva flüstert mit der Ehrhardt. Sie kommen zum Schluss, dass hier keine Rassenreinheit vorliegen kann. Die Frau wird nicht weiter gefragt. Eva lässt sie abführen und macht ein Kreuzchen in die Zeile „Verbleib in Bialystok.“
Die zweite Frau, die hereingelassen wird, ist etwas älter und sieht aus wie viele in Marzahn: zerlumpt und verdreckt. Sie fängt schon an zu schreien, da hat sie kaum den Raum betreten. „Sie haben uns versprochen, wenn wir nach Polen kommen, bekommen wir einen Bauernhof, ein Stück Land und etwas Vieh. Lügen waren das. Stattdessen haben sie uns auseinander gerissen, die ganze Familie, und ins Gefängnis geprügelt. Meinem Mann haben sie die Zähne ausgeschlagen. Meine Nichte haben sie gestohlen. Sie haben sie an den Haaren fortgezogen. Ich habe gedacht, sie reißen ihr den Kopf ab. Neun Jahre war sie alt.“ „Niemand stiehlt Kinder.“ „Oh doch, das tun sie. Sie brauchen die Kinder für die Ärzte. Sie machen Versuche mit ihnen, Gott weiß was für Versuche, und dann werfen sie sie weg. Das Ännchen kommt nie mehr zurück, ich weiß es.“ Die Frau schlägt die Hände vors Gesicht und schluchzt. „Drei Monate sind wir jetzt hier. Wir sind 13 auf einer Zelle. Zusammengepfercht wie Tiere.“ Fräulein Ehrhardt will die Sache unterbrechen. „Das wollen wir gar nicht wissen.“ „Doch, doch“, bestimmt Eva, „lassen Sie sie ruhig reden.“ Die Frau verstummt einen Moment, legt das Gesicht in Falten, sieht von einer zur anderen und nickt. „Es ist schrecklich. Alle hungern. Jeden Tag gibt es Tote. Ich habe zwei Tage Rücken an Rücken mit einem toten Mädchen geschlafen. Ein junges Mädchen war das. Sie ist vor Hunger gestorben. Keiner hat nach ihr gesehen. Die Männer werden auch wie Vieh behandelt. Morgens, wenn es noch dunkel ist, werden sie abgeholt und zur Arbeit getrieben. Sie bauen Straßen, Bunker oder Lager. Nachts kommen sie zurück. Sie arbeiten ohne Pause. Wir werden auch geprügelt. Aber das Schlimmste ist: Sie töten uns! Sie töten uns! Alle sind krank. Haben Hautausschläge und was sonst noch alles. Und dann diese schreckliche Krankheit. Fast alle haben das. So viele sind schon tot davon. Wenn ihr nichts tut, sterben wir!“ Die Frau scheint keine Angst zu haben. Sie fuchtelt mit den Händen in der Luft herum und beschwört die Gottesmutter und alle Heiligen. Die Ehrhardt bringt es fertig, das Gejammer zu unterbrechen. „Wenn du raus willst, gibt es nur einen Weg.“ Abrupt hört die Frau auf und sieht Fräulein Ehrhardt mit großen Augen an. „Welchen?“ „Wir können was machen, dass du keine Kinder mehr bekommst“, erklärt Eva, „wenn du es machen lässt, kommst du raus.“ Die Frau stutzt, dann hebt sie die Arme und fängt an zu kreischen. „Das habt ihr schon mit meiner Schwester gemacht! Jetzt ist sie keine Frau mehr! Nur noch ein nutzloses Tier. Wie ein Baum, der keine Früchte trägt. Kinder bedeuten Glück! Ohne Kinder haben wir kein Glück! O Maria voll der Gnade, hilf mir … Ohne Kinder? Das geht doch nicht! Dann könnt ihr uns ebenso gut töten.“ Eva muss eisern durchgreifen, damit die Frau mit ihrem Lamento aufhört. Sie schiebt ein Formular über den Tisch, tippt mit dem Finger auf die Linie, die für die Unterschrift vorgesehen ist. „Hier unterschreiben. Mit vollem Namen. Dann gehts zum Arzt und mit etwas Glück bald raus hier.“ Die Frau geht einen Schritt zurück. Sie sieht auf das Papier wie auf etwas Drohendes. „Das ist ein Vertrag mit dem Teufel!“ Sie hebt erneut die Arme, um wieder in Jammern auszubrechen. „Ja oder nein?“, fragt Eva und macht Anstalten, das Formular wieder an sich zu nehmen, „wenn du nicht unterschreibst, bleibst du hier oder kommst in ein richtiges Lager!“ Da spuckt die Frau auf das Blatt, tritt nach dem Polizisten, der sie unterm Arm packt und hinauszerrt. „Ihr behandelt uns wie Dreck!“, schreit sie, „wir wissen schon, wir sollen uns nicht vermehren! Aber wenn es uns Zigeuner nicht mehr gibt, dann gibt es keine Freiheit mehr! Auch für euch nicht!“
Die Nächste, die hereinkommt, hat einen verkrüppelten Fuß. Sie heuchelt Magenschmerzen, um die Freiheit zu erlangen und knetet dabei nervös die Hände. Eva durchschaut das Spiel und ruft den Polizisten. Im letzten Moment unterschreibt die Frau das Formular.
Dann schleppt sich ein Mann auf Stöcken herein. Beide Beine scheinen lahm zu sein, denn er zieht sie hinter sich her, als ob sie nicht zu ihm gehören. Es ist ein mürrischer Alter mit grauem, hängenden Schnurrbart, der an den Spitzen gelb vom Schnupftabak ist. Er hat eine verschwommene Tätowierung auf dem Handrücken. Seine Augen sind entzündet und rot. Trotz seiner Schwächen wirkt er bedrohlich. Er hört sich an, was Eva zu sagen hat. Als sie fertig ist, knöpft er seine Jacke auf und trommelt mit behaarten Fäusten auf seiner entblößten, vernarbten Brust herum. „Da, sehen Sie nur hin! Alles voller Narben! Ich war für euch im Krieg und jetzt schlagt ihr uns, schindet uns! Nehmt uns alles. Geld, Ausweise, Wertsachen, alles. Wir wissen, was ihr mit uns vorhabt. Täglich gibt es Zigeunertransporte. Ihr wollt uns ausrotten. Wir sollen uns nicht vermehren. Dafür sollen wir unser Kreuzchen unter euern Brief setzen und wenn wir das nicht tun, tötet ihr uns. Aber das tut ihr sowieso, ob wir das Kreuzchen machen oder nicht. Heimlich macht ihr das, im Krankenlager, mit der Mulo-Spritze*. (*Todesspritze) Uns geht es wie den Juden. Aber euch wird es auch mal so gehn, genau wie uns!“ Bei den letzten Worten geht er auf Eva zu und sieht ihr fest in die Augen. „Ihr betrachtet uns wie Vieh! Macht euch nicht mal die Mühe, uns richtig zu erschießen. Ihr schießt und werft dann eine dünne Schicht Erde drüber. Ich habs gesehen! Wisst ihr, dass sich diese dünne Schicht noch stundenlang bewegt? Wisst ihr das? Für das, was ihr tut, sollte man euch die Bäuche aufschlitzen!“ Ein Polizist greift ihn und zerrt ihn hinaus. Eva macht ein Kreuz in der Spalte `Lager´ und notiert: Politisch gefährlich.
Die Männer, die dem Alten folgen, fertigt sie schnell ab. Nur für die jungen Frauen nimmt sie sich Zeit. Jeder erklärt sie geduldig, um was es geht. Auf manche muss sie beruhigend einreden. Bevor die Frauen unterschreiben, sind die Fragen immer gleich: „Ist es wahr, dass wir rauskommen, wenn wir den Eingriff machen lassen? Kommen wir dann wirklich frei?“ „Ja, wir brauchen nur eine Unterschrift. Sie müssen nur diese Erklärung unterschreiben.“ „Und unsere Kinder? Kommen die auch frei?“ „Das muss noch entschieden werden. Auf alle Fälle verbessern sich die Chancen für eure Kinder. Mütter müssen nur für ihre Kinder mitunterschreiben.“ „Und wann kommen wir raus?“ „Sofort nach dem Eingriff.“ „Und dann kommen wir wirklich raus?“ „Es kann ein bisschen dauern, aber dann dürft ihr raus. Und heiraten.“
Eine Schwangere sorgt dafür, dass Eva aus der Haut fährt. Sie ist mindestens im sechsten Monat. Der Bauch tritt deutlich hervor. Eva hat keine Ausdauer mehr für lange Erklärungen. „Wie viele Kinder hast du?“ „Zwei.“ „Das ist also das dritte?“ Eva deutet auf den Bauch der Frau. „Ja.“ „Also, du kannst wählen: Lager oder Abtreibung.“ Die Frau schlägt die Hände vor das Gesicht. „Aber das könnt ihr doch nicht tun! Ihr könnt mir doch das Kind nicht nehmen. Ich kann es schon spüren! Es bewegt sich … Das dürft ihr nicht!“ Eva hält das Gejammer kaum noch aus. Ständig klingen Roberts Worte in ihrem Ohr: Wir müssen sie daran hindern, sich fortzupflanzen. Die Frau vor ihr ist eindeutig dabei, sich fortzupflanzen. Unerbittlich blitzen Evas Augen. „Du hast schon zwei Kinder. Das reicht. Also Abtreibung, dann Lager“, entscheidet sie, ruft nach einem Aufseher, der die kreischende Frau aus dem Raum zerrt. Alle Kräfte muss er aufbringen, als die sich am Türrahmen festkrallt, nach dem Aufseher spuckt und markdurchdringend schreit: „Ihr könnt mir doch das Kind nicht nehmen! Ihr seid Mörder! Mörder!“
Die Frau hinter ihr, mit einer undurchdringlichen Mähne krauser Haare, die Augenbrauen zwei Striche, sieht, wie die Schwangere über den Flur geschleift wird. Sie fixiert Fräulein Ehrhardt mit wildem Blick und gellt mit vor Anstrengung verzerrter Stimme: „Sie hat recht! Ihr seid Mörder! Kindermörder!“ Sie schreit, schreit, schreit. Gebärdet sich wie ein Tier. Eva lässt sie abtransportieren. Das Urteil lautet: Lager.
Ein Mann kommt herein. Sein Gesicht ist voller Ausschlag, auch die Hände. Er beklagt sich, wie mit ihm umgegangen wird. „Ich war im Krieg, hab für Deutschland meinen Kopf hingehalten. Sogar ne Auszeichnung hab ich bekommen. Und jetzt? Als Lohn bekomme ich das.“ Er greift sich zwischen die Beine. „Jetzt krieg ich alles rausgeschnitten! Ausrotten wollt ihr uns, wir wissen es längst. Wir kommen hier nicht mehr raus. Ob wir unterschreiben oder nicht. Und deshalb unterschreibe ich nicht!“ „Dann eben Lager“, entscheidet Eva und ergänzt die Liste. Der Mann kommt gefährlich an Eva heran. Seine Schultern beben, Lider und Nasenflügel zittern. „Verflucht sollt ihr sein! Ja, verflucht, ihr alle! Keinen Frieden sollt ihr mehr finden, jetzt nicht und auch nicht in der Ewigkeit!“ Wieder müssen Aufseher eingreifen. Sie zerren den Mann an den Armen, treten ihm in den Rücken, dann, als er auf dem Boden liegt, ins Gesicht. Seine Lippe platzt auf, Blut sprudelt. Mit Fußtritten bugsieren sie ihn hinaus.
„Jetzt sind wir also verflucht“, lacht Eva, als sie wieder allein sind, „als ob sie das könnten, diese Scharlatane.“ Mit dem Kinn deutet sie auf die Liste, die vor Fräulein Ehrhardt auf dem Schreibtisch liegt. „Wie viele noch?“ „14.“ Eva seufzt. „Also noch 14 Mal das gleiche Geleier.“ Fräulein Nickel sagt gar nichts, sitzt nur da und schreibt Protokolle.
Die meisten unterschreiben, sind gleichgültig. Sie weinen nicht, schreien nicht, nicken zu allem, was Eva sagt, halten den Kopf gesenkt, die Sträflingskappe in der Hand. Sie unterschreiben oder kritzeln Kreuze unter die Einwilligung. Sie unterschreiben auch den Hinweis, dass sie bei verbotener Rückkehr nach Deutschland in ein Lager kommen. Wie Lämmer, die man zur Schlachtbank führt, kommen sie Eva vor mit ihren gequälten Augen und den unterwürfigen Blicken. Wie Tiere.
Ute Bales: Bitten der Vögel im Winter

Roman, Rhein-Mosel-Verlag, Zell, 2018, 410 Seiten, Hardcover, 22,80 Euro
Pressetext zum Buch
Es braucht Mut, einen Roman aus der Perspektive einer NS-Täterin zu schreiben und Ute Bales ist mehrfach gewarnt worden. Sie hat es trotzdem getan und beschreibt in ihrem neuen Werk „Bitten der Vögel im Winter“ ein tiefdunkles Kapitel der deutschen Geschichte, über das bis heute weitgehend geschwiegen wird. Es geht um die Verfolgung der Sinti und Roma und es geht um Eva Justin, eine der bekanntesten „Rassenforscherinnen“ zur Zeit des Nationalsozialismus.
Es ist ein aufwühlender Roman, der kontrovers diskutiert wird. Die Hauptfigur, Eva Justin, ist grotesk, widersprüchlich, ungeheuerlich. Ute Bales erzählt von Selektionen in Jugendgefängnissen, von nächtlichen Übergriffen auf Lagerinsassen, von Kinderspielen, die über Leben und Tod entscheiden. Eva Justin ist keine Phantasiefigur. Sie bewegt sich auf einem gut recherchierten, historischen Terrain. Orte und Personen, die unfassbaren Verbrechen und die damit verbundenen administrativen Vorgehensweisen hat es wirklich gegeben. Historische, politische und psychologische Ebenen verschmelzen: Was ist der Mensch und warum wird er zum Täter?
Eva Justin wurde im Kaiserreich geboren. Ute Bales schildert deren Kindheit, die strenge Erziehung und den schon früh auffälligen Drang, alles zu sortieren und zu ordnen. Hier mögen die Wurzeln liegen für ihre spätere monströse Aufgabe im Nazi-Reich.
Als junge Frau nimmt Justin an einem Lehrgang für Krankenschwestern in Tübingen teil und lernt dort Dr. Robert Ritter kennen, Oberarzt mit besten Karriereaussichten, verheiratet. An Ritter ist nichts zufällig, nichts nebensächlich. Sie ist bereit, als er fragt, ob sie seine Arbeit unterstützen will. Saubere Menschen sind sein Ziel. Eine „Rasse“ ohne Makel. Von Anfang an teilt Justin seine Lust zu forschen, unterstützt seine Arbeit und geht bald eine Beziehung mit ihm ein, die in ein sexuelles Abhängigkeitsverhältnis führt, das als Analogie der Abhängigkeit der Deutschen zu Hitler gelesen werden kann. Konsequent tut Justin das, was Ritter sagt, hinterfragt nichts, sieht weg, wo es heikel wird, verbeugt sich vor jedem seiner Worte.
1936 folgt sie ihm nach Berlin, wo er zum Leiter der „Rassenhygienischen Forschungsstelle im Reichsgesundheitsamt“ berufen wird. Die Forschungsstelle befasst sich hauptsächlich mit „Zigeuner-Gutachten“. Im Rahmen großangelegter Aktionen zur „Bekämpfung der Zigeunerplage“ vermessen, verhören und klassifizieren die Arbeitsgruppen, zu denen Eva Justin gehört, Tausende Sinti und Roma und legen „Sippenarchive“ an. Justins Verhältnis zu Ritter führt dazu, dass sie ein immenses Arbeitstempo an den Tag legt. Sie glaubt einer großen Bewegung anzugehören, Teil einer gleichgesinnten Gemeinschaft zu sein.
1937 beginnt sie, auf Ritters Wunsch hin, neben ihrer Tätigkeit als „Rassenforscherin“, ein Studium der Anthropologie und macht sich auf dem „Zigeunerrastplatz“ Berlin-Marzahn, wo immer mehr Sinti und Roma konzentriert werden, bald einen Namen als „Zigeuner-Expertin“. Die Gutachten, die sie und die Kollegen verfassen, dienen als Grundlage, Sinti und Roma in Lager zu deportieren, wo sie entwürdigt, gefoltert, verstümmelt und ermordet werden.
Um die Gutachten aufzuwerten, verlangt Ritter, dass Justin eine Doktorarbeit schreiben soll. Er hat Bedenken, die massenhaften Bewertungen, die Todesurteilen gleichkommen, von einer Studentin unterschreiben zu lassen. Obwohl Justin kein abgeschlossenes Studium vorweisen kann, wird sie mithilfe seiner einflussreichen Kollegen zur Promotion zugelassen. In ihrer Arbeit untersucht sie, inwiefern „Zigeunerkinder“ erziehbar sind oder nicht. 1942 reist sie zu diesem Zweck ins schwäbische Mulfingen, wo ihr in einem katholischen Kinderheim 40 Sinti-Kinder zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt werden. Die Heimkinder bleiben so lange von der „Endlösung“ verschont, wie sie Justin als Versuchsobjekte nützen. Nach Abschluss der Doktorarbeit werden sie der SS übergeben und nach Auschwitz ausgewiesen.
Bei allem, was sie tut, bleibt Justin unzugänglich und kalt. Nur Ritter gegenüber zeigt sie Gefühl. Erbarmungslos reißt sie Familien auseinander, lässt Leute verhaften und Frauen, wenn sie nicht spuren, die Haare abschneiden. Sie weiß, was sie tut. Fassungslos verfolgt man, wie sie Kinder aushorcht, Leute denunziert, eine Schwangere zur Zwangsabtreibung schickt. Bei alldem begreift Justin nicht, dass alle angeblichen Eigenschaften, die sie den „Zigeunern“ zuschreibt – Dummheit, Gemeinheit, Schwachheit – ihre eigenen Eigenschaften sind.
„Bitten der Vögel im Winter“ erinnert eindrücklich an die mörderische Politik der NS-Zeit, die auf Basis einer verheerenden Rassenideologie unter anderem zur Vernichtung von mehr als 500.000 Sinti, Roma und Jenischen in Deutschland und Europa führte.

Ute Bales, 1961 in der Eifel geboren und dort aufgewachsen, studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Kunst in Giessen und Freiburg, wo sie seither lebt und arbeitet. Sie ist Mitglied im Literaturwerk Rheinland-Pfalz-Saar e.V., im Literarischen Verein der Pfalz, im Literatur Forum Südwest e.V. Freiburg, gehört dem Kunstverein Weißenseifen/Eifel an sowie der Künstlergruppe SternwARTe Daun. Sie hat bisher sieben Romane veröffentlich sowie zahlreiche Kurzgeschichten und Essays. Der Roman „Bitten der Vögel im Winter“ ist mit dem Martha-Saalfeld-Förderpreis 2018 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.
Siehe auch:
Auszug 1
Kinderheim Mulfingen, 1942
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25728
Auszug 2
Berlin, 1936
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25747
Online-Flyer Nr. 698 vom 29.03.2019
Aus dem Roman "Bitten der Vögel im Winter" (Auszug 3)
Polen, 1942
Von Ute Bales
 Im Zug von Berlin nach Bialystok haben sie das Abteil für sich. Obwohl sich der Herbst schon ankündigt, ist die Luft noch schwer von der Hitze und dem Staub des Sommers. Fräulein Nickel sitzt am Fenster, fächert sich mit einer Zeitung Luft zu. Sie ist erst seit wenigen Wochen dabei und macht auf Eva einen konfusen Eindruck. Sie verwechselt Termine, vertauscht Namen, irrt sich mit Akten und stellt Fragen, über die Eva nur den Kopf schütteln kann. Ihr rundes Gesicht ist erhitzt, die braunen dünnen Haare kleben am Kopf. Für die Reise hat sie alles zusammengetragen, was sie an Informationen finden konnte: „Wir sind jetzt kurz hinter Warschau. Also noch ungefähr 200 Kilometer. Ich war mal als Kind hier und erinnere mich an herrliche Kuchen und an Szaszlyk. Das sind Fleischstücke mit Zwiebeln, Paprika, Pilzen und Speck auf einem Spieß gegrillt oder Pierogi, kleine Maultaschen mit Fleisch- und Quarkfüllung, auch sehr fein. Überhaupt die polnische Wurst, besonders die geräucherte, schmeckt prima mit Bier oder Wodka.“
Im Zug von Berlin nach Bialystok haben sie das Abteil für sich. Obwohl sich der Herbst schon ankündigt, ist die Luft noch schwer von der Hitze und dem Staub des Sommers. Fräulein Nickel sitzt am Fenster, fächert sich mit einer Zeitung Luft zu. Sie ist erst seit wenigen Wochen dabei und macht auf Eva einen konfusen Eindruck. Sie verwechselt Termine, vertauscht Namen, irrt sich mit Akten und stellt Fragen, über die Eva nur den Kopf schütteln kann. Ihr rundes Gesicht ist erhitzt, die braunen dünnen Haare kleben am Kopf. Für die Reise hat sie alles zusammengetragen, was sie an Informationen finden konnte: „Wir sind jetzt kurz hinter Warschau. Also noch ungefähr 200 Kilometer. Ich war mal als Kind hier und erinnere mich an herrliche Kuchen und an Szaszlyk. Das sind Fleischstücke mit Zwiebeln, Paprika, Pilzen und Speck auf einem Spieß gegrillt oder Pierogi, kleine Maultaschen mit Fleisch- und Quarkfüllung, auch sehr fein. Überhaupt die polnische Wurst, besonders die geräucherte, schmeckt prima mit Bier oder Wodka.“Während sich die Nickel in Rezepten ergeht und von Sauerkraut und Kümmel, Senf- und Meerrettichsoßen schwärmt, sitzt Eva am Fenster, den Kopf an die Zugscheibe gelehnt, und sieht hinaus. Es dauert, bis die Nickel das Thema ändert. „Wussten Sie, Fräulein Justin, dass Bialystok mal preußisch war, dann russisch, dann polnisch? Ich habe mich informiert. Der größte Teil der polnischen Juden hat dort gelebt. Das ist jetzt natürlich anders. Wissen Sie, dass es im Ghetto einen Judenrat gibt?“ Bisher hat Eva nur mit halbem Ohr zugehört, aber jetzt, wo die Nickel von Judenräten anfängt, wird sie aufmerksam. „Was wissen Sie denn schon über Judenräte?“ Die Nickel zieht die Augenbrauen hoch und hebt die Stimme. „Judenräte erhalten ihre Befehle von der SS. Sie befassen sich mit Bevölkerungsverzeichnissen, mit der Lebensmittelversorgung, mit Beerdigungen, auch mit dem Gesundheitswesen. Das muss ja alles organisiert sein. Sie sind auch verpflichtet, Arbeitskräfte zu liefern. Ja, stellen Sie sich vor, sie helfen bei den Evakuierungen in die Arbeitslager.“ Dann kichert sie und fügt hinzu: „Sie helfen also bei den eigenen Evakuierungen. Damit wird Personal eingespart. Einige werden ihre Positionen ganz schön ausnutzen und sich bereichern. Oder meinen Sie nicht?“ „Wer sagt das?” „Das hört man so.“ Eva weiß nicht, was sie zu diesem Gerede sagen soll. Die Fahrt macht träge und sie sieht wieder aus dem Fenster. Es dauert einen Moment, dann fängt Fräulein Nickel an in ihrer Tasche zu kramen und fragt: „Den Juden wird doch alles weggenommen, wenn sie ins Lager kommen, oder? Das müssen doch Berge von Sachen sein.“ Eva setzt sich aufrecht. Wie die Nickel redet? „Berge von Sachen sind es sicher nicht. Was sie haben, behält das Reich. Das ist ja auch nicht mehr als recht. Die Lager kosten schließlich auch was. Unterkunft, Essen, alles das. Auch der Transport. Oder glauben sie, die kaufen sich ne Fahrkarte? Was glauben Sie eigentlich?“ „Aber es ist doch eine Enteignung, oder?“ „Eine Enteignung ist im Falle eines Juden kein Diebstahl.“
Demonstrativ dreht sich Eva nach dem Fenster. Sie hat keine Lust, sich weiterhin solche Fragen anzutun. Ihr Blick geht wieder über die Landschaft, über die Hügel. Bussarde kreisen unter den Wolken. Entrückt und fern schweben sie in einer von einem Dunstschleier verhüllten Höhe. Sie kreisen und kreisen. Hin und wieder glaubt Eva ihr Gickern zu hören. Zuvor hat sie Wildgänse gesehen, einen schnatternden Schwarm, der sich keilförmig, ein Leitvogel an der Spitze, in Richtung Osten bewegt hat. Wie weit der Blick wohl sein muss, von so weit oben, denkt sie.
Die Nickel sagt nichts mehr, döst vor sich hin.
Die Fahrt ist eintönig und lang. Auch die Landschaft. Heckenumsäumte, spätsommerliche Wiesen, abgeerntete Felder, Waldstücke, manchmal Dörfer. Im Zug ist es unruhig. Auf jeder Station steigen Leute zu. Ständig poltert jemand durch den Waggon. Im Gang müssen immer zwei oder drei Leute aufstehen, um Platzsuchende durchzulassen. Der herbe Geruch schwitzender Körper mischt sich mit Zigarettenrauch. Auch Eva schwitzt. Besonders unter den Achseln. Hoffentlich gibt das keine Ränder auf der Bluse.
Sie versucht, die Ortschilder zu lesen. Manche Schilder tragen deutsche Namen. Die anderen kann sie nicht aussprechen.
Je weiter sie nach Osten kommen, desto trostloser werden Gegend und Wetter. Dunst hängt über den gefiederten Silhouetten der Wälder, verschluckt Dörfer, Häuser, Menschen. Es ist ein zäher Dunst, der in den Augen schmerzt, über dem Boden schwebt und bis Bialystok nicht aufhört. Hier und da ragen Kiefer- und Birkenwälder aus dem Weiß. Manchmal sind es Fabriken mit hohen Schornsteinen, die das Bild verschandeln.
Dr. Sophie Ehrhardt ist mit einem früheren Zug gekommen und wartet bereits auf dem Bahnsteig. Sie sieht streng aus mit den mit zwei Kämmen festgesteckten hellen Haaren und der schwarzgeränderten Brille. Ihr Rock ist zerknittert von der langen Fahrt. Winkend und mit Gepäckstücken beladen kommt sie den beiden Frauen entgegen. „Gut, dass es endlich Verstärkung gibt“, lacht sie und drückt Eva und Fräulein Nickel die Hand.
Sophie Ehrhardt ist Eva noch aus der Tübinger Zeit vertraut. Sie kennt sich aus, hat mit ihren Arbeitsgruppen monatelang tausende Zigeuner in Ostpreußen erfasst. Außerdem hat sie sich in ihrer Doktorarbeit mit Ameisenarten befasst. Sie ist sich sicher, in Bialystok einige der Abgeschobenen wiederzusehen. Eva erinnert sich an Abdrücke von Gesichtern, die die Ehrhardt bei ihrem letzten Besuch in Berlin im Gepäck hatte. Zwei Männerköpfe. Schöne Männer. Jemand hatte ihre Namen in den Gips geritzt: Albert und Johannes Bock.
Die Ehrhardt geht strengen Schrittes voran. Ihre genagelten Schuhe klacken auf dem Pflaster. Ein wortkarger Uniformierter holt sie ab, bringt sie zu einem Feldfahrzeug, mit dem er sie durch die Stadt fährt. Ein barockes Rathaus und ein imposanter Dom liegen auf dem Weg. Schön gestaltete Fassaden von Bürgerhäusern fallen auf.
An beiden Flussseiten reihen sich Fabrikanlagen aneinander. Graue Industriebauten sind es, dahinter Stoppelfelder und Brachland, kleine Gehöfte, Mietskasernen, an denen der Putz abblättert, alte Holzhäuser. Die Stadt kommt Eva entrückt und irgendwie verschwommen vor. Der Uniformierte stoppt den Wagen an einer Bushaltestelle am Stadtrand und lässt die Frauen aussteigen. Mit Händen und Füßen erklärt er ihnen die Richtung, gestikuliert und wiederholt immerzu die gleichen Worte, die niemand versteht. Dann steigt er in seinen Wagen, wendet und fährt zurück.
Alles ist schmutzig und heruntergewirtschaftet. Irgendwo blöken Schafe. Händler stehen am Wegrand. Zerlumpte Männer mit schwarzen Zähnen handeln mit Holz; Frauen mit Kopftüchern preisen dürftiges Knollengemüse an. Schmuddelige Kinder streichen um die Frauen herum, kommen näher, zupfen an Evas Mantel, jammern und bitten mit den Augen. Eva droht mit den Händen, tut so, als wolle sie sich eines der Kinder greifen. Da rennen sie kreischend auseinander.
Die Frauen folgen einem Weg mit löchrigem Pflaster, in dessen Vertiefungen Pfützen stehen. Ein Stück geht es an einem Zaun entlang, der neben einem zertrampelten Pfad verläuft, dessen Erde fast schwarz ist.
Das Gefängnis liegt am Fluss, inmitten einer unüberschaubaren Landschaft aus Erdhügeln und verwildertem Gestrüpp, und ist mit Holz- und Stacheldrahtzäunen abgeriegelt. Zwei Wachsoldaten mit Hunden und geschulterten Gewehren warten an einer Rampe. Einer schnäuzt sich die Nase, indem er mit bloßen Händen erst eins, dann das andere Nasenloch zudrückt und den Schleim auf den Weg rotzt.
Ein Aufseher in einer abgetragenen Uniform empfängt sie hinter einem Eisenportal, überprüft ihre Ausweise und salutiert. Er ist gedrungen und kurzbeinig, hat eine Stirnglatze. Eine Narbe zerteilt die linke Gesichtshälfte. Wenn er spricht, blitzt ein Goldzahn. Er stellt die Frauen zwei weiteren Mitarbeitern vor, von denen sich einer anbietet, ihnen das Gebäude zu zeigen. In schlechtem Deutsch mit stark polnischem Akzent erkundigt er sich nach der Reise und bringt sie in einen kahlen, weißgetünchten Raum, eine Art Küche mit einem Spülstein und einem Herd. Ein Tisch ist gedeckt. Eine Frau in Sträflingskleidern wischt sich die Hände an der Schürze ab und beginnt auf Zuruf des Aufsehers mit hektischen Bewegungen und knochigen Fingern Kaffee zu kochen.
„Wie viele sind hier untergebracht?“, will Eva wissen. Die Auskunft des Aufsehers ist ausweichend. „Zu viele. Hauptsächlich Ostpreußen. Massenhaft Zigeuner. Ein paar Funktionäre der Bolschewisten sind auch dabei.“ Sie setzen sich an den Tisch. Die Frau bringt Brote mit Schmalz, stellt eine dampfende Kanne auf den Tisch und verteilt Tassen. Die Ehrhardt greift als erste nach den Broten. „Also, wenn Sie mich fragen“, sagt sie und wirft Eva einen vielsagenden Blick zu, „hier gibt es nur Kriminelle.“
Später zeigt der Aufseher, der sich inzwischen als Kommandant vorgestellt hat, den Frauen den Hof und einen Teil des Gebäudes, in dem die Gefangenen untergebracht sind. Obwohl es draußen kühl ist, brütet innen die abgestandene Luft verschwitzter, verdreckter Körper in überfüllten Räumen. Von oben bis unten wird Eva fixiert. Mindestens zwölf Augenpaare aus dunklen Gesichtern verfolgen jeden ihrer Schritte. Die Pritschen stehen dreistöckig. Einen eigenen Schlafplatz hat niemand. Kleidungsstücke hängen an Nägeln an den Wänden. Vor einem vergitterten Fenster steht eine Waschschüssel mit stinkendem Wasser.
Die meisten Zellen sind leer, die Gefangenen bei der Arbeit. Nur zerlumpte Frauen mit notdürftig bekleideten Kindern sind übrig. Sie liegen zusammengekauert auf dem nackten Boden. Manche haben etwas Stroh unter sich. Eine der Frauen liegt auf einer schmutzstarrenden Steppdecke, hebt die gefalteten Hände bis über den Kopf und bettelt um Brot. Ihr Stöhnen hallt wider, schwillt an, flutet auf und ab, vermischt sich mit anderem Wimmern und Winseln. Die Kinder haben alles Kindliche eingebüßt. Eva versucht ihr Alter zu schätzen, aber das ist unmöglich. Die Haut ist gelb, die Augen sind riesig vor Hunger.
Die Zellen sind wie Pferdeställe. Eine Gefangene streckt ihre Hand aus dem Gitter. Ein Kauderwelsch aus Jiddisch und Romanes prasselt auf die Frauen nieder. Andere sitzen abgestumpft und teilnahmslos herum, heben nicht einmal den Kopf, als Eva ans Gitter klopft. Der ekelhafte Gestank nach Exkrementen und Erbrochenem, der aus ihren Kleidern strömt, nimmt Eva fast den Atem. Alles ist voll von diesem Gestank.
Eva sieht, wie Fräulein Ehrhardt schluckt. Sie selbst versucht durch den Mund zu atmen. „Ja, die Luft hier ist nicht auszuhalten“, klagt der Kommandant, der Evas Blick bemerkt hat, „aber das ist wegen der Enge hier. Wir haben absolut keinen Platz mehr. Inzwischen teilen sich mehrere Familien eine Zelle. Hoffentlich kommen bald welche weg. Es sind einfach zu viele.“ Er seufzt und wiederholt: „Hoffentlich.“
Eva drängt wieder hinaus. Zu stickig ist die Luft. „Und das Essen? Was kriegen sie zu essen?“ Dem Kommandanten behagen Evas Fragen nicht. Er verzieht das Gesicht, wobei sich der Haarstummel unter der Nase, den er dem Führer abgeguckt hat, merkwürdig verformt. „Was sollen sie schon kriegen? Ist ja schließlich keine Erholungsanstalt.“ Sie kommen an einer Zelle vorbei, in der mindestens zwölf Personen eingepfercht sind. „Sehn Sie, wie dreckig die sind. Voller Läuse und sonst was. Wir bräuchten strengere Regeln. Sonst wird es noch schlimmer. Sie lügen und stehlen, obwohl sie genau wissen, dass sie, wenn sie erwischt werden, wegkommen.“ Sie gehen entlang eines langen Flures. Alle paar Schritte wird ein Eisentor geöffnet und sobald sie durchgegangen sind, wieder verschlossen. „Die Sie hier sehen, sind weitaus gefährlicher als Juden. Alles Zigeuner. Alles Spione. Ein richtiges Nest hier. Sie arbeiten für die Partisanen. Auch für Juden und Bolschewiken. Man kann sie nicht durchschauen. Keiner kann das. Sie übertragen Krankheiten, sind voller Krätze, Läuse, Dreck. Man müsste sie ausräuchern.“
Sie gelangen in ein Nebengebäude, den Krankenbau des Lagers. Der Kommandant übergibt die Frauen an eine Häftlingsärztin und verabschiedet sich. Die Ärztin sieht aus, als ob sie nächtelang nicht geschlafen hat. Das noch junge Gesicht ist kalkweiß, tiefe Schatten liegen unter den Augen. „Wir wissen nicht, wie es hier weiter gehen soll“, sagt sie in gebrochenem Deutsch und streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. „Das ist alles zu viel. Zu viele Tote. Und wir können nichts machen. Eigentlich habe ich gar keine Zeit, Sie herumzuführen.“ Dennoch zieht sie den Kittel aus, hängt ihn über einen Stuhl. „Kommen Sie. Folgen Sie mir.“
Die Ärztin führt sie über einen langen grauen Flur, eine Treppe hinauf, auf die Kinderstation. In einem grau getünchten Krankensaal liegen an die dreißig Kinder auf Holzpritschen, zugedeckt mit fleckigen Leintüchern. Auch hier stehen der Brodem von Wunden und das Ausgeatmete zäh in der Luft. Der scharfe Geruch nach Urin mischt sich mit dem Angstgeruch der Kinder, dem Schweiß aus ungewaschenen Betten und Kleidern, den Ausdünstungen von käsigen Füßen, dem süßlichen Hauch eiternder Wunden, der Gestank von Fäkalien.
Die Kinder sind nur noch Haut und Knochen, völlig ohne Muskeln. Ein Junge kann sich kaum noch bewegen. Er wimmert vor Schmerzen. Seine dünne pergamentartige Haut scheuert an den harten Kanten des Skeletts durch, wo sie rot und entzündet ist. Bei fast allen Kindern bedeckt Krätze den Körper. Narben entstellen die Gesichter, Geschwüre ziehen sich über Münder, zerfressen die Haut, bohren sich bis auf das Zahnfleisch, höhlen Kiefer aus und durchlöchern Wangen. Sie gehen von Pritsche zu Pritsche. Die Kinder liegen da, teilnahmslos und apathisch. „Zuerst haben wir gedacht, dass es Typhus ist. Wir haben deshalb schon einige abtransportieren lassen.“ „Und? Wissen Sie inzwischen, was es ist?“ „Ja. Es ist Noma, Wasserkrebs“, erklärt die Ärztin, „eine Art Hungerseuche. Die Krankheit entsteht durch Mangel, also durch Unterernährung. Es ist eine bakterielle Erkrankung, zwar nicht ansteckend, aber leider tödlich. Sie zerfrisst innerhalb von zwei Wochen das Gesicht. Das fängt ziemlich harmlos an: mit Zahnfleischbluten und Mundgeruch. Dann entstehen harte Knoten auf der Mundschleimhaut. Sie entzünden sich, breiten sich über Wangen und Lippen aus. Das Gesicht schwillt an, Fieber und Schmerzen treten auf. An den betroffenen Stellen bildet sich Eiter und zersetzt das Gewebe. Bis in die Augenhöhlen kann das gehen. Die Verstümmelungen sehen Sie ja.“ Sie bleibt vor einem der Krankenlager stehen und zeigt auf einen Jungen, dem das halbe Gesicht fehlt. Schwarze Fliegen aasen am Mund des Kindes, fressen am eitrigen Schorf. Eva muss schlucken, so stark ist der Geruch seiner Wunden. „Was tun sie dagegen?“ „Wir können nur wenig tun. Mundspülungen zum Beispiel. Die Nahrung müsste besser werden. Und die Hygiene. Damit könnten wir die Lage verbessern. Die Kinder haben große Schwierigkeiten beim Essen und Sprechen, auch beim Atmen. Sie sterben an Blutvergiftung oder verhungern. Wenn die Kieferknochen schrumpfen, kommt es bei manchen zu einer Kieferklemme. Das heißt, die Kinder können den Mund nicht öffnen und keine Nahrung aufnehmen. Sie sterben. Vor kurzem ist ein Kind an Erbrochenem erstickt. Aber es sind nicht nur Kinder, Erwachsene haben das auch.“
Beim Essen in der Lagerkantine sind sie sich einig, dass sich die hygienischen Zustände verbessern müssen. Auch für frische Kleidung wollen sie ein Wort einlegen, vor allem für Unterwäsche. Und für bessere Nahrung. Die Ehrhardt macht Notizen für einen Bericht. Später sehen sie zu dritt Namenslisten und Akten durch, durchforsten sie nach sozial Angepassten. Aber es sind weniger als eine Handvoll Familien, die zu den guten Zigeunern gehören. Hinzu kommen ein paar fragliche Kandidaten, die sie sich ansehen wollen.
Die Aussortierten werden auf einer speziellen Liste eingetragen, die Fräulein Nickel noch am Abend dem Kommandanten übergibt. Manche der Namen sind angekreuzt, andere unterstrichen. Alle die ein Kreuzchen bekommen haben, werden auf den nächsten Tag in eine provisorisch eingerichtete Schreibstube einbestellt.
Am anderen Morgen, weit vor dem Frühstück, stehen sie schon in einer langen Schlange vor den Baracken. Ihre Gesichter sind grau und eingefallen. Zwei Aufseher mit Hunden stehen seitlich. Sie haben Gewehre geschultert und tragen Abzeichen an der Brust. Die Hunde bellen. Sie sind gut genährt und muskulös.
Einen nach dem anderen nehmen sie sich vor. Eva und Fräulein Ehrhardt übernehmen die Gespräche, Fräulein Nickel protokolliert.
Die erste, die die Schreibstube betritt, ist eine Frau in Evas Alter. Anders als die anderen hat sie helle Haut und helle Haare. Eva erschrickt. Nie zuvor hat sie einen Menschen gesehen, der ihr so ähnlich ist. So wie sie, so hat auch diese Frau von hellen Adern durchzogene Arme, eine fast durchsichtige Haut, eine ovale Gesichtsform mit einer leicht gebogenen Nase, fast unsichtbare Augenbrauen, dünne Haare von unklarer rötlichbrauner Farbe und schmale, blasse Lippen. Sogar die Hände sind ähnlich. Es sind plumpe Hände mit sehr kurzen Fingernägeln. Alles das nimmt Eva wahr, auch den scheuen Blick, die unsicheren Bewegungen. Nahezu unerträglich ist das. Am liebsten würde sie der Frau die Ähnlichkeit austreiben. Wie eine Anmaßung kommt ihr das vor. Was, wenn das gar keine Zigeunerin ist? Der Gedanke hält sich nicht, eine Antwort kann sich nicht bilden, zu schnell ist die Idee wieder verflogen. „Wieso sind Sie so hellhäutig?“, will Eva wissen und blättert in den Unterlagen, die ihr die Kommandantur überlassen hat.
Die Frau zuckt mit den Schultern. Eva fragt nach Herkunft und Eltern. Die Frau antwortet mit leiser Stimme. Eva muss genau hinhören. Dass sie aus Dresden kommt, erzählt sie, der Vater habe Geigen gebaut und Geigenunterricht gegeben. Sie selbst sei eine Sängerin und mit dem Vater in großen Städten und noblen Etablissements aufgetreten. „Wahrscheinlich im Adlon, in Berlin“, spöttelt Eva, grinst nach Fräulein Ehrhardt und sagt: „Sie sind ja alle was ganz Besonderes.“ Die Frau nickt. „Im Adlon sind wir wirklich aufgetreten. Mein Vater ist bekannt mit Louis Adlon.“ Eva ist nie im Adlon gewesen. Sie braucht diesen Luxus nicht. Aber dass diese abgemagerte Frau in einem der luxuriösesten Hotels des Reichs aufgetreten sein soll, lässt ihre Anteilnahme sofort auf den Nullpunkt sinken. „Geht es nicht noch höher? Noch feiner? Noch besser?“ Sie notiert, was ihr auffällt. Die Frau erschrickt, will etwas sagen, aber Eva lässt ihr keine Zeit und fährt dazwischen: „Keine weiteren Lügen mehr!“ Überheblich und anmaßend schreibt sie auf das Blatt. Dann fällt ihr ein, dass dieses Verhalten ein klares Anzeichen für einen Bastard ist. Wieso sonst hat die Frau auch so helles Haar und so ungewöhnlich helle Haut? Eva flüstert mit der Ehrhardt. Sie kommen zum Schluss, dass hier keine Rassenreinheit vorliegen kann. Die Frau wird nicht weiter gefragt. Eva lässt sie abführen und macht ein Kreuzchen in die Zeile „Verbleib in Bialystok.“
Die zweite Frau, die hereingelassen wird, ist etwas älter und sieht aus wie viele in Marzahn: zerlumpt und verdreckt. Sie fängt schon an zu schreien, da hat sie kaum den Raum betreten. „Sie haben uns versprochen, wenn wir nach Polen kommen, bekommen wir einen Bauernhof, ein Stück Land und etwas Vieh. Lügen waren das. Stattdessen haben sie uns auseinander gerissen, die ganze Familie, und ins Gefängnis geprügelt. Meinem Mann haben sie die Zähne ausgeschlagen. Meine Nichte haben sie gestohlen. Sie haben sie an den Haaren fortgezogen. Ich habe gedacht, sie reißen ihr den Kopf ab. Neun Jahre war sie alt.“ „Niemand stiehlt Kinder.“ „Oh doch, das tun sie. Sie brauchen die Kinder für die Ärzte. Sie machen Versuche mit ihnen, Gott weiß was für Versuche, und dann werfen sie sie weg. Das Ännchen kommt nie mehr zurück, ich weiß es.“ Die Frau schlägt die Hände vors Gesicht und schluchzt. „Drei Monate sind wir jetzt hier. Wir sind 13 auf einer Zelle. Zusammengepfercht wie Tiere.“ Fräulein Ehrhardt will die Sache unterbrechen. „Das wollen wir gar nicht wissen.“ „Doch, doch“, bestimmt Eva, „lassen Sie sie ruhig reden.“ Die Frau verstummt einen Moment, legt das Gesicht in Falten, sieht von einer zur anderen und nickt. „Es ist schrecklich. Alle hungern. Jeden Tag gibt es Tote. Ich habe zwei Tage Rücken an Rücken mit einem toten Mädchen geschlafen. Ein junges Mädchen war das. Sie ist vor Hunger gestorben. Keiner hat nach ihr gesehen. Die Männer werden auch wie Vieh behandelt. Morgens, wenn es noch dunkel ist, werden sie abgeholt und zur Arbeit getrieben. Sie bauen Straßen, Bunker oder Lager. Nachts kommen sie zurück. Sie arbeiten ohne Pause. Wir werden auch geprügelt. Aber das Schlimmste ist: Sie töten uns! Sie töten uns! Alle sind krank. Haben Hautausschläge und was sonst noch alles. Und dann diese schreckliche Krankheit. Fast alle haben das. So viele sind schon tot davon. Wenn ihr nichts tut, sterben wir!“ Die Frau scheint keine Angst zu haben. Sie fuchtelt mit den Händen in der Luft herum und beschwört die Gottesmutter und alle Heiligen. Die Ehrhardt bringt es fertig, das Gejammer zu unterbrechen. „Wenn du raus willst, gibt es nur einen Weg.“ Abrupt hört die Frau auf und sieht Fräulein Ehrhardt mit großen Augen an. „Welchen?“ „Wir können was machen, dass du keine Kinder mehr bekommst“, erklärt Eva, „wenn du es machen lässt, kommst du raus.“ Die Frau stutzt, dann hebt sie die Arme und fängt an zu kreischen. „Das habt ihr schon mit meiner Schwester gemacht! Jetzt ist sie keine Frau mehr! Nur noch ein nutzloses Tier. Wie ein Baum, der keine Früchte trägt. Kinder bedeuten Glück! Ohne Kinder haben wir kein Glück! O Maria voll der Gnade, hilf mir … Ohne Kinder? Das geht doch nicht! Dann könnt ihr uns ebenso gut töten.“ Eva muss eisern durchgreifen, damit die Frau mit ihrem Lamento aufhört. Sie schiebt ein Formular über den Tisch, tippt mit dem Finger auf die Linie, die für die Unterschrift vorgesehen ist. „Hier unterschreiben. Mit vollem Namen. Dann gehts zum Arzt und mit etwas Glück bald raus hier.“ Die Frau geht einen Schritt zurück. Sie sieht auf das Papier wie auf etwas Drohendes. „Das ist ein Vertrag mit dem Teufel!“ Sie hebt erneut die Arme, um wieder in Jammern auszubrechen. „Ja oder nein?“, fragt Eva und macht Anstalten, das Formular wieder an sich zu nehmen, „wenn du nicht unterschreibst, bleibst du hier oder kommst in ein richtiges Lager!“ Da spuckt die Frau auf das Blatt, tritt nach dem Polizisten, der sie unterm Arm packt und hinauszerrt. „Ihr behandelt uns wie Dreck!“, schreit sie, „wir wissen schon, wir sollen uns nicht vermehren! Aber wenn es uns Zigeuner nicht mehr gibt, dann gibt es keine Freiheit mehr! Auch für euch nicht!“
Die Nächste, die hereinkommt, hat einen verkrüppelten Fuß. Sie heuchelt Magenschmerzen, um die Freiheit zu erlangen und knetet dabei nervös die Hände. Eva durchschaut das Spiel und ruft den Polizisten. Im letzten Moment unterschreibt die Frau das Formular.
Dann schleppt sich ein Mann auf Stöcken herein. Beide Beine scheinen lahm zu sein, denn er zieht sie hinter sich her, als ob sie nicht zu ihm gehören. Es ist ein mürrischer Alter mit grauem, hängenden Schnurrbart, der an den Spitzen gelb vom Schnupftabak ist. Er hat eine verschwommene Tätowierung auf dem Handrücken. Seine Augen sind entzündet und rot. Trotz seiner Schwächen wirkt er bedrohlich. Er hört sich an, was Eva zu sagen hat. Als sie fertig ist, knöpft er seine Jacke auf und trommelt mit behaarten Fäusten auf seiner entblößten, vernarbten Brust herum. „Da, sehen Sie nur hin! Alles voller Narben! Ich war für euch im Krieg und jetzt schlagt ihr uns, schindet uns! Nehmt uns alles. Geld, Ausweise, Wertsachen, alles. Wir wissen, was ihr mit uns vorhabt. Täglich gibt es Zigeunertransporte. Ihr wollt uns ausrotten. Wir sollen uns nicht vermehren. Dafür sollen wir unser Kreuzchen unter euern Brief setzen und wenn wir das nicht tun, tötet ihr uns. Aber das tut ihr sowieso, ob wir das Kreuzchen machen oder nicht. Heimlich macht ihr das, im Krankenlager, mit der Mulo-Spritze*. (*Todesspritze) Uns geht es wie den Juden. Aber euch wird es auch mal so gehn, genau wie uns!“ Bei den letzten Worten geht er auf Eva zu und sieht ihr fest in die Augen. „Ihr betrachtet uns wie Vieh! Macht euch nicht mal die Mühe, uns richtig zu erschießen. Ihr schießt und werft dann eine dünne Schicht Erde drüber. Ich habs gesehen! Wisst ihr, dass sich diese dünne Schicht noch stundenlang bewegt? Wisst ihr das? Für das, was ihr tut, sollte man euch die Bäuche aufschlitzen!“ Ein Polizist greift ihn und zerrt ihn hinaus. Eva macht ein Kreuz in der Spalte `Lager´ und notiert: Politisch gefährlich.
Die Männer, die dem Alten folgen, fertigt sie schnell ab. Nur für die jungen Frauen nimmt sie sich Zeit. Jeder erklärt sie geduldig, um was es geht. Auf manche muss sie beruhigend einreden. Bevor die Frauen unterschreiben, sind die Fragen immer gleich: „Ist es wahr, dass wir rauskommen, wenn wir den Eingriff machen lassen? Kommen wir dann wirklich frei?“ „Ja, wir brauchen nur eine Unterschrift. Sie müssen nur diese Erklärung unterschreiben.“ „Und unsere Kinder? Kommen die auch frei?“ „Das muss noch entschieden werden. Auf alle Fälle verbessern sich die Chancen für eure Kinder. Mütter müssen nur für ihre Kinder mitunterschreiben.“ „Und wann kommen wir raus?“ „Sofort nach dem Eingriff.“ „Und dann kommen wir wirklich raus?“ „Es kann ein bisschen dauern, aber dann dürft ihr raus. Und heiraten.“
Eine Schwangere sorgt dafür, dass Eva aus der Haut fährt. Sie ist mindestens im sechsten Monat. Der Bauch tritt deutlich hervor. Eva hat keine Ausdauer mehr für lange Erklärungen. „Wie viele Kinder hast du?“ „Zwei.“ „Das ist also das dritte?“ Eva deutet auf den Bauch der Frau. „Ja.“ „Also, du kannst wählen: Lager oder Abtreibung.“ Die Frau schlägt die Hände vor das Gesicht. „Aber das könnt ihr doch nicht tun! Ihr könnt mir doch das Kind nicht nehmen. Ich kann es schon spüren! Es bewegt sich … Das dürft ihr nicht!“ Eva hält das Gejammer kaum noch aus. Ständig klingen Roberts Worte in ihrem Ohr: Wir müssen sie daran hindern, sich fortzupflanzen. Die Frau vor ihr ist eindeutig dabei, sich fortzupflanzen. Unerbittlich blitzen Evas Augen. „Du hast schon zwei Kinder. Das reicht. Also Abtreibung, dann Lager“, entscheidet sie, ruft nach einem Aufseher, der die kreischende Frau aus dem Raum zerrt. Alle Kräfte muss er aufbringen, als die sich am Türrahmen festkrallt, nach dem Aufseher spuckt und markdurchdringend schreit: „Ihr könnt mir doch das Kind nicht nehmen! Ihr seid Mörder! Mörder!“
Die Frau hinter ihr, mit einer undurchdringlichen Mähne krauser Haare, die Augenbrauen zwei Striche, sieht, wie die Schwangere über den Flur geschleift wird. Sie fixiert Fräulein Ehrhardt mit wildem Blick und gellt mit vor Anstrengung verzerrter Stimme: „Sie hat recht! Ihr seid Mörder! Kindermörder!“ Sie schreit, schreit, schreit. Gebärdet sich wie ein Tier. Eva lässt sie abtransportieren. Das Urteil lautet: Lager.
Ein Mann kommt herein. Sein Gesicht ist voller Ausschlag, auch die Hände. Er beklagt sich, wie mit ihm umgegangen wird. „Ich war im Krieg, hab für Deutschland meinen Kopf hingehalten. Sogar ne Auszeichnung hab ich bekommen. Und jetzt? Als Lohn bekomme ich das.“ Er greift sich zwischen die Beine. „Jetzt krieg ich alles rausgeschnitten! Ausrotten wollt ihr uns, wir wissen es längst. Wir kommen hier nicht mehr raus. Ob wir unterschreiben oder nicht. Und deshalb unterschreibe ich nicht!“ „Dann eben Lager“, entscheidet Eva und ergänzt die Liste. Der Mann kommt gefährlich an Eva heran. Seine Schultern beben, Lider und Nasenflügel zittern. „Verflucht sollt ihr sein! Ja, verflucht, ihr alle! Keinen Frieden sollt ihr mehr finden, jetzt nicht und auch nicht in der Ewigkeit!“ Wieder müssen Aufseher eingreifen. Sie zerren den Mann an den Armen, treten ihm in den Rücken, dann, als er auf dem Boden liegt, ins Gesicht. Seine Lippe platzt auf, Blut sprudelt. Mit Fußtritten bugsieren sie ihn hinaus.
„Jetzt sind wir also verflucht“, lacht Eva, als sie wieder allein sind, „als ob sie das könnten, diese Scharlatane.“ Mit dem Kinn deutet sie auf die Liste, die vor Fräulein Ehrhardt auf dem Schreibtisch liegt. „Wie viele noch?“ „14.“ Eva seufzt. „Also noch 14 Mal das gleiche Geleier.“ Fräulein Nickel sagt gar nichts, sitzt nur da und schreibt Protokolle.
Die meisten unterschreiben, sind gleichgültig. Sie weinen nicht, schreien nicht, nicken zu allem, was Eva sagt, halten den Kopf gesenkt, die Sträflingskappe in der Hand. Sie unterschreiben oder kritzeln Kreuze unter die Einwilligung. Sie unterschreiben auch den Hinweis, dass sie bei verbotener Rückkehr nach Deutschland in ein Lager kommen. Wie Lämmer, die man zur Schlachtbank führt, kommen sie Eva vor mit ihren gequälten Augen und den unterwürfigen Blicken. Wie Tiere.
Ute Bales: Bitten der Vögel im Winter

Roman, Rhein-Mosel-Verlag, Zell, 2018, 410 Seiten, Hardcover, 22,80 Euro
Pressetext zum Buch
Es braucht Mut, einen Roman aus der Perspektive einer NS-Täterin zu schreiben und Ute Bales ist mehrfach gewarnt worden. Sie hat es trotzdem getan und beschreibt in ihrem neuen Werk „Bitten der Vögel im Winter“ ein tiefdunkles Kapitel der deutschen Geschichte, über das bis heute weitgehend geschwiegen wird. Es geht um die Verfolgung der Sinti und Roma und es geht um Eva Justin, eine der bekanntesten „Rassenforscherinnen“ zur Zeit des Nationalsozialismus.
Es ist ein aufwühlender Roman, der kontrovers diskutiert wird. Die Hauptfigur, Eva Justin, ist grotesk, widersprüchlich, ungeheuerlich. Ute Bales erzählt von Selektionen in Jugendgefängnissen, von nächtlichen Übergriffen auf Lagerinsassen, von Kinderspielen, die über Leben und Tod entscheiden. Eva Justin ist keine Phantasiefigur. Sie bewegt sich auf einem gut recherchierten, historischen Terrain. Orte und Personen, die unfassbaren Verbrechen und die damit verbundenen administrativen Vorgehensweisen hat es wirklich gegeben. Historische, politische und psychologische Ebenen verschmelzen: Was ist der Mensch und warum wird er zum Täter?
Eva Justin wurde im Kaiserreich geboren. Ute Bales schildert deren Kindheit, die strenge Erziehung und den schon früh auffälligen Drang, alles zu sortieren und zu ordnen. Hier mögen die Wurzeln liegen für ihre spätere monströse Aufgabe im Nazi-Reich.
Als junge Frau nimmt Justin an einem Lehrgang für Krankenschwestern in Tübingen teil und lernt dort Dr. Robert Ritter kennen, Oberarzt mit besten Karriereaussichten, verheiratet. An Ritter ist nichts zufällig, nichts nebensächlich. Sie ist bereit, als er fragt, ob sie seine Arbeit unterstützen will. Saubere Menschen sind sein Ziel. Eine „Rasse“ ohne Makel. Von Anfang an teilt Justin seine Lust zu forschen, unterstützt seine Arbeit und geht bald eine Beziehung mit ihm ein, die in ein sexuelles Abhängigkeitsverhältnis führt, das als Analogie der Abhängigkeit der Deutschen zu Hitler gelesen werden kann. Konsequent tut Justin das, was Ritter sagt, hinterfragt nichts, sieht weg, wo es heikel wird, verbeugt sich vor jedem seiner Worte.
1936 folgt sie ihm nach Berlin, wo er zum Leiter der „Rassenhygienischen Forschungsstelle im Reichsgesundheitsamt“ berufen wird. Die Forschungsstelle befasst sich hauptsächlich mit „Zigeuner-Gutachten“. Im Rahmen großangelegter Aktionen zur „Bekämpfung der Zigeunerplage“ vermessen, verhören und klassifizieren die Arbeitsgruppen, zu denen Eva Justin gehört, Tausende Sinti und Roma und legen „Sippenarchive“ an. Justins Verhältnis zu Ritter führt dazu, dass sie ein immenses Arbeitstempo an den Tag legt. Sie glaubt einer großen Bewegung anzugehören, Teil einer gleichgesinnten Gemeinschaft zu sein.
1937 beginnt sie, auf Ritters Wunsch hin, neben ihrer Tätigkeit als „Rassenforscherin“, ein Studium der Anthropologie und macht sich auf dem „Zigeunerrastplatz“ Berlin-Marzahn, wo immer mehr Sinti und Roma konzentriert werden, bald einen Namen als „Zigeuner-Expertin“. Die Gutachten, die sie und die Kollegen verfassen, dienen als Grundlage, Sinti und Roma in Lager zu deportieren, wo sie entwürdigt, gefoltert, verstümmelt und ermordet werden.
Um die Gutachten aufzuwerten, verlangt Ritter, dass Justin eine Doktorarbeit schreiben soll. Er hat Bedenken, die massenhaften Bewertungen, die Todesurteilen gleichkommen, von einer Studentin unterschreiben zu lassen. Obwohl Justin kein abgeschlossenes Studium vorweisen kann, wird sie mithilfe seiner einflussreichen Kollegen zur Promotion zugelassen. In ihrer Arbeit untersucht sie, inwiefern „Zigeunerkinder“ erziehbar sind oder nicht. 1942 reist sie zu diesem Zweck ins schwäbische Mulfingen, wo ihr in einem katholischen Kinderheim 40 Sinti-Kinder zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt werden. Die Heimkinder bleiben so lange von der „Endlösung“ verschont, wie sie Justin als Versuchsobjekte nützen. Nach Abschluss der Doktorarbeit werden sie der SS übergeben und nach Auschwitz ausgewiesen.
Bei allem, was sie tut, bleibt Justin unzugänglich und kalt. Nur Ritter gegenüber zeigt sie Gefühl. Erbarmungslos reißt sie Familien auseinander, lässt Leute verhaften und Frauen, wenn sie nicht spuren, die Haare abschneiden. Sie weiß, was sie tut. Fassungslos verfolgt man, wie sie Kinder aushorcht, Leute denunziert, eine Schwangere zur Zwangsabtreibung schickt. Bei alldem begreift Justin nicht, dass alle angeblichen Eigenschaften, die sie den „Zigeunern“ zuschreibt – Dummheit, Gemeinheit, Schwachheit – ihre eigenen Eigenschaften sind.
„Bitten der Vögel im Winter“ erinnert eindrücklich an die mörderische Politik der NS-Zeit, die auf Basis einer verheerenden Rassenideologie unter anderem zur Vernichtung von mehr als 500.000 Sinti, Roma und Jenischen in Deutschland und Europa führte.

Ute Bales, 1961 in der Eifel geboren und dort aufgewachsen, studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Kunst in Giessen und Freiburg, wo sie seither lebt und arbeitet. Sie ist Mitglied im Literaturwerk Rheinland-Pfalz-Saar e.V., im Literarischen Verein der Pfalz, im Literatur Forum Südwest e.V. Freiburg, gehört dem Kunstverein Weißenseifen/Eifel an sowie der Künstlergruppe SternwARTe Daun. Sie hat bisher sieben Romane veröffentlich sowie zahlreiche Kurzgeschichten und Essays. Der Roman „Bitten der Vögel im Winter“ ist mit dem Martha-Saalfeld-Förderpreis 2018 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.
Siehe auch:
Auszug 1
Kinderheim Mulfingen, 1942
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25728
Auszug 2
Berlin, 1936
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25747
Online-Flyer Nr. 698 vom 29.03.2019