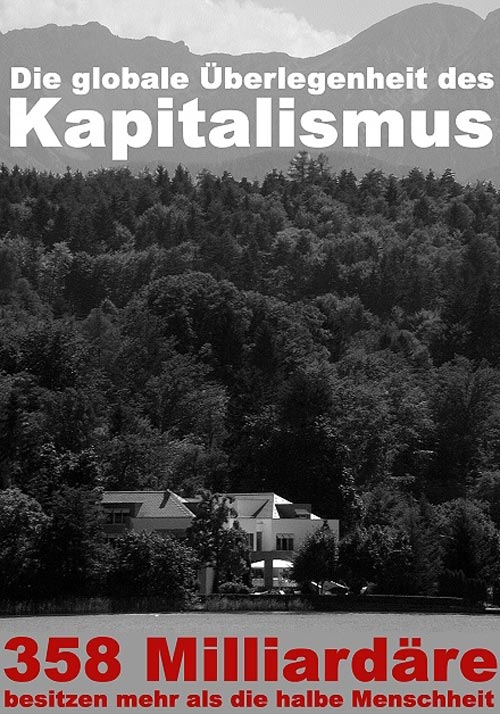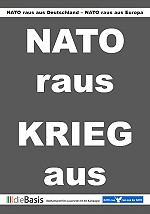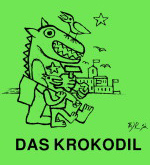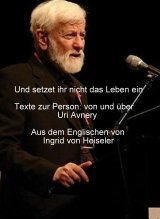SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Kultur und Wissen
Erkundungen zu (m)einer anti-militaristischen Mensch-Werdung - Zugleich eine Reflexion über die Grundlagen heutiger Friedenserziehung - Teil 2
"Keiner kommt heil aus dem Krieg wieder raus!"
Essay von Bernd Schoepe
 „Es handelt sich beim Krieg nicht nur um eine Zerstörung von (...) Millionen Menschen, sondern um die Zerstörung der gesamten sozialen, moralischen und menschlichen Struktur einer Gesellschaft, von der man überhaupt nicht voraussehen kann, welche weiteren Konsequenzen an Barbarei, an Verrücktheit sie (...) mit sich bringt. (..) Die Gewalt kann fast alles mit den Menschen machen. Es ist wichtig zu sehen, dass es nur fast alles ist. Sie kann mit einigen Menschen nicht das machen, was sie will, nämlich ihre seelische Struktur, ihre Überzeugungen ändern und mit allen Menschen kann sie nur das machen, was sie will, wenn sie gewisse, sehr schädliche Nebenerscheinungen in Kauf nimmt: die Nebenerscheinung der Verdummung, der Lähmung der Vitalität, der Einbildungskraft, dem Schöpferischsein des Menschen. In vielen Fällen aber sind die, die die Gewalt ausüben gar nicht daran interessiert, dass diese Folgen nicht eintreten. Im geschichtlichen Prozess allerdings bleiben diese Folgen von großer Wichtigkeit.“ (Erich Fromm: Zur Theorie und Strategie des Friedens, 1969)
„Es handelt sich beim Krieg nicht nur um eine Zerstörung von (...) Millionen Menschen, sondern um die Zerstörung der gesamten sozialen, moralischen und menschlichen Struktur einer Gesellschaft, von der man überhaupt nicht voraussehen kann, welche weiteren Konsequenzen an Barbarei, an Verrücktheit sie (...) mit sich bringt. (..) Die Gewalt kann fast alles mit den Menschen machen. Es ist wichtig zu sehen, dass es nur fast alles ist. Sie kann mit einigen Menschen nicht das machen, was sie will, nämlich ihre seelische Struktur, ihre Überzeugungen ändern und mit allen Menschen kann sie nur das machen, was sie will, wenn sie gewisse, sehr schädliche Nebenerscheinungen in Kauf nimmt: die Nebenerscheinung der Verdummung, der Lähmung der Vitalität, der Einbildungskraft, dem Schöpferischsein des Menschen. In vielen Fällen aber sind die, die die Gewalt ausüben gar nicht daran interessiert, dass diese Folgen nicht eintreten. Im geschichtlichen Prozess allerdings bleiben diese Folgen von großer Wichtigkeit.“ (Erich Fromm: Zur Theorie und Strategie des Friedens, 1969)
„Solange Kriege geführt werden, wird uns Kummer plagen, werden kräftige Beine nutzlos werden und strahlende Augen dunkel.“ (Sean O’ Casey: Der Preispokal)
VI Ein dörfliches Idyll: So nah am Krieg und doch – zum Glück – so weit davon entfernt!?
Zwischenfazit: Unter die Teile eins bis vier von „Keiner kommt heil aus dem Krieg wieder raus!“ könnte man – wenn man die darin angestellten Überlegungen und Analysen auf meine Person zurückbezieht – einen Strich ziehen und Folgendes als persönliches Zwischenresümee festhalten:
Nun, in meinem 60. Jahr, sehe ich mich mit Bedrohungen meines Lebens durch einen von Politikern wieder einmal leichtfertig aufs Spiel gesetzten Frieden und einer vom Sicherheits- und Kontrollwahn der Reichen und Mächtigen langsam erstickten Freiheit konfrontiert. Gefahren, von denen ich vor noch nicht allzu langer Zeit annahm, sie würden uns nurmehr als ein Gegenstand historischer Reminiszenzen und Zitate zum Nachdenken bringen.
Wie gesagt, hatte ich zunächst nie vor, ein Kapitel über Krieg und Frieden im Licht der eigenen, persönlichen Erfahrungen zu schreiben.
Nun scheint mir, dass ich jetzt, am Beginn meines letzten Lebensalters, von Entwicklungen eingeholt werde, vor denen ich mich aufgrund meines historisch gut bestirnten Geburtsjahres, lange, viel zu lange in Sicherheit wähnte. Angesichts der sich objektiv verdüsternden Aussichten und dem Wetterleuchten des Katastrophischen am gefährlich dräuenden, gewittrig donnernden Horizont meiner Gegenwart, ist daher die Zeit für einen persönlichen Rückblick tatsächlich vielleicht gekommen.
***
Geboren wurde ich 1965, 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Merkwürdigerweise ist mir erst in den letzten Jahren zu Bewusstsein gekommen, wie kurz die Zeitspanne zwischen meiner Geburt und dem Kriegsende doch war!
Im ersten halben Jahrhundert meiner Existenz war die Frage nach Krieg oder Frieden recht weit von den persönlichen Gefühls- und Gedankenlagen entfernt. Ursache dafür war, dass der vergleichsweise idyllische Mikrokosmos, in den ich hineingeboren wurde, gar nichts vom Krieg zu enthalten schien – jedenfalls nichts Sichtbares mehr. Soweit ich mich erinnern kann, erschien kaum etwas in meiner Wahrnehmung, was auf diesen Weltenbrand noch verwiesen hätte. Nahezu alle Spuren schienen getilgt zu sein - und das nach nur einem Vierteljahrhundert! – Ein erstaunliches Faktum, wie ich (erst) heute finde. (Ich werde später noch näher darauf eingehen.)
Freilich bin ich in der Zeit der Nachrüstung und des großen Streits um den NATO-Doppelbeschluss als Schüler schon für den Frieden auf die Straße gegangen, habe Flugblätter verteilt, eine Menschenkette mitorganisiert, mit Lehrern vor dem Schultor und im Unterricht diskutiert. Um gegen die Stationierung der Pershing-II und Cruise-Missiles-Mittelstreckenraketen zu demonstrieren, bin ich als 15-jähriger 1981 in den Hunsrück gefahren und auch nach Bonn in den Hofgarten, wo ich mich noch leicht verloren in einer unendlich großen Menge von Leuten sehe. Einer Menge, die so groß war, dass ich den großen Heinrich Böll kaum reden gehört, geschweige denn gesehen habe. Zu dieser Zeit lag die Friedensbewegung nicht so quer zum Zeitgeist wie heute. In der Tagesschau berichtete man halbwegs sachlich über das Anliegen und die zahlreichen Aktionen. Damals säumten Hunderttausende die Straßen der Republik (nach offiziellen Angaben 300.000 in Mutlangen, 500.000 in Bonn), viel mehr im Vergleich zu den etwa 30.000 Menschen, die im Februar 2023 dem Aufruf zur Kundgebung zur Beendigung des Ukraine-Krieges von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer am Brandenburger folgten, aus der sich bis heute leider keine neue deutsche Friedensbewegung entwickelt hat.
Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf in der Nähe von Koblenz. Ich erlebte das, was man eine „behütete Kindheit“ nennt. Das war zum Glück lange vor der Helikopterisierung dieses Begriffs. Die relativ große Freiheit und Sorglosigkeit, von der meine Erziehung bestimmt war, dürfte auch erklären, warum mir das woke Biedermeiertum meiner großstädtischen Latte-Macchiato-Nachbarschaft mittlerweile so auf die Nerven geht.
Wie gesagt: der Ort und die Erlebnisse meiner Kindheit waren denkbar weit vom Krieg entfernt. Denke ich an diese frühesten Erinnerungen zurück, so habe ich die heimatliche rheinische Provinz, genauer gesagt die letzten sanft geschwungenen, zwischen den Tälern von Rhein und Mosel gelegenen Ausläufer der Eifel, als ein Hort der Beschaulichkeit und des Friedens vor Augen. Als Kinder spielten wir das ganze Jahr über draußen. Dass wir uns so oft und so gut es ging elterlicher Aufsicht und Kontrolle entzogen, machte einen Großteil des Zaubers meiner Kindheit aus, den ich heute preisen will. Dem Drang nach unbeaufsichtigten, eigenen Erfahrungen, nach Freiheit und Selbsterprobung verdanke ich meine Liebe zur Natur, vielleicht auch meinen Sinn für Ästhetik. Sicher aber, seit der Pubertät, auch mein Einzelgängertum und meinen Hang zur Unabhängigkeit.
„Unordnung und frühes Leid“, wie es so schön im Thomas Mannschen Duktus heißt, der Tod der Mutter und des Bruders, haben diesen Hang verstärkt. Die Rolle der Natur sei hier betont, weil sie für den Menschen ein großer Kraft- und Freudenquell ist. Die Natur vermag auch eine sehr wichtige Friedens- und Trostspenderin zu sein, gerade in jungen Jahren, der Zeit der Herman-Hesse-Lektüren. Begegnet man ihr als Suchender und erfährt auch nur einen Bruchteil ihrer Wunder, erahnt man die Bedeutung der Worte Goethes, nach denen „alles Vergängliche nur ein Gleichnis“ sei. Jedenfalls habe ich diese Kraft, Hilfe und auch Läuterung durch die Natur oft stark empfunden. Und ich habe mich an ihr – und an unseren geliebten Hunden, mit denen ich groß zu werden das Glück hatte – immer wieder aufgerichtet, wenn ich einsam, traurig, verwirrt oder verzweifelt war.
Mit Furcht und Schrecken registriere ich heute, wie viele Menschen von der Natur so sehr entfremdet sind. Dies gilt, wie ich es als Lehrer in den letzten fünfzehn Jahren leider immer wieder beobachten musste, insbesondere für die jüngere, digital sozialisierte Generation. Heute glaube ich, dass der fehlende Frieden mit und in der Natur den Unfrieden in vielen anderen Bezügen unseres Lebens nach sich ziehen kann.
Aus der Erinnerung gerissene Albumblätter einer Familiensaga – vergilbt und lückenhaft
Meine Eltern hatten sich im Schatten der Loreley auf einem der vielen Weinfeste am Mittelrhein kennengelernt. Die väterliche Familie war auf der Flucht von Lodz, mein Großvater und mehrere Onkels waren Weber (die Familie Goltz – Schoepe muss eine ganze Weber-Dynastie hervorgebracht haben), schließlich dort gestrandet. Mütterlicherseits war die Familie schon etwa ein Jahr vor Kriegsende aus Berlin nach Eggenfelden in Niederbayern geflohen.
Die Kleinstadt Eggenfelden blieb vor den Bomben der Alliierten verschont. Meine Mutter, die hier eine glückliche und unbeschwerte Jugend erlebte, erzählte, dass sich eines Sonntags nach dem Kirchgang im Herbst 1944 ein langer Gemeindezug in Richtung des vor der Stadt gelegenen Ackerlandes in Bewegung setzte, um dort auf einem Stoppelfeld einen großen Krater zu besichtigen. Ein amerikanischer Bomber hatte dort seine tödliche Fracht, wohl aus Versehen, verloren.
Das war das Kriegsgeschehen in Eggenfelden. Es endete mit dem Einmarsch der US-Amerikaner am 1. Mai 1945.
Trotzdem kam der Krieg auch nach Eggenfelden. Mehr als 340 Söhne der Stadt kehrten aus ihm nicht mehr zurück (29).
Später ging die Familie mütterlicherseits aufgrund geschäftlicher Verbindungen meines Großvaters nach St. Goar. Dorthin hatte es nach Zwischenstation im Fränkischen auch die väterliche Familie verschlagen: Anfang der 1950er Jahre richtete mein Großvater im Untergeschoss eines größeren Wohnhauses direkt an der Rheinuferstraße (B 9) eine kleine Weberei ein, von der die Familie mehr schlecht als recht ernährt werden konnte. Natürlich musste jeder in der Familie mit anpacken.
Mein Vater, Jahrgang 1931, war ein Selfmade-Mann und brachte es mit Geschick und noch mehr Glück (wie ich vermute) zu viel Geld als Vertreter für Werkzeugmaschinen. So wurde ich in eine aufstrebende Wirtschaftswunder-Wohlstandsfamilie hineingeboren, die in vielem „nicht Fisch, nicht Fleisch“ war. Östliche, evangelische, aber kirchenfern bis kirchenkritisch eingestellte Flüchtlinge im katholischen Rheinland (später sind alle aus der Kirche ausgetreten). Liberal bis auf die Knochen, mit einem Bein betont weltläufig, mit dem anderen bodenständig–unprätentiös und relativ frei von sozialen Vorurteilen. Ein Potpourri aus Kaufleuten, Handwerksmeistern, Unternehmen mit ein paar Einsprengseln von künstlerisch Begabten und Beamten. Aus ursprünglich urbanem Milieu stammend, die es durch die Flucht- und Wanderungsbewegungen der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit in eine ländlich-konservative, provinzielle, bisweilen als rückständig wahrgenommene Umgebung verschlagen hatte. Meine Familie wurde aber offenbar schnell von den Einheimischen akzeptiert und konnte sich problemlos in das dörfliche Leben integrieren.
Meine Mutter hätte nach dem Krieg gerne Archäologie oder Kunstgeschichte studiert, das blieb ihr aus finanziellen Gründen versagt. Mein Vater nannte sich „Ingenieur“, ob er je eine richtige Ausbildung abgeschlossen hatte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er nach dem Krieg neben der Mitarbeit in der Weberei seine Abende als Kantinenwirt bei den französischen Besatzungstruppen in Moselweiß, einem Stadtteil von Koblenz, verbrachte und dass das, da er uns öfter davon erzählte, eine recht glückliche Zeit für ihn gewesen sein muss. Denn er war sonst nicht besonders gesprächig.
Mein Großvater mütterlicherseits war ein wohlhabender Berliner Kaufmann, der, nachdem er durch den Krieg seine Firma, seine Mietshäuser und sein Vermögen verloren hatte, alle seine wirtschaftlichen Hoffnungen in eine Erfindung setzte, für die ich für die Jahre 1953 und 1963 bei der Internet-Recherche zu diesem Text Patentanmeldungen finden konnte. (30) Für die Patente und Patentrechtsprozesse, die ihm von einem damals marktführenden US-amerikanischen Konzern aufgezwungen wurde, verscherbelte meine Großmutter ihren letzten Schmuck. Dieser Kampf kostete meinen Großvater nicht nur sehr viel Geld, sondern auch die Gesundheit. Kurz vor seinem frühen Tod, – er starb mit 63 im Jahr vor meiner Geburt – hatte er – von den Prozessen zermürbt und von einem Herzleiden schwer gezeichnet – zusammen mit einem jüngeren Sozius auf einem Nürnberger Hinterhof ein Unternehmen gegründet, das seine Erfindungen, Gleitverschlüsse für Kunststoff-Verpackungsbeutel, wirtschaftlich verwerten sollte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entwickelte sich das Unternehmen ab dem Ende der 1960er Jahre erfolgreich.
Meine Mutter durfte nach dem Krieg immerhin eine Lehre im Hotelgewerbe in einem der besten Häuser Münchens, dem Regina-Palast-Hotel, machen. Dort gingen UfA-Stars ein und aus. So verfügte sie später über ein reichhaltiges Repertoire an Anekdoten und Geschichten aus der mondänen Welt, über teils sehr sympathische, teils aber auch recht unsympathische Stars und Sternchen, mit denen sie uns gerne unterhielt. Wenn wir uns gemeinsam einen alten Spielfilm im Fernsehen anschaute, kam ihr fast immer die eine oder andere selbst erlebte Episode mit Schauspielern wieder in den Sinn, die zu den Mitwirkenden im Film gehörten.
Mein Großvater hatte sich als Inhaber und Chef einer kriegswichtigen Maschinenfabrik der Einberufung in die Wehrmacht erfolgreich entziehen können. Er soll Pazifist gewesen sein, hatte aber 1933 „aus Verzweiflung“ über die Lage in Deutschland die NSDAP gewählt. Der Röhm-Putsch im Juli 1934 hat ihn politisch aufwachen lassen, seitdem war er Gegner des Regimes.
Später habe ich mich gefragt, wie mein Großvater mit dem Widerspruch klarkam, einerseits Pazifist zu sein, andererseits sich dank der Kriegswichtigkeit seiner Fabrik von Wehrmacht und Kriegsdienst freigekauft zu haben. Und wie sicher konnte er sein damals, nicht doch noch an die Front gezogen zu werden? Die Tatsache, dass er dem Krieg auf andere Art und Weise diente – wie stark hat ihn das belastet? Meiner Großmutter zufolge soll er sich für den Rest seines Lebens Vorwürfe gemacht haben, dass er sich so über die Nazis täuschen ließ. Vor dem Krieg wurde er sogar einmal von der Gestapo verhaftet. Er war wegen Hitler-Witzen, die er unvorsichtigerweise in einer Kneipe erzählt hatte, denunziert worden.
Mein anderer Großvater, den ich als liebevollen, immer zu Späßen aufgelegten Opa und guten und geduldigen Schachlehrer in Erinnerung habe, soll in der SS gewesen sein. Darüber wurde zu Hause nie gesprochen. Ich habe erst viel später von meiner Tante davon erfahren.
Obwohl ich schon als Kind wusste, dass mein Opa im Krieg war, habe ich ihn mir merkwürdigerweise nie als Soldat vorgestellt. Er hat auch nichts Persönliches über diese Zeit erzählt. Es heißt, er sei Fotograf gewesen und ist vielleicht dadurch vor unmittelbaren Kampfhandlungen verschont geblieben, was erklären könnte, dass er aus dem Krieg ohne sichtbare Blessuren zurückkehrte. Ich will mir aber auch heute noch nicht ausmalen, welche Gräueltaten er als Fotograf der SS möglicherweise ins Bild gebannt hat.
Nur dem beherzten Eingreifen meiner Großmutter soll es übrigens zu verdanken gewesen sein, dass mein Berliner Großvater nach ein paar Tagen Gestapo-Haft wieder nach Hause zurückehrte. Sie hatte den Gestapo-Mann, der in dieser Angelegenheit das Sagen oder zumindest genug Einfluss hatte, becirct und umgarnt, vielleicht auch bestochen – das ließ sie offen. Meine Großmutter, die eine sehr schöne Frau gewesen ist und auf den alten Fotos immer sehr ladylike aussah, war sich ihrer Wirkung auf Männer wohl sehr bewusst. Außerdem besaß sie – als uneheliches Kind in einfachen Verhältnissen im Arbeiterbezirk Treptow geboren, ihre Mutter hatte die vierköpfige Familie als Näherin allein über Wasser gehalten – die Schlagfertigkeit der sprichwörtlichen „Berliner Schnauze“.
Hitler hielt sie übrigens wegen seines Geschreis, seines lächerlichen Grimassierens und Gestikulierens, schon vor 1933 für verrückt. Sie nahm sich heraus auf den „Heil Hitler!“-Gruß mit „Schönen guten Tag“ zu antworten. Dem Blockwart, der sie wiederholt dafür zur Rede stellte, bot sie Paroli. Diese kleinen Widerstandsakte blieben für sie völlig folgenlos. Meine Großmutter klärte mich auch schon früh darüber auf, dass der nach dem Krieg oft geäußerte Satz „Wir konnten ja nicht wissen, was mit den Juden geschieht“ eine Mär gewesen sei. Ihr Argument war, dass, wenn selbst eine so völlig unpolitische Frau wie sie von den Konzentrationslagern und Gaskammern im Krieg erfahren habe, jeder davon hätte hören und wissen können. Sie hat in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft die Verhaftungen und das Zusammentreiben von Juden, die, wie sie sagte, „keiner Seele etwas zuleide getan hatten“, zu den Deportations- Sammelplätzen, von wo aus sie in die Vernichtungslager transportiert wurden, mitbekommen. Der Gedanke daran sowie die verstörenden Bilder an die Judenverfolgung, insbesondere an die Reichspogromnacht 1938, suchten sie immer wieder heim.
Manchmal sah ich sie, wenn ich ihr abends vor dem Schlafengehen noch einen Gute-Nacht-Kuss geben wollte (was ich, seitdem sie in die Wohnung über uns gezogen war, fast jeden Abend tat) weinend in ihrem Fernsehsessel sitzen. Dann wurden wieder einmal in Filmen oder TV-Dokumentationen die von den Nazis und ihren Mitläufern begangenen Grausamkeiten gezeigt. Sie nahm mich dann meist auf den Schoß und erzählte mir, manchmal völlig aufgelöst, Geschichten aus dieser Zeit, um so ihrem Herzen, das von diesen quälenden Erinnerungen beschwert war, Erleichterung zu verschaffen. Doch neben der Linderung war es ihr ausdrücklicher Wunsch – und so sprach sie zu mir auch – diese schrecklichen Erinnerungen weiterzugeben, damit sich so etwas niemals mehr wiederholen kann. Das war ein wichtiges Motiv dieser ganz besonderen Geschichtsstunden und intuitiv verstand ich die Dringlichkeit ihres Anliegens – für ihren inneren Frieden und aus Sorge um die Zukunft ihrer Enkel.
VII Über Vergangenheit und Zukunft der Utopie einer glücklichen Kindheit und des guten Lebens
Ihren Ursprung hatte die als idyllisch im Gedächtnis gebliebene Kindheit nicht nur in der Natur und dem Bild, das sich von ihr eingeprägt hat: Die meditativ-sanftmütig wirkenden Kühe auf der Weide, die lebhaft-lustigen Schweine im Stall, das umfriedete Leben in unserem Gutshof , wo wir mit großem Garten und altem Baumbestand auf einem parkähnlichen Gelände zur Miete wohnten, die Hühner, die in den angrenzenden Bauern-Gärten herumliefen, gackerten und pickten, das Plätschern des Baches, der durch unser Dorf fließt und dessen Lauf durch die Gemarkung die natürliche Grenze unserer kindlichen Welt bildete, die vielen Kirschen, Äpfel und Pflaumen im Sommer an den Bäumen in den Streuwiesen gleich hinter unserem Haus.
„Das Paradies ist nebenan“, heißt eine Erzählung des niederländischen Schriftstellers Cees Nooteboom. Für mich fing das Paradies hinter dem Hoftor und später gleich links um die Ecke unserer Garagenauffahrt an. Da waren die Obstbaum-Plantagen und Bimsgruben (das vulkanische Gestein der Eifel, das hier zum Bauen gefördert wurde), in denen wir tobten und von den von Baggern aufgetürmten Sandbergen purzelten. Da war das hohe Gras im Sommer, der Dschungel an Unkraut und Brennnesseln, vor denen man sich beim Entdecker-Spiel in Acht nehmen musste, dort legte sich der Duft frisch gedroschener Getreidefelder im August über eine unspektakuläre, aber das Auge und die anderen Sinne beruhigenden Landschaft.
Das Idyll und seine Anmutungen hatten also nicht nur mit der Natur, sondern auch mit der Prosperität und der Aussicht zu tun, dass die Kinder, also unsere Generation, es einmal besser haben würden. Die Zukunft in den 1970er Jahren war trotz Ölkrise und Sonntagsfahrverboten – an zwei Sonntagen radelte ich in Begleitung meiner Eltern staunend und von der Leere wie gebannt über die für PKW und LKW gesperrte Autobahn – eine rosige Zukunft.
Von dieser Vorstellung hat sich unsere Boomer-Generation längst verabschieden müssen: Wir werden es nicht mehr so gut wie unsere Elterngeneration im Alter haben. Wir leben wieder in unsicheren, prekären Zeiten. Der nahende Lebensabend erscheint für uns nicht gerade im idyllisch-milden Licht. Als Produkt der Baby-Boomer-Generation verbindet mich mit meinen Zeitgenossen zwar „das Glück der späten Geburt“, doch wird dieses Glück an der Schwelle, an der wir beginnen, uns langsam aus dem Erwerbsleben zurückzuziehen (wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass viele meiner Generation noch bis 70 oder länger arbeiten werden), wieder als das wahrgenommen, was es historisch – bis auf ganz wenige Ausnahmen – immer war: etwas äußerst Fragiles.
Die Abwesenheit steinerner Zeugen bei gleichzeitiger Anwesenheit versteinerter Zeugen
Zu diesem Idyll gehörte auch, dass es in meiner Kindheit irgendwie ganz unglaubhaft zu sein schien, dass die nur knapp sechs Kilometer Luftlinie entfernte Koblenzer Innenstadt, wo ich dann ab 1977 das Gymnasium besuchte, 1944/45 in 40 Bombenhageln zu 87 Prozent zerstört worden war. Auf alten Aufnahmen sehe ich, dass der Friedrich-Ebert-Ring, an dem meine Schule, das Eichendorff-Gymnasium steht (sie wurde zwischen 1950 und 1957 wiederaufgebaut), einer Trümmerwüste glich.
Damals – 21 Jahre vor meiner Geburt – warfen insgesamt 3772 US-amerikanische und britische Flugzeuge 10.000 Tonnen Bomben auf Koblenz. 1100 Menschen starben. „Das historische Stadtbild der Hauptstadt der Rheinprovinz ging in der Folge für immer verloren.“ Die relativ niedrige Opferzahl – in Köln starben bei den Luftangriffen 20.000, in Dresden 25.000 Menschen – liegt daran, dass etwa 70.000 Koblenzer bis Ende 1944 nach Thüringen evakuiert worden waren. Nur etwa 9000 Menschen waren aus „kriegswichtigen Gründen“ in der Stadt verblieben. Diese „lebten wochenlang in den großen Betonbunkern der Innenstadt“. Für viele nach dem Krieg in die Stadt zurückkehrenden Menschen dienten diese Bunker dann noch lange als „provisorische Wohnungen“.
Manchmal denke ich heute, angesichts der Kriegsbesoffenheit (nicht nur) unserer dysfunktionalen Eliten, es wäre gut gewesen, einen Straßenzug in jeder vom Krieg zerstörten Stadt, in Koblenz z.B. einen Teil der oberen Löhrstraße, zwischen Löhrrondell und Rizzastraße, nicht wiederaufzubauen. Dort fand am 6. November 1944 der Angriff der Royal Air Force auf die Koblenzer Innenstadt statt, der die meisten Opfer forderte: 109 Tote, 558 Verletzte und 25.000 Obdachlose. (31)
Natürlich weiß ich, dass der Krieg und eine solche Trümmerstraße sich nicht musealisieren lassen. Mit der Zeit bekämen sie nolens volens etwas Disneyworldartiges. Auch Trümmer und Ruinen müssen denkmalpflegerisch und erinnerungskulturell konserviert werden: Das dürfte sich am Ende also nicht als die geniale List des Erinnerns herausstellen, durch welche man das „Nie wieder!“ stark und unverbrüchlich in die Herzen und Köpfe der Nachkriegsgenerationen pflanzt, auf dass es als ein zutiefst Verinnerlichtes, Identitätsbildendes transgenerational wirke und die Menschen für Kriegspropaganda unempfänglich mache. Es böte schließlich auch keine Lösung dafür an, erfolgreich Anti-Militarismus, Pazifismus und Menschlichkeit als Botschaft und Lehre dieser dunklen Kriegszeiten in eine bessere Zukunft zu tragen.
Dies beiseitegelassen: Hätte ich als Kind und alle meine Altersgenossen dadurch eine klarere Vorstellung davon erhalten, was es heißt, dem Krieg entronnen zu sein?
Vermutlich. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, glaube ich, dass die stehen gelassenen Trümmer mich mit der Nase auf Fragen gestoßen hätten, die ich weit weniger abstrakt, dafür aber mit größerer Dringlichkeit an meine Eltern und Großeltern gerichtet hätte. Ich vermute, dass ein solches Trümmerfeld, das man absichtsvoll als eine aus der Zeit gefallene Ansicht, als ein Standbild des Krieges bewahrt hätte, in mir mehr und mich hartnäckiger beschäftigende Fragen aufgeworfen hätte (aus der Romantik wissen wir, dass und wie Ruinen die Fantasie anregen: „Was mag früher sich hier alles zugetragen haben? Wie war das Leben hinter diesen Mauern, die jetzt Ruinen sind?“).
Weiter denke ich, dass diese Fragen womöglich auch das hätten aufbrechen können, was bei meinen Eltern und Großeltern als Erinnerung larviert war und was dadurch auch für mich lange, sehr lange unterhalb der Wahrnehmungsschwelle blieb.
Da es eine solche Ansicht der schrecklichen Vergangenheit in dieser Unmittelbarkeit nicht gab, blieb vieles in meiner Sozialisation doch dem Zufall überlassen. Aber auch der formte schließlich ein eindrückliches, für meine Identität bedeutsam werdendes Bild vom Krieg und seinen Zerstörungen. Viel weniger schuf er aber eine Vorstellung von oder besser ein Sensorium für die Verletzungen oder Versehrtheiten, von denen ich in bestimmter Weise in der Gestalt meiner Mutter, meines Vaters und meiner Großeltern umgeben war. Dabei nahmen diese Versehrtheiten ja auch indirekt Einfluss auf meine Erziehung, mein Denken und Fühlen. Auf diese Verletzungen werde ich im Schlussteil meines Erinnerungspuzzles näher eingehen.
VIII Meine „zufälligen“ Bildungserlebnisse – Das Lob der Lehrer und eine merkwürdige Beobachtung
Ich denke, wenn ich hier vom Zufall spreche, so muss diese Rede – mit Blick auf die Bildungserlebnisse, die mich und mein Bild des Vergangenen formten – doch noch präzisiert werden. Womit wir zugleich beim Thema Schule und Lehrer und der Rolle angekommen wären, die sie für meine anti-militaristische Mensch-Werdung spielten.
Meinen Lehrern verdanke ich viel. Sie haben mir die Lust am Denken beigebracht. Gewiss nicht alle meine Lehrer waren gut, aber alle waren nützlich, um mir mein eigenes Wertegerüst zu bauen und mir meine eigene Weltanschauung außerhalb des familiären Mikrokosmos zu bilden.
Unter den Lehrern waren auch ein paar mediokre und ein paar, die zweifelsfrei auch sadistisch veranlagt waren. Aber erstaunlich ist für mich vor allem, wie sehr sich mir bestimmte Szenen, Momente, Situationen gerade mit den Lehrerpersönlichkeiten für immer eingeprägt haben, die ich auf eine bewundernde Art und Weise liebte und verehrte. In ihnen begegneten mir lohnende Beispiele, Mensch zu sein.
Vor alten Nazi-Lehrern bin ich zum Glück verschont geblieben. Ob das etwas mit dem liberalen Ruf meiner Schule zu tun hatte, kann ich nur vermuten. Für mich wie einige meiner besten Grundschul-Freunde war bei der Schulwahl das Gerücht ausschlaggebend gewesen, dass das Eichendorff unter den Gymnasien in Koblenz dasjenige sei, auf dem man am leichtesten sein Abi machen könne. Da ich natürlich mitbekommen hatte, wie schwer sich mein fünf Jahre älterer Bruder auf dem altsprachlichen Koblenzer Honoratioren-Gymnasium tat, auf das meine Eltern den Erstgeborenen geschickt hatten, war das verständlicherweise für mich das entscheidende Kriterium (nach einer Wiederholung wechselte mein Bruder nach der 7. oder 8. Klasse vom „Görres“ auf die Clemens-Brentano-Realschule, wo der „Schulversager“, der den Eltern viel Kummer und Sorgen bereitete, dann eine ganz ordentliche Mittlere Reife ablegte.) Tatsächlich habe ich das Eichendorff als eine liberale, im besten Wortsinn tolerante Schule erlebt. Eine Schule, die den Widerspruch nicht unterdrückte und erstickte, sondern pädagogisch meist engagiert und produktiv bearbeitete.
In komprimierter Fassung lautet das Lob meiner Lehrer so: Man konnte in eurem Unterricht gut diskutieren, ihr hattet fast immer ein Ohr für abweichende Meinungen, meinen Eigensinn habt ihr mehr gefördert als unterdrückt. Danke dafür! Euer Wissen, das ihr mir vermittelt habt und euer Verständnis der Welt machten mich zu einem Suchenden, Fragenden, Zweifelnden und eröffneten mir geistige Horizonte. Sie regten vor allem dazu an, intellektuelle Abenteuer auf eigene Faust zu unternehmen (denn das war noch viel spannender als sich mit dem in der Schule „Durchgekauten“ zu beschäftigen, dass man auch mit den „blöden Mitschülern“ teilen musste. Diese Abenteuer hingegen gehörten mir als mein Schatz ganz allein!). Und danke dafür, dass ihr mich trotz meiner Unreife ernst nahmt!
In der Schule bekam ich die Impulse, die ich zuhause und im Austausch mit Freunden vertiefte. Da ich naturwissenschaftlich eine Niete war, haben mich immer nur die geisteswissenschaftlichen Fächer angezogen und interessiert. Dort sind mir die Lehrer begegnet, die Vorbilder für mich wurden und denen ich den Wunsch verdanke, selbst Lehrer werden zu wollen. Wichtig wurde auch schon früh das Theater für mich. In Theatergruppen an der Schule sprach ich mich frei, erprobte mich, gewann Selbstbewusstsein und entwickelte einen Sinn für die Ambivalenzen und die Pluralität des Wesens Mensch und für das spannungsgeladene und oft widersprüchliche Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft.
Wenn ich über die zahlreichen Impulse spreche, die ich durch den Unterricht und über ihn hinaus von meinen Lehrern erhielt und die ich hier unmöglich alle aufzählen kann, so gilt das natürlich auch bzw. sogar in besonderem Maße für die Themen Krieg und NS-Vergangenheit. Sie nahmen ohnehin fächerübergreifend einen breiten Raum in der Mittel- und Oberstufe ein.
Mein Sozialkundelehrer in der 9. und 10. Klasse schien regelrecht „besessen“ von diesem Thema zu sein. Er zeigte uns viele Dokumentationen der NS-Zeit aus dem Bundesarchiv, darunter einige mit sehr, sehr harten Aufnahmen der Leichenberge, Skelette, Krematorien aus den Konzentrationslagern und von den Gräueltaten der SS im Krieg. Mitschülerinnen liefen weinend aus dem Raum, weil sie die gezeigten Bestialitäten nicht länger ertrugen. Meist war ich wie benommen, wenn die Pause uns aus dem abgedunkelten Chemielabor, das als Filmvorführraum diente, entließ. Das normale Schulleben, die Pausenhofszenerie schien plötzlich alles andere als ganz normal zu sein.
Natürlich habe ich nie gefragt, wie es zu dieser „Besessenheit“ des Sozialkunde-Lehrers gekommen war und wir haben auch nie mit ihm darüber gesprochen und etwa gefragt, wie er diese Zeit als Kind persönlich erlebt hat. Das Thema Nationalsozialismus / Drittes Reich auf Personen und Persönliches, gar auf meine Lehrer zu beziehen, lag mir und meinen Mitschülern fern. Wir sind nicht auf die Idee gekommen, sie als Zeitzeugen selber zu befragen. Das kommt mir heute komisch vor, denn es wäre doch naheliegend gewesen. So kann man sagen, dass meine Kindheit und Jugend in Bezug auf den Krieg rückblickend geprägt war durch die Gleichzeitigkeit einer An- und einer Abwesenheit, die zusammengenommen eine verzögerte, latente Bildungswirksamkeit entfaltete: Die Anwesenheit irgendwie versteinerter Zeugen des Krieges bei gleichzeitiger Abwesenheit seiner steinernen Zeugen.
Heute vermute ich, dass die Obsession meines Sozialkundelehrers mit einem offenkundig labilen Charakter oder einer Persönlichkeitsstörung korrespondierte, die aus seiner Kriegskindheit herrührte. Wir erlebten es wiederholt, dass er betrunken zu uns in den Unterricht kam und sich sehr daneben benahm. Aber wir Schüler wären nicht auf die Idee gekommen, zwischen dem einen und dem anderen irgendeinen Zusammenhang herzustellen.
IX Die sichtbaren und die unsichtbaren Beschädigungen durch den Krieg
An dieser Stelle möchte ich auf den Satz von Patrick Baab aus der Einleitung zurückkommen, das diesem Text den Titel gab.
Obwohl in meiner Familie niemand sichtbare Beschädigungen oder Versehrtheiten aus dem Krieg mit nach Hause gebracht hatte, lässt sich die Erkenntnis „Keiner kommt aus dem Geschehen in einem Kriegsgebiet wieder heil raus, das macht etwas mit einem“ auch auf meine Familie anwenden.
Je länger ich darüber nachdenke – das betrifft jene Erfahrungen des zweiten und dritten Blicks, auf die ich in der Einleitung hingewiesen habe – desto stärker komme ich zu dem Schluss, dass ich diese Beschädigungen als ihr Sohn auch mit mir herumtrage. Das, was der Krieg aus ihnen gemacht hat, wirkt(e) sich auch auf mich aus, ist an mich vererbt worden. Ich habe – ich wiederhole es an der Stelle noch einmal – doch nur zwanzig Jahre nach Kriegsende das Licht der Welt erblickt. Wie haben sich die Spuren des Krieges also in mir und meiner Persönlichkeitsentwicklung sedimentiert? (Es dürfte sinnvoll sein, dass jeder, der dem Frieden näherkommen möchte, sich diese Frage stellt.)
Ich sprach von den Wunden des Krieges als Verlarvungen, die im familiären Leben, meist unterschwellig, spürbar wurden und die ich als Kind und Jugendlicher zwar nur unzureichend erfassen konnte, aber dennoch aufgenommen habe. Sie traten für mich fast ausschließlich maskiert in Erscheinung. Nur bei meiner Mutter wurden sie etwas greifbarer für mich, denn sie ging offener damit um. Während es bei meinem Vater nur ganz selten einmal geschah, dass die Maske etwas angehoben oder ein Stück weit heruntergezogen wurde. Immer ging es dabei – was mir erst jetzt richtig klar geworden ist – um direkte oder indirekte Folgen des Krieges.
Ich habe noch nicht berichtet, dass ich unter dem liebevollen Schirm der Mütter (Mutter, Großmutter) groß geworden bin. Mein Vater blieb eigentlich ein Randgänger in meiner Welt als Heranwachsender. Eine Art Dauer- oder Stammgast der Familie. Da er als Handlungsreisender viel unterwegs war, passte das natürlich zu dem Eindruck, den er auf mich machte. Dies und die dominanten Mutterfiguren, ließen meinen Vater zwar männlich (auch im Sinne einer Unerreichbarkeit), aber blass und eindimensional aussehen. Seine berufsbedingte Absenz ist nicht der einzige Grund für sein schattenhaftes Dasein gewesen. Vielmehr blieb mir mein Vater emotional fern. Denke ich an ihn heute und will meine Eindrücke mit einem Wort zusammenfassen, kommt mir vor allen anderen Bezeichnungen das Wort „Gehemmtheit“ in den Sinn. Auch wenn ich über die Frage, wie er auf mich wirkte, länger nachgrüble, will mir kein besseres Wort dafür einfallen. Irgendwie wirkte seine Abwesenheit bei physischer Anwesenheit so, als sei er von seinen eigenen Kräften in einem existenziellen Sinn abgeschnitten worden.
IX. 1 Im Volkssturm – Die larvierten Grenzerfahrungen meines Vaters
Was sehe ich heute als den Hauptgrund für diese Gehemmtheit an, die meinen Vater charakterisierte?
Rufe ich mir sein Bild vor Augen – er ist jetzt dreißig Jahre tot – begegnet mir ein Mensch, der große Schwierigkeiten damit hatte, Gefühle zu zeigen. Dieses Problem hatte großen Anteil daran, dass wir uns später ganz entzweiten. Ich bin auch der Meinung, dass ihn diese Unfähigkeit nach dem Tod meiner Mutter (sie starb neun Jahre vor ihm, mit 51 an Krebs) in eine selbstzerstörerische Spirale getrieben hat. Auch mein Unverständnis der Blockade gegenüber, die mein Vater nicht überwinden konnte (worunter er sichtlich litt) trug natürlich dazu bei, dass sich die Fronten zu den Zeiten, in der ich selbst schon ein junger Erwachsener geworden war und mir in der Rolle des angry young man gefiel, verhärteten.
Wenn ich etwas Schlechtes über mich sagen soll, so ist hier ein guter, besonders passender Moment dafür gekommen, ein Moment, der quasi dazu einlädt. Denn schon in früher Jugend fand ich diebisches Gefallen daran, meine Umgebung über die Schmerzgrenze hinaus zu provozieren. Da konnte ich sehr grob, sehr ungerecht und penetrant werden. Das war die andere, die harte Seite meiner empfindsamen, introvertierten Seele, auf der allerdings auch gerne seitens meines Vaters und meines älteren Bruders herumgehackt wurde.
Wie ich schon sagte, rief diese Wahrnehmung, dass mein Vater irgendwie von seinem Gefühlsleben abgeschnitten worden sei, den Eindruck der Maskierung bei mir hervor. Sie verdunkelte den Blick auf meinen Vater. Mit dem Beginn eigenständigen Denkens wurde er für mich zu einer Rätselfigur, gleichzeitig aber war er marginalisiert. Alles, was ich brauchte und wonach ich verlangte, holte ich mir von meinen Müttern. Aber objektiv betrachtet musste ich es mir von ihnen holen, da mein Vater gefühlt zu 95 Prozent ausfiel.
Nur wenn er zuviel trank, stellte sich eine, wenn auch verquere Verbindung zu seinen Gefühlen her. Dann waren die Schwerfälligkeit und Schattenhaftigkeit plötzlich weg und er kam in Fahrt, redete sich in Rage. Heraus kam aber in der Regel eine kaum ungenießbare Mischung aus Wehleidigkeit (als meine Mutter noch lebte, kommentierte sie dies oft mit dem Satz: „Du bedauerst Dich wieder selbst!“) und Aggressivität, ein Jähzorn, von dem man merkte, dass sich da etwas stark in ihm aufgestaut hatte.
Ganz selten fiel die Maske so, dass ich es merkte und hellhörig wurde. Ich hatte schon erwähnt, dass mein Vater uns wenig aus seiner Vergangenheit erzählte. Ich kann mich aber an ein oder zwei Situationen am Küchentisch erinnern, wo in eigentlich gelöster, guter, doch zugleich intensiver Stimmung mein Vater vom Krieg zu erzählen begann. Ohne mich noch genau an die Details erinnern zu können, weiß ich, dass mir auffiel, dass mein Vater anders als sonst redete. In der Stimme und den Worten, so hatte man das Gefühl, brach sich etwas Bahn, was irgendwie verschüttet gewesen war. Doch dann begriff ich rasch, dass mein Vater seine Erfahrungen aus dem Krieg und seine Flucht daraus schilderte und erst da kam mir zum ersten Mal klar zu Bewusstsein, dass mein Vater den Krieg im Kampf ja miterlebt hatte!
Noch nicht 15-jährig habe man ihn, da er schon so erwachsen ausgesehen habe, für den Volkssturm, Hitlers letztes Aufgebot, rekrutiert. Ob er sich aus jugendlichem Übermut, aus Langeweile oder politischer Indoktrination selbst für den Volkssturm gemeldet hatte (meinem Vater fehlte in seinen wichtigsten Jahren der Entwicklung ja sein eigener Vater. Der war in den Krieg gezogen, als er sieben oder acht Jahre alt war) oder ob er in einem „Heimatschutz“-Verband ohne eigenes Zutun gelandet war, ist mir nicht bekannt. Es ist bei ihm aber wohl so abgelaufen, dass aus Schieß- und anderen militärischen Übungen, die ihm Spaß gemacht hätten machten und bei denen er sich als 14-jähriger in einem Fluidum von Abenteuer, Gefahr und vielleicht auch Heldentum austoben konnte, bald blanker Ernst wurde. Denn irgendwann im Winter 1944/45 rückte die Front dann näher und näher.
Als sein Verband (wohl eher eine versprengte Gruppe, schließlich war alles schon in Auflösung begriffen) Feindesberührung bekam, das heißt Rotarmisten auf nächste Nähe zur Stellung vorgerückt waren, auf der er Posten stand und Kampfhandlungen aufflammten, sei er zum ersten Mal völlig ungeschützt und sofort besonders heftig mit der Realität des Krieges konfrontiert worden. Mehrere seiner Kameraden seien bei den Kämpfen zu Tode gekommen. Überall sei Blut gewesen und er hätte schreiende Verletzte und auch Leichenteile gesehen, über diese Bilder als die Tonspur des Schreckens gelegt, höre er immer noch manchmal nachts und im Traum die laut ratternden Salven aus den Maschinengewehrläufen. So oder so ähnlich erzählte es unser Vater. Und dass es ihm gelang, irgendwie abzutauchen und diesem Inferno zu entfliehen. Er sei auf einen der letzten Züge, die von Schlesien gen Westen fuhren, aufgesprungen, und schaffte es sich dorthin abzusetzen, wo die US-Amerikaner eine Zone bereits besetzt hielten.
Bei seinen Schilderungen habe ich damals, glaube ich, nur kurz daran gedacht, dass ich ja ungefähr genauso alt bin wie er damals war, als er dem sinnlosen Tod auf dem Schlachtfeld nur um Haaresbreite entging. Aber erst jetzt glaube ich zumindest ansatzweise ermessen zu können, was diese Erfahrungen, von denen mein Vater in meiner Gegenwart nur ein oder zwei Mal sprach, für einen 14-Jährigen bedeutet haben.
Dazu habe ich einen Abschnitt über Kriegstraumata gefunden:
„Kriegserlebnisse können bei Kindern und Jugendlichen schwerste Traumatisierung zur Folge haben.
Erfahrungen wie der Tod der Eltern oder naher Verwandter, Bombardierung, Raketenbeschuss, Granaten, Explosionen, Flucht, Verlust von Haus und Heimat, langfristige Trennung von den Eltern, (...) Zeuge oder Zeugin von Ermordung, Erschießung, Folter gehören für Kinder in Kriegsgebieten zum Alltag.
Traumatische Ereignisse treffen ein Kind sowohl auf mentaler als auch auf physischer Ebene völlig unvorbereitet. Solche Ereignisse sind außergewöhnlich, unvorhersehbar und liegen außerhalb der normalen Lebenserfahrung eines jungen Menschen. (...)
Kinder und Jugendliche können innere Mechanismen entwickeln, u. a. die Strategie der Vermeidung, indem sie die eigenen Gefühle verdrängen, inneres Unbehagen und Wünsche nicht zur Kenntnis nehmen und eine positive Fassade vorspielen. (...)
Sehr oft wirken diese jungen Menschen selbstständig, selbstständiger als sie sind. Sie können emotional distanziert wirken, meiden Nähe und Freundschaft und sind oft sehr leistungsbereit.
Nach einem traumatisierenden Ereignis ist Stabilisierung besonders wichtig. Die Erregung, die jede traumatische Situation hervorruft, kann dadurch modifiziert und reguliert werden. Darüber reden fördert das Denken, Denken modifiziert Gefühle und Handlungsmöglichkeiten und die Bewältigungsstrategien werden dadurch vielfältiger.“ (32)
IX.2 Der Verzicht aufs eigene Leben: Die larvierten Erfahrungen meiner Mutter
Worin bestand das, was ich als die Larvierung von lebensgeschichtlich besonders wichtigen Erfahrungen bezeichnet habe, bei meiner Mutter?
Ich hatte bereits kurz angesprochen, dass der große Wunsch meiner Mutter Kunstgeschichte oder Archäologie zu studieren, nach dem Krieg unerfüllt blieb. Nach ihrer Ausbildung hatte sie nicht mehr gearbeitet, sondern meinen Großvater in beruflichen Angelegenheiten unterstützt. Auch krankheitsbedingt, nach ein oder zwei Herzinfarkten, Aufenthalten in Sanatorien usw. war er immer stärker auf die Hilfe seines einzigen Kindes angewiesen, das er wohl zu besitzergreifend sehr geliebt hat.
Die Sache mit dem Studium projizierte meine Mutter später stark auf ihre Kinder (darin kam exakt dieses: „Ich will, dass meine Kinder es mal besser haben als ich“ zum Ausdruck). Dass mein Bruder nicht studieren wollte, sondern lieber nach einer Lehre einen technischen Beruf ergriff und „nur“ Facharbeiter wurde, hat ihr stark zu schaffen gemacht. Sie selbst hatte in oder vielleicht auch schon vor der ersten Schwangerschaft, sich entschlossen zu Hause zu bleiben und sich ganz den Kindern, dem Haushalt und ihrer dann früh zur Witwe gewordenen Mutter zu widmen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass meine Mutter später diese Entscheidung bereut hat. Und am Schluss ging alles so schnell. Sicher aber hatte sie das Gefühl, etwas Wichtiges, Entscheidendes, Erfüllendes in ihrem Leben versäumt zu haben.
X. Der Verzicht auf das eigene Leben – als Kriegsfolge
Walter Benjamin: „Wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg.“ (33)
Der Traum vom eigenen Leben
Meine Mutter hat, als wir Kinder etwas größer waren, geklagt, sie wäre gern noch etwas anderes als unsere Putzfrau geworden.
Sie war eine gute, aber keine leidenschaftliche Köchin und Hausfrau, sie brachte unsere Wohnung und später unser Haus und, so muss man rückblickend sagen, unser aller Leben gut in Ordnung (denn als sie starb, zerbrach der innere Zusammenhalt der Familie schon bald), aber sie tat sich mit den Routinen dieses Lebens schwer und vor allem nagte wohl die Frage: „Soll das alles gewesen sein?!“ stark an ihr.
Dazu muss man wissen, dass sie ein sehr aufgeschlossener, neugieriger Mensch war, der sich für vieles interessierte, für ganz unterschiedliche Dinge begeistern konnte und gerne viel mehr von der Welt gesehen hätte. Ganz anders mein Vater. Wenn meine Mutter einen anderen Partner gehabt hätte, der sich selbst gern mit ihr zusammen hin und wieder aus dem Alltagstrott herausgerissen und Freude daran gehabt hätte, seine Frau zu entführen und zu verwöhnen, dann hätte sie vermutlich weniger unter der Hausfrauenrolle gelitten. So aber witterte sie mit den Jahren eine Art familiärer Verschwörung gegen sich.
Als ich etwa zwölf, dreizehn Jahre alt war, begann sie unabhängig von meinem Vater, der am liebsten allein in seinem Bastelkeller saß und seine Märklin-Eisenbahn dort im Kreis fahren ließ, sich einen eigenen Bekannten- und Freundeskreis aufzubauen, ging ins Theater, fuhr mit einem Freund der Familie zu Tennisturnieren in andere Städte, traf sich regelmäßig zum Schwof mit ihrem Damen-Kegelclub, ging mit ihrem zweitgeborenen Sohn, der früh einen Faible dafür entwickelte, gerne in Restaurants und auf kulinarische Kurzreisen in die nahe gelegenen Mutterländer der Haute Cuisine, Frankreich, Belgien, Luxemburg. Dennoch litt sie darunter, dass ihr Mann so gar nicht gern gemeinsam mit ihr etwas unternahm.
Mir vermittelten die Reisen mit meiner Mutter als Teenager, dass es noch etwas anderes als das Leben im schläfrigen und provinziell beengten Beamtenstädtchen Koblenz gab. Gleich hinter dem Schlagbaum begann in den frankophonen Nachbarländern eine Welt für mich, die, so klischeehaft das auch klingen mag, Freiheit, Abenteuer und eine intensivere, höhere Lebensart, das savoir vivre, versprach. Auch meine Mutter empfand das ähnlich; die kleinen Fluchten hatten etwas komplizenhaftes.
„Wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, dann werde ich mir endlich meinen Traum erfüllen“. Das hörten wir in den letzten Lebensjahren oft aus dem Mund meiner Mutter und sie sprach mit mir gern über ihren Plan irgendwo dort, wo ein schöner Flecken Erde ist, am besten in einer Weingegend, ein kleines Hotel zu pachten oder zu kaufen. Sie wollte es nach ihren Vorstellungen herrichten und einen Partner zu finden, der selber ein guter Koch ist oder einen guten Koch für das Restaurant, das dazu gehören sollte, anheuert, einen Partner, der mit ihr dieses Projekt, ihren Lebenstraum verwirklicht. Sie hätte sich von meinem Vater nicht scheiden lassen, aber der Gedanke, getrennte Wege zu gehen, schien sie aufatmen und Hoffnung schöpfen zu lassen: endlich keine Rücksicht mehr nehmen müssen! Endlich sein eigenes Leben leben können!
Sie hatte nicht nur all die Jahre auf ihre Kinder Rücksicht genommen, für die sie immer da war, wofür ich ihr immer dankbar bleiben werde, sondern auch auf ihre Mutter, die sie aus Mitleid und Verantwortungsgefühl ins Haus geholt hatte. Das versperrte ihr jetzt, wie sie merkte, den Schritt zum eigenen Leben, denn die Mutter wurde älter und gebrechlicher und vor allem noch anspruchsvoller in der Erwartung, dass ihre einzige Tochter sich um sie und ihre Neurosen kümmert. So war meine Großmutter, nachdem sie siebzig Jahre alt wurde, nicht mehr von dem Gedanken abzubringen, dass nichts mehr lohne, keine Anschaffungen mehr sinnvoll, keine Planungen mehr möglich seien, da sie ja nun bald stürbe. Tatsächlich sollte sie noch über zwanzig Jahre weiterleben und dabei in dieser Zeit drei Mal am Grab ihrer Nächsten stehen, erst am Grab ihrer Tochter, dann am Grab ihres ersten Enkels und schließlich am Grab ihres Schwiegersohns.
Meine Mutter ging zunehmend offensiv mit diesem Problem um, begehrte auf, schuf sich ihre eigenen Freiräume, was aber wohl viel Kraft kostete. Was bei meinem Vater die innere Blockade war, die ihn bedrängte, war bei ihr die äußere Blockade, der freilich eine innere korrespondierte: sich von Mutter, Mann und Kindern in ihrem Leben ausgebremst, an die Kette gelegt zu fühlen und in einen „goldenen Käfig“ gesperrt leben zu müssen. Den Ausdruck „goldener Käfig“ benutzte meine Mutter öfter. Ich fand ihn übertrieben, schließlich lebten wir weder im Palast, noch fuhr mein Vater einen Porsche, nicht einmal einen Mercedes. Wenn du im Wohlstand aufwächst, dabei aber nicht von dessen typischen Statussymbolen umgeben bist, ist das alles ganz normal für dich. Es sei denn, du hast gute Freunde, die arm sind, und die hatte ich nicht. Erst später habe ich erkannt, wie privilegiert mein Zuhause war.
Trotzdem war etwas verlarvt in ihr, was zum Ausbruch kam, als sie, kaum war der zweite Sohn aus dem Haus (ich war damals gerade frisch an der Uni in Frankfurt am Main eingeschrieben, besuchte als Erstsemester die Seminare und Vorlesungen – das meiste verwirrte mich sehr –, und hatte meine erste eigene Wohnung bezogen) an Krebs erkrankte und nur drei Monate nach der schrecklichen Diagnose starb. Ich brauchte Jahre, um mich nach ihrem Tod wieder zu fangen. Das waren die dunklen Jahre meines Lebens. An sie denke ich nur höchst ungern zurück.
XI Schluss: Der Krieg als schlimmster Exterminator menschlicher Möglichkeiten
Krieg tötet und verstümmelt nicht nur Menschen, zerstört nicht nur materielle und immaterielle Werte und die Natur. Krieg vernichtet auch menschliche Lebenschancen.
Krieg zeitigt immer, auch dann, wenn man äußerlich mit heiler Haut davonkommt, eine Engführung, Verarmung des Lebens. Lebensengführung bedeutet, dass menschliche Möglichkeiten, das Potenzial zur Entfaltung persönlicher Anlagen und Neigungen absterben oder gänzlich getilgt, ausradiert werden. Dieses Absterben von Freiheit und dieses Tilgen oder Ausradieren von Neuem erzeugt jede Menge Leid. Unserer Existenz werden dadurch Sinn, Glückserfahrungen, Erfüllung, Zufriedenheit und Anerkennung vorenthalten. Und im Kriegsfall werden sie uns geraubt.
Zwei besonders schlimme Exterminatoren menschlicher Möglichkeiten gibt es daher: Die Armut und den Krieg. Der Krieg ist der schlimmste, weil man sich, anders als bei der Armut, an ihn nicht gewöhnen kann. Gewöhnt man sich an den Krieg, dann um den Preis, alles Menschliche aufgeben zu müssen.
Das Leuchten der Jugend besteht darin noch voller Möglichkeiten zu sein.
Vor diesem Horizont sehe ich auch das meinem Text vorangestellte Zitat aus Sean O‘ Caseys „Der Preispokal“. Kurz zum Inhalt des Theaterstücks:
„Der Pokal ist eine Fußball-Trophäe, die der F. C. Avondales dem Entscheidungstor verdankt, das Harry Heegan schoss. Er und seine Kameraden müssen in den Ersten Weltkrieg, und als sie wiederkommen, gibt es ein paar Krüppel in der ehemaligen Mannschaft. Harrys Beine sind gelähmt, sein Mädchen tanzt mit einem anderen, er wirft ihr den Preispokal vor die Füße und hadert mit Gott und der Welt.“ (34)
Interpretiert man das Zitat des irischen Schriftstellers, so sind mit dem Krieg der Glanz und die innere Spannkraft des Lebens dahin. Durch diesen Verlust kehren alle Versprechungen des Lebens verkrüppelt von den Schlachtfeldern heim. Aus dem Spiel ist bitterer Ernst geworden. Der Preispokal ist verloren, auch dann, wenn man ihn gewinnt.
Deshalb – und weil nichts mehr so sein wird wie es war, als es anfing – „werden kräftige Beine nutzlos und strahlende Augen dunkel“, wie es O‘ Casey anschaulich und schön traurig ausdrückt.
Über die Wünsche und Träume meines Vaters, über seinen „Preispokal“, habe ich nie mit ihm gesprochen. Heute frage ich mich, wieso ich ihn nicht einfach mal danach gefragt habe. Aber dieses eine Mal gab es nicht. Die Wünsche und Träume meiner Mutter hingegen waren in meiner Jugend durchaus präsent, begegneten mir aber doch eher als eine Form von Leid. Das machte etwas mit mir. Es hat in mir das Gefühl bestärkt, meinen eigenen Weg gehen zu wollen und dabei keine faulen Kompromisse zu machen. Ich bekam eine Vorstellung davon, was zu viel falsche Rücksichtnahme auf andere für Dich selber heißen kann und dass es in der Familie auch um Macht über andere, nicht nur um Liebe, gegenseitiges Verständnis und altruistisches Füreinander-Sorgen geht.
An diesem Punkt komme ich nun auf das längere Zitat von Erich Fromm aus dem Vortrag „Zur Theorie und Strategie des Friedens“ zurück, das ich meinem Essay ebenfalls vorangestellt habe. Mit diesem Zitat kann gut zur Koda meiner Überlegungen übergeleitet werden. Fromm betont darin, dass bedeutende und lange auf den geschichtlichen Prozess einwirkende Nebenerscheinungen des Krieges in „der Verdummung, der Lähmung der Vitalität, der Einbildungskraft“ und „dem Schöpferischsein des Menschen“ liegen. Er gibt zu bedenken, dass diese Folgen kriegerischen Handelns „für die (…), die die Gewalt ausüben“ nicht von Nachteil, sondern im Gegenteil durchaus intendiert sein können, da aus diesen Nebenerscheinungen für die Herrschenden zusätzlicher Nutzen gezogen werden kann.
Am Schluss möchte ich daher näher auf das Phänomen der Traumatisierung durch Kriegshandlungen und Kriegsfolgen eingehen, das näher untersucht werden muss, sofern wirklich Aufklärung über die von Fromm benannten Symptome „der Verdummung, der Lähmung der Vitalität, der Einbildungskraft und dem Schöpferischsein des Menschen“ gewollt ist. Wir werden sehen, dass und wie daraus eine Lehre entwickelt werden kann, in der das Persönliche – meine Familiengeschichte – mit dem Allgemeinen – der Mobilisierung der Gesellschaft zu Militarismus und Krieg als Herrschaftsmittel bzw. die Verweigerung der Mobilisierung als Widerstand gegen solch eine Herrschaft – konvergiert.
Für Fromm stand außer Frage, dass die Theorie des Friedens „eine Theorie vom Menschen, eine Theorie von der Gesellschaft und eine Theorie von der Interaktion zwischen Mensch und Gesellschaft erfordert, und zwar eine dynamische Theorie, die von den sichtbaren und noch nicht-manifesten Kräften handelt, die sowohl im Menschen wie in der Gesellschaft vor sich gehen.“
Bedeutung und Wirkungsweisen des Kriegstraumas
Das Zitat von Fromm über die Nebenerscheinungen des Krieges und seine Rede über den Anteil der nicht- bzw. noch nicht manifesten Kräften führen mich an der Stelle zur Trauma-Problematik, weil sich m.E. hinter ihr etwas verbirgt, was aufzuschlüsseln für eine Theorie des Friedens heute von größter Wichtigkeit wäre. Damit schließe ich zugleich nochmal an das Benjamin-Zitat „Wer den Frieden will, rede über den Krieg“ an, denn das „Reden über den Krieg“ – genauer das Reden darüber, was es heißt, nicht heil aus dem Krieg wieder herausgekommen zu sein, also die nicht bewältigten und verarbeiteten Belastungen mit sich herumzuschleppen und weiterzugeben – ist in den Generationen unserer Eltern und Großeltern unter einem Berg von Traumata verschüttet und bis heute nicht geborgen worden.
Diese Traumata sind angesichts der vitiösen massenpsychologischen Mechanismen, so wie sie in der Corona-Plandemie generalstabsmäßig Anwendung fanden (ich erinnere hier nur an das Strategie-Panikpapier aus dem Bundesinnenministerium vom März 2020) und angesichts akuter Kriegsgefahr, gezielter Angsterzeugung und Gehorsamkeitsproduktion durch die Cognitive Warfare (Kognitive Kriegsführung) erneut stark virulent geworden.
Unter Traumapsychologen besteht heute ein breiter Konsens darüber, dass die Gesellschaft an den Folgen einer kollektiven Traumatisierung leidet, die durch den Zweiten Weltkrieg verursacht wurde.
In einem interessanten Aufsatz von Susanne Wolf, der im Mai 2025 vom Multipolar-Magazin veröffentlicht wurde (35), wird dazu die Traumatherapeutin Dami Charf mit den Worten zitiert, dass manche Trauma-Forscher „von einer verdeckten Epidemie“ von Entwicklungstraumata sprechen. Entwicklungstraumata hätten „gravierenden Einfluss auf das Verständnis der Welt, von sich selbst und der eigenen Sicherheit“. Es sei davon auszugehen, dass „traumatische Erfahrungen (…) unser Leben massiv beeinflussen.“ (36)
In diesem Kontext dürfte die Corona-Krise als wichtigste Zäsur in der Nachkriegszeit anzusehen sein, in der dieses kollektiv latent wirkende Trauma erneut zum Ausbruch gebracht wurde. Wolf zitiert hier die Psychotherapeutin und Traumaexpertin Michaela Huber, die die „ganze Corona-Krise als eine Art gesellschaftlicher Schock“ bezeichnet. (37)
Transgenerationale Weitergabe des Traumas und Traumaheilung
Dabei ist wichtig zu wissen, dass Traumata über Generationen weitergegeben werden. Allerdings so, dass „die sichtbaren Auswirkungen manchmal eine Generation überspringen.“ Misst man danach den Zeitabstand zwischen dem Traumaherd und dem Moment seines Wiederaufflammens, wird die Annahme plausibel, dass die Auswirkungen in den letzten fünf Jahren die gesamtgesellschaftliche Sichtbarkeitsgrenze signifikant überschritten haben. In Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, so schreibt Susanne Wolf, „würden Traumaforscher davon ausgehen, dass unsere Gesellschaft an den Folgen eines kollektiven, transgenerationalen Traumas, leidet“. Dabei wird allgemein auf die Rolle der Umweltfaktoren und Lebenserfahrungen als Faktoren hingewiesen, die die Gene beeinflussen. Traumata werden aber nicht eins zu eins weitergegeben, vielmehr ist davon auszugehen, dass sie ihre Gestalt und ihre Erscheinungsweisen ändern.
Einen Weg zur Traumaheilung, auf den Wolf verweist, hat Thomas Hübl, Autor und Mitentwickler des Collective Trauma Integration Process, aufgezeigt: „Wenn eine Person eine individuelle Geschichte erzählt, geht eine Heilungswelle durch die Nervensysteme, die sich auf das Kollektiv“ auswirke. Auch durch künstlerischen Ausdruck werde „nicht-gesehenes sichtbar und Unausgesprochenes hörbar gemacht“. (38)
Diese Methoden sind als Schlüssel anzusehen, um Traumata, d.h. die darin verkapselten oder larvierten und abgespaltene Erfahrungen, produktiv bearbeitbar zu machen und eine Heilung zu erreichen.
Wer inneren wie äußeren Frieden will, muss das Schweigen und die Abwehr durchbrechen, also vom Krieg und dem, was ihm/uns im Krieg widerfuhr, reden. Solange wir unter dem Bann des Verschweigens stehen und uns nicht selbst ermächtigen, wird man immer wieder „Rettung ausgerechnet von jenen (...) erhoffen, die eigentlich ihre (unsere) Peiniger sind“ (Arno Gruen). Erforderlich dafür ist aber eine gemeinsame gesellschaftliche Anstrengung. Ein Klima der Offenheit und Achtsamkeit für diese Phänomene müsste Voraussetzung sein, damit solche individuellen Prozesse gefördert und überhaupt wahrgenommen werden können.
Sind diese Möglichkeiten, wie derzeit, nicht gegeben, fehlt weiterhin die Bereitschaft zu einer ernsthaften (nicht bloß selektiven und ritualisierten) Aufarbeitung des geschichtsmächtigen Traumas des Zweiten Weltkriegs, ist zu befürchten, dass der dem Trauma inhärente Lernvorgang sowohl individuelle weiter krankmachende Überforderungen als auch gesellschaftlich einen noch höheren Anpassungs- und Konformitätsdruck produziert. Wichtig zum Verständnis der Problematik ist, dass Traumata, die zu einer Identifizierung mit dem Aggressor führen, nur aus einer Situation der Angstüberwältigung entstehen. Die Identifizierung mit dem Aggressor ist, wie der Psychologe und Psychoanalytiker Arno Gruen schreibt, „eine Reaktion äußerster Hilflosigkeit“. Für die Psychoanalytikerin Sue Grand, erfüllt sie „die Funktion, das Ausmaß des Missbrauchs weiterhin leugnen zu können.“ Für Sándor Ferenczi „halten die Betroffenen so die Bindung an den misshandelnden Elternteil aufrecht.“ (39) Arno Gruen schreibt:
„Das, was Gehorsam bewirkt und zugleich steuert, ist ein uralter Mechanismus, dessen Wurzeln in früher Kindheit liegen, als wir dem Versuch der uns versorgenden Erwachsenen ausgesetzt waren, uns ihren Willen aufzuzwingen. Diese Erfahrung bedroht jedes Kind mit dem Erlöschen seines eigenen, gerade im Keimen begriffenen Selbst. Das Ergebnis dieses Prozesses ist, dass gerade solche Kinder, deren Willen besonders stark einem Ausmerzen unterworfen war, einen verhängnisvollen Gehorsam und Treue gegenüber Autoritäten entwickeln.“ (40)
Die Überforderungssituation wirkt sich toxisch auf das Zusammenleben aus. Genauer qualifiziert Wolfgang Schmidbauer (41) den durch die Traumatisierung ablaufenden innerpsychischen Lernprozess: „Das seelische Trauma ist ein Lernvorgang, in dem bestimmte Verhaltensweisen in einer ungerechtfertigten Verallgemeinerung erworben werden. (…) Die Abwehr des Traumas erfolgt durch Identifizierung mit dem Angreifer.“ Der Hass auf den Verursacher des Traumas wird in sein Gegenteil verkehrt, weil dadurch die Angst vor dem hasseinflößenden Objekt vermindert wird. Als Beispiele nennt Schmidbauer „ein Kind, dass den Gesichtsausdruck des Lehrers nachahmt, vor dem es besondere Angst hat, oder einen Lehrer, der die Ausdrucksweise eines Vorgesetzten kopiert, den er zutiefst hasst.“ (42)
Für Arno Gruen ist die Abwehr des Traumas gleichbedeutend mit der Quelle für die Entstehung von Feindbildern. „Das Eigene“, das von den Eltern vernachlässigt, missachtet, bestraft wird, „wird (...) zum Fremden, um es dann außerhalb der Grenzen des eigenen Selbst zu bestrafen. (...) Der innere Feind, der mit dem Fremden identisch ist, ist jener Anteil im Kind, der verwirkt wurde, weil Mutter oder Vater oder beide ihn verwarfen, wenn es auf seine eigene Sicht bestand. (...) Der Hass auf das Eigene bringt Kinder hervor, die sich nur noch (...) erleben können, wenn sie diesen Hass nach außen wenden können.“ (43)
Die „ungerechtfertigte Verallgemeinerung“ eines womöglich qua Traumatisierung induzierten Lernvorgangs, der den Hass auf den Verursacher des Traumas verleugnet, den Verursacher idealisiert und daher den Hass nach außen wenden muss, um seine Ich-Schwäche zu überdecken, ist in Bezug auf die Bewertung und Behandlung des Russland-Ukraine- und des Gaza-Konflikts im herrschenden deutschen Mainstream mit Händen zu greifen. Hier kann besichtigt werden, wie die eigenen Bedürfnisse missachtet werden, die moralische Integrität beschädigt und die Entwicklung zur eigenen Autonomie unterdrückt wird.
Identifikation mit dem Angreifer – Deutsche Geschichtsumschreibung als Traumafolge?
Die Nachfahren der Täter des größten Verbrechens des Zweiten Weltkrieges „verallgemeinern“ den russischen Angriff auf die Ukraine nicht nur dahingehend „ungerechtfertigt“, dass sie sich durch das Weglassen bzw. Verzerren seiner Historie moralischen Dispens über die von ihren Großeltern und Urgroßeltern getöteten 27 Millionen Menschen der Sowjet-Republiken, nach Überfall des Hitler-Reichs auf die Sowjetunion am 22.6.1941, erteilen. Welche Erleichterung für das so lange schuldbeladen in Sack und Asche gehende Land! Darüber hinaus wähnen sie sich im Recht, im Namen von Anti-Faschismus, Frieden, Demokratie und Menschenrechten ihre eigenen Waffen erneut gegen die Menschen in Russland zu richten, um ein teils krypto-faschistisches, teils offen faschistisches Regime in der Ukraine zu verteidigen. Der Überhöhung des Objekts – mit der Ukraine verteidigen wir unsere Demokratie und alles, was uns lieb und teuer ist; fällt die Ukraine so werden wir dem aggressiven Ivan auch in die Hände fallen – korrespondiert mit der Dämonisierung Putins als neuem Hitler.
Hinzu kommt, dass der Antisemitismus als „deutsche Staatsräson“ immer absurdere Blüten treibt: In der Ukraine duldet man Antisemitismus und die ihn legitimierende faschistische Ideologie nicht nur, sondern man unterstützt beides. In Bezug auf Israel und den Völkermord der dortigen, ebenfalls mit Faschisten und ultrarechten Zionisten durchsetzten Regierung an den Palästinensern im Gaza-Streifen, stellt man sich schützend vor diese Faschisten und zionistischen Rassisten, die die Palästinenser entmenschlichen, bevor sie sie – auch mit deutschen Waffen – wahllos töten. In Deutschland hingegen rahmt man jede vergleichsweise harmlose Kritik an Migranten als Nazi-Hassrede und würde sie denunziatorisch am liebsten verfolgen. Dort aber wird jeder Palästinenser, werden auch Kinder, zu Hamas-Terroristen, mindestens aber Terror-Kollaborateuren oder willfährigen Werkzeugen (der von Israel erst groß gemachten) Hamas gestempelt, weshalb sie an ihrem Tod letztlich selber schuld seien.
Dabei entgeht den sich „Israelfreunde“ nennenden Akklamateuren und Beihelfern zum Völkermord, dass Kollektiv- (Vor-)Urteile über Völker und die Reduktion von Individuen auf eine einzige Eigenschaft, ihre Zugehörigkeit zu einer Gruppe, immer schon der beste Nährboden für genuin faschistisches Gedankengut waren. Arno Gruen bemerkt: „Diese Abstrahierung macht ein emphatisches Erleben des andern unmöglich.“ Empathie aber „sei die Schranke zur Unmenschlichkeit und der Kern unseres Menschseins.“ (44)
Den symbolhaften Höhepunkt dieser Identifikation mit dem Aggressor, in dessen Zuge die Umschreibung, der Revisionismus der eigenen Geschichte auf dem weggebrochenen Fundament von menschlicher Anteilnahme, Einfühlungsvermögen und gegenseitigem Verstehen, die nichts mehr gelten sollen, mit Hochdruck von statten geht, markiert bislang der 8. Mai 2025, konkret die offizielle Gedenkfeier der Bundesrepublik im Deutschen Bundestag zum Kriegsende vor achtzig Jahren am 8. Mai 1945. Obwohl ohne die sowjetische Rote Armee die Befreiung Deutschlands vom Nazi-Regime noch länger gedauert hätte und die Rote Armee mit Abstand die meisten Opfer in diesem von Nazi-Deutschland als Vernichtungsfeldzug gegen Russland geführten Krieg zu beklagen hatte, verweigerten die Repräsentanten des Täter- und Aggressorenvolks im Berliner Reichstag und auch an vielen anderen offiziellen Gedenkorten Russland und Weißrussland ein Mindestmaß an diplomatischem und menschlichem Respekt.
Die Repräsentanten der Täternation entschieden in geschichtsblindem, moralischem Hochmut, ihre Opfer vom Gedenken auszuschließen. Sie fügten dem schweren Unrecht der Tat ein schweres Unrecht des Erinnerns hinzu. Eine bemerkenswerte Verharmlosung der nationalsozialistischen Gräueltaten paarte sich mit dem stolz vorgetragenen, verantwortungsethisch fatalen Eigenlob, man habe aus der Geschichte gelernt.
Neben der moralischen Widerwärtigkeit, ja Schändlichkeit, die aus diesen Vorgängen sprechen, die auf Entscheidungen deutscher Amtsträger zu einem Zeitpunkt zurückgehen, wo der Frieden zwischen Russland und der Ukraine zum ersten Mal nach drei Jahren wieder in greifbare Nähe gerückt ist, müssen sie auch politisch als ein unüberlegter, dummer und selbstschädigender Akt gewertet werden. Denn, so kommentierte das Schweizer Journal21 die Vorgänge:
„Der Feind von heute wird irgendwann wieder zum Nachbarn, mit dem man Verträge schließt. Das erscheint gegenwärtig in Bezug auf Russland undenkbar. Aber auf die Dauer ist es unausweichlich. Auch daran könnte eine Gedenkfeier erinnern und vor den russischen Gästen den Wunsch zum Ausdruck bringen, dass diese Zeiten nicht allzu lange auf sich warten lassen.“ (45)
„Keiner kommt heil aus dem Krieg wieder raus!“
Eingedenk der transgenerationalen Wirkungsweisen des Weltkriegstraumas, ist es unumgänglich, dass, wenn Krieg und Faschismus sich nicht wiederholen sollen, die obige Erkenntnis sowie das, was aus dieser Erkenntnis folgt, öffentlich, breit und intensiv auf nationaler Bühne diskutiert werden muss. Was der Satz millionenfach und doch jeweils ganz individuell bedeutet, gilt es gerade mit Blick auf den gefährdeten Zustand, in dem sich die Republik heute befindet, zu beleuchten. Ich bin mir sicher, dass aus der Vielzahl an (noch nicht) erzählten Geschichten und (noch nicht) gehaltenen Reden über den Krieg, seinen Interpretationen und Evokationen, wie als Folge eines Dominoeffekts, ein ganzes Diskursuniversum den Raum für die richtigen und dringend notwendigen, da überfälligen Schritte zur Verbesserung (= Zivilisierung) unseres Gemeinwesens und zur Stärkung seiner politischen Kultur schaffen kann. Diese Erneuerung der politischen Kultur muss, so lautet meine These, beim Erinnern ansetzen.
Am Beispiel meiner Familie habe ich mit diesen Erinnerungen meine persönlich grundierte Warnung vor Krieg und Faschismus zu formulieren versucht. Nur dank der Friedenstaube, d.h. nur weil ich wegen der Friedenstaube überhaupt begann, mich mit meinem persönlichen Bezug zum Thema Krieg und Frieden auseinanderzusetzen, bin ich zu der Erkenntnis des besonderen Wertes gelangt, der im persönlichen (nicht im rhetorisch-formelhaft vorgestanzten) Reden über Krieg und Faschismus liegt.
Deshalb finde ich das Pareto-Projekt der unzensierbaren Friedenstaube auch so wichtig, weil genau das sein Anliegen ist: Das Pareto-Projekt möchte diese Erkenntnis – wie sie mir jetzt, aber erst nach diesem Durchgang durch meine Familiengeschichte, unmittelbar vor Augen steht – stiften und kommunizieren!
Bedenkt man, dass laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend über 50% der Bevölkerung der gefährlichen und sozial bedrohlichen Aufrüstung zustimmen (also sich massiv gegen ihre eigenen Interessen aussprechen) und sieht man sich die Schwäche der Friedensbewegung an, wird vor dem Hintergrund der Erkenntnisse der Traumaforschung die Notwendigkeit einer tiefergehenden und differenzierteren Ursachenanalyse deutlich.
Natürlich muss man hier fragen, wie es dazu kommen kann, dass mehr als jeder Zweite – ähnlich wie bei Corona, wo es noch mehr gewesen sein dürften – einem fiktiven Bedrohungsnarrativ glaubt, das ihnen eingehämmert wird, obwohl sich dieses Bedrohungsnarrativ und seine Folgen klar gegen die Interessen der allergrößten Bevölkerungsmehrheit richtet. Dann wird klar, dass es nicht ausreicht, solche Befunde und Ergebnisse allein „auf eine zugespitzte Propaganda (...) und Meinungsmache“, die „Gehirnwäsche in Rekordzeit“ ermöglicht habe, zurückzuführen (46). Es muss auch eine spezifische innerpsychische Disposition dafür geben, eine Disposition, die uns auf die Spur des Traumas bringt.
Die lange anhaltenden Traumatisierungen als Ursprünge für diese psycho-sozialen Fehlentwicklungen, müssen für die Analyse der grassierenden Un-Friedfertigkeit in unserem Land unbedingt mit herangezogen werden, um zu erklären, wie der Friedenskonsens in der Bundesrepublik so schnell und widerstandslos aufgekündigt werden konnte. Dabei muss insbesondere daran gegangen werden, die psycho-sozialen Wurzeln der „Freiwilligen Knechtschaft“ aufzudecken, über die vor über fünfhundert Jahren der Richter, Philosoph und Freund Michel de Montaignes, Étienne de La Boétie (1530-1536), einen noch immer brandaktuellen Essay (47) geschrieben hat.
Psychogenetisch gälte es dafür, den Entwicklungspfad dieser Identifizierung mit dem Aggressor zurückzuverfolgen. Indem man sich die Mechanismen und Projektionen dieses Lernvorgangs vergegenwärtigen würde und dagegen im Sinne Walter Benjamins anspräche, könnte man hinter das Geheimnis des inneren Zwiespalts steigen. Dann ließe sich erkennen, dass der Zwiespalt, unter dem man leidet, selber Produkt eines Gehorsams ist, den man nur aufbringen und leisten kann, weil man von sich selbst entfremdet wurde:
„Besondere Bedeutung gewinnt dieses Problem im Hinblick auf jene Phase (...) des unglücklichen Bewusstseins, in der die Wir-gegen-sie-Mentalität mit ihrer Betonung der Gegensätze überwunden wird und der Mensch erkennt, dass die Knechtschaft auf rätselhafte Weise seinen eigenen Wünschen entspringt.“ (48)
Abschließend, sozusagen als Quintessenz meiner Ausführungen zur Traumatisierung, die in einen Merk-Satz gefasste Forderung:
Die politischen Konsequenzen der Identifikation mit dem Aggressor müssen in der Bundesrepublik für eine nachhaltige Friedensarbeit, Friedenserziehung und Friedensfähigkeit aufgeklärt und aufgearbeitet werden.
Da die Reste der „Friedensdividende“ der Nachkriegsordnung von kriegsgeil gewordenen europäischen Politikern gerade verspielt werden, läuft, wo doch zugleich das Verdrängte stark zur Wiederkehr drängt, die Zeit sonst dafür ab.
Fußnoten
29 Online-Projekt Gefallenendenkmäler Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, http://www.denkmalprojekt.org/2012/eggenfelden_lk-rottal-inn_wk2_bay.html
30 https://patents.google.com/patent/US2652611A/en, https://patents.google.com/patent/DE1435791A1/en?inventor=Jaster+Erich+Hermann+Ernst
31 Alle Zitate und Angaben aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Luftangriffe_auf_Koblenz, letzter Zugriff 15.05.2025.
32 Kriegstrauma bei Kindern und Jugendlichen, http://www.whywar.at/whywar-im-unterricht-nutzen/whywar-fuer-lehrerinnen/kriegs-trauma-bei-kindern-und-jugendlichen/, letzter Zugriff am 15.05.2025.
33 Siehe dazu: Rudolph Bauer, „Wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg“, Vortrag auf der Jahrestagung der Neuen Gesellschaft für Psychologie in Berlin am 11.4.2025, http://www.nrhz.de/flyerbeitrag.php?id=29464
34 https://www.suhrkamptheater.de/stueck/sean-o-casey-der-preispokal-tt-100496
35 https://multipolar-magazin.de/artikel/eine-traumatisierte-gesellschaft, 16.05.2025.
36 Ebd.
37 Wolf, ebd.: „Gründe für die Traumatisierung habe es viele gegeben: rigorose freiheitseinschränkende Maßnahmen, Angst vor einem tödlichen Virus, Existenzangst derjenigen, die schlagartig alleingelassen waren, aber auch von Selbständigen, Geschäftsinhabern oder Künstlern.“ Hinzu sei „der Druck durch die Impfung und der Ausschluss der ‚Ungeimpften‘ wie auch schon vorher die Ausgrenzung derer“ gekommen, „welche die Maßnahmen als ungerechtfertigt kritisierten.“ Dies und die „(fast) Gleichschaltung der öffentlich-rechtlichen und restlichen Mainstream-Medien“ hätten „eine tief verunsicherte und gespaltene Gesellschaft hinterlassen.“
38 Wolf, ebd.
39 https://www.philomag.de/artikel/sue-grand-als-analytikerin-kuemmere-ich-mich-um-die-kulturellen-und-historischen-wunden, 19.06.2025.
40 Arno Gruen, Die Konsequenzen des Gehorsams für die Entwicklung von Identität und Kreativität, https://www.lptw.de/archiv/vortrag/2003/gruen-arno-konsequenzen-des-gehorsams-auf-entwicklung-von-identitaet-und-kreativitaet-lindauer-psychotherapiewochen2003.pdf, 12.04.2003.
41 Wolfgang Schmidbauer, Lexikon Psychologie, Reinbek bei Hamburg, 2001, S.210.
42 Schmidbauer, a.a.O., S.121.
43 Arno Gruen, Die politischen Konsequenzen der Identifizierung mit dem Aggressor, https://web.archive.org/web/20240420223140/http://bidok.uibk.ac.at/library/beh1-00-identifikation.html
44 Gruen, ebd.
45 https://www.journal21.ch/artikel/gedenken-das-kriegsende-ohne-russland, 24.04.2025.
46 So Tobias Riegel in den NachDenkSeiten vom 05.06.2025: „Na, herzlichen Dank an alle Rüstungs-Propagandisten – Wegen Euch unterwerfen sich die Bürger massenhaft einem irren ‚Fünf-Prozent-Ziel’“.
47 Ètienne de La Boétie, Abhandlung über die Freiheit, Innsbruck, 2019.
48 Richard Sennett, Autorität, Frankfurt/M. 1990, S.160.
Teil 1 des Essays von Bernd Schoepe:
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=29563
Online-Flyer Nr. 851 vom 05.09.2025
Erkundungen zu (m)einer anti-militaristischen Mensch-Werdung - Zugleich eine Reflexion über die Grundlagen heutiger Friedenserziehung - Teil 2
"Keiner kommt heil aus dem Krieg wieder raus!"
Essay von Bernd Schoepe
 „Es handelt sich beim Krieg nicht nur um eine Zerstörung von (...) Millionen Menschen, sondern um die Zerstörung der gesamten sozialen, moralischen und menschlichen Struktur einer Gesellschaft, von der man überhaupt nicht voraussehen kann, welche weiteren Konsequenzen an Barbarei, an Verrücktheit sie (...) mit sich bringt. (..) Die Gewalt kann fast alles mit den Menschen machen. Es ist wichtig zu sehen, dass es nur fast alles ist. Sie kann mit einigen Menschen nicht das machen, was sie will, nämlich ihre seelische Struktur, ihre Überzeugungen ändern und mit allen Menschen kann sie nur das machen, was sie will, wenn sie gewisse, sehr schädliche Nebenerscheinungen in Kauf nimmt: die Nebenerscheinung der Verdummung, der Lähmung der Vitalität, der Einbildungskraft, dem Schöpferischsein des Menschen. In vielen Fällen aber sind die, die die Gewalt ausüben gar nicht daran interessiert, dass diese Folgen nicht eintreten. Im geschichtlichen Prozess allerdings bleiben diese Folgen von großer Wichtigkeit.“ (Erich Fromm: Zur Theorie und Strategie des Friedens, 1969)
„Es handelt sich beim Krieg nicht nur um eine Zerstörung von (...) Millionen Menschen, sondern um die Zerstörung der gesamten sozialen, moralischen und menschlichen Struktur einer Gesellschaft, von der man überhaupt nicht voraussehen kann, welche weiteren Konsequenzen an Barbarei, an Verrücktheit sie (...) mit sich bringt. (..) Die Gewalt kann fast alles mit den Menschen machen. Es ist wichtig zu sehen, dass es nur fast alles ist. Sie kann mit einigen Menschen nicht das machen, was sie will, nämlich ihre seelische Struktur, ihre Überzeugungen ändern und mit allen Menschen kann sie nur das machen, was sie will, wenn sie gewisse, sehr schädliche Nebenerscheinungen in Kauf nimmt: die Nebenerscheinung der Verdummung, der Lähmung der Vitalität, der Einbildungskraft, dem Schöpferischsein des Menschen. In vielen Fällen aber sind die, die die Gewalt ausüben gar nicht daran interessiert, dass diese Folgen nicht eintreten. Im geschichtlichen Prozess allerdings bleiben diese Folgen von großer Wichtigkeit.“ (Erich Fromm: Zur Theorie und Strategie des Friedens, 1969)„Solange Kriege geführt werden, wird uns Kummer plagen, werden kräftige Beine nutzlos werden und strahlende Augen dunkel.“ (Sean O’ Casey: Der Preispokal)
VI Ein dörfliches Idyll: So nah am Krieg und doch – zum Glück – so weit davon entfernt!?
Zwischenfazit: Unter die Teile eins bis vier von „Keiner kommt heil aus dem Krieg wieder raus!“ könnte man – wenn man die darin angestellten Überlegungen und Analysen auf meine Person zurückbezieht – einen Strich ziehen und Folgendes als persönliches Zwischenresümee festhalten:
Nun, in meinem 60. Jahr, sehe ich mich mit Bedrohungen meines Lebens durch einen von Politikern wieder einmal leichtfertig aufs Spiel gesetzten Frieden und einer vom Sicherheits- und Kontrollwahn der Reichen und Mächtigen langsam erstickten Freiheit konfrontiert. Gefahren, von denen ich vor noch nicht allzu langer Zeit annahm, sie würden uns nurmehr als ein Gegenstand historischer Reminiszenzen und Zitate zum Nachdenken bringen.
Wie gesagt, hatte ich zunächst nie vor, ein Kapitel über Krieg und Frieden im Licht der eigenen, persönlichen Erfahrungen zu schreiben.
Nun scheint mir, dass ich jetzt, am Beginn meines letzten Lebensalters, von Entwicklungen eingeholt werde, vor denen ich mich aufgrund meines historisch gut bestirnten Geburtsjahres, lange, viel zu lange in Sicherheit wähnte. Angesichts der sich objektiv verdüsternden Aussichten und dem Wetterleuchten des Katastrophischen am gefährlich dräuenden, gewittrig donnernden Horizont meiner Gegenwart, ist daher die Zeit für einen persönlichen Rückblick tatsächlich vielleicht gekommen.
***
Geboren wurde ich 1965, 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Merkwürdigerweise ist mir erst in den letzten Jahren zu Bewusstsein gekommen, wie kurz die Zeitspanne zwischen meiner Geburt und dem Kriegsende doch war!
Im ersten halben Jahrhundert meiner Existenz war die Frage nach Krieg oder Frieden recht weit von den persönlichen Gefühls- und Gedankenlagen entfernt. Ursache dafür war, dass der vergleichsweise idyllische Mikrokosmos, in den ich hineingeboren wurde, gar nichts vom Krieg zu enthalten schien – jedenfalls nichts Sichtbares mehr. Soweit ich mich erinnern kann, erschien kaum etwas in meiner Wahrnehmung, was auf diesen Weltenbrand noch verwiesen hätte. Nahezu alle Spuren schienen getilgt zu sein - und das nach nur einem Vierteljahrhundert! – Ein erstaunliches Faktum, wie ich (erst) heute finde. (Ich werde später noch näher darauf eingehen.)
Freilich bin ich in der Zeit der Nachrüstung und des großen Streits um den NATO-Doppelbeschluss als Schüler schon für den Frieden auf die Straße gegangen, habe Flugblätter verteilt, eine Menschenkette mitorganisiert, mit Lehrern vor dem Schultor und im Unterricht diskutiert. Um gegen die Stationierung der Pershing-II und Cruise-Missiles-Mittelstreckenraketen zu demonstrieren, bin ich als 15-jähriger 1981 in den Hunsrück gefahren und auch nach Bonn in den Hofgarten, wo ich mich noch leicht verloren in einer unendlich großen Menge von Leuten sehe. Einer Menge, die so groß war, dass ich den großen Heinrich Böll kaum reden gehört, geschweige denn gesehen habe. Zu dieser Zeit lag die Friedensbewegung nicht so quer zum Zeitgeist wie heute. In der Tagesschau berichtete man halbwegs sachlich über das Anliegen und die zahlreichen Aktionen. Damals säumten Hunderttausende die Straßen der Republik (nach offiziellen Angaben 300.000 in Mutlangen, 500.000 in Bonn), viel mehr im Vergleich zu den etwa 30.000 Menschen, die im Februar 2023 dem Aufruf zur Kundgebung zur Beendigung des Ukraine-Krieges von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer am Brandenburger folgten, aus der sich bis heute leider keine neue deutsche Friedensbewegung entwickelt hat.
Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf in der Nähe von Koblenz. Ich erlebte das, was man eine „behütete Kindheit“ nennt. Das war zum Glück lange vor der Helikopterisierung dieses Begriffs. Die relativ große Freiheit und Sorglosigkeit, von der meine Erziehung bestimmt war, dürfte auch erklären, warum mir das woke Biedermeiertum meiner großstädtischen Latte-Macchiato-Nachbarschaft mittlerweile so auf die Nerven geht.
Wie gesagt: der Ort und die Erlebnisse meiner Kindheit waren denkbar weit vom Krieg entfernt. Denke ich an diese frühesten Erinnerungen zurück, so habe ich die heimatliche rheinische Provinz, genauer gesagt die letzten sanft geschwungenen, zwischen den Tälern von Rhein und Mosel gelegenen Ausläufer der Eifel, als ein Hort der Beschaulichkeit und des Friedens vor Augen. Als Kinder spielten wir das ganze Jahr über draußen. Dass wir uns so oft und so gut es ging elterlicher Aufsicht und Kontrolle entzogen, machte einen Großteil des Zaubers meiner Kindheit aus, den ich heute preisen will. Dem Drang nach unbeaufsichtigten, eigenen Erfahrungen, nach Freiheit und Selbsterprobung verdanke ich meine Liebe zur Natur, vielleicht auch meinen Sinn für Ästhetik. Sicher aber, seit der Pubertät, auch mein Einzelgängertum und meinen Hang zur Unabhängigkeit.
„Unordnung und frühes Leid“, wie es so schön im Thomas Mannschen Duktus heißt, der Tod der Mutter und des Bruders, haben diesen Hang verstärkt. Die Rolle der Natur sei hier betont, weil sie für den Menschen ein großer Kraft- und Freudenquell ist. Die Natur vermag auch eine sehr wichtige Friedens- und Trostspenderin zu sein, gerade in jungen Jahren, der Zeit der Herman-Hesse-Lektüren. Begegnet man ihr als Suchender und erfährt auch nur einen Bruchteil ihrer Wunder, erahnt man die Bedeutung der Worte Goethes, nach denen „alles Vergängliche nur ein Gleichnis“ sei. Jedenfalls habe ich diese Kraft, Hilfe und auch Läuterung durch die Natur oft stark empfunden. Und ich habe mich an ihr – und an unseren geliebten Hunden, mit denen ich groß zu werden das Glück hatte – immer wieder aufgerichtet, wenn ich einsam, traurig, verwirrt oder verzweifelt war.
Mit Furcht und Schrecken registriere ich heute, wie viele Menschen von der Natur so sehr entfremdet sind. Dies gilt, wie ich es als Lehrer in den letzten fünfzehn Jahren leider immer wieder beobachten musste, insbesondere für die jüngere, digital sozialisierte Generation. Heute glaube ich, dass der fehlende Frieden mit und in der Natur den Unfrieden in vielen anderen Bezügen unseres Lebens nach sich ziehen kann.
Aus der Erinnerung gerissene Albumblätter einer Familiensaga – vergilbt und lückenhaft
Meine Eltern hatten sich im Schatten der Loreley auf einem der vielen Weinfeste am Mittelrhein kennengelernt. Die väterliche Familie war auf der Flucht von Lodz, mein Großvater und mehrere Onkels waren Weber (die Familie Goltz – Schoepe muss eine ganze Weber-Dynastie hervorgebracht haben), schließlich dort gestrandet. Mütterlicherseits war die Familie schon etwa ein Jahr vor Kriegsende aus Berlin nach Eggenfelden in Niederbayern geflohen.
Die Kleinstadt Eggenfelden blieb vor den Bomben der Alliierten verschont. Meine Mutter, die hier eine glückliche und unbeschwerte Jugend erlebte, erzählte, dass sich eines Sonntags nach dem Kirchgang im Herbst 1944 ein langer Gemeindezug in Richtung des vor der Stadt gelegenen Ackerlandes in Bewegung setzte, um dort auf einem Stoppelfeld einen großen Krater zu besichtigen. Ein amerikanischer Bomber hatte dort seine tödliche Fracht, wohl aus Versehen, verloren.
Das war das Kriegsgeschehen in Eggenfelden. Es endete mit dem Einmarsch der US-Amerikaner am 1. Mai 1945.
Trotzdem kam der Krieg auch nach Eggenfelden. Mehr als 340 Söhne der Stadt kehrten aus ihm nicht mehr zurück (29).
Später ging die Familie mütterlicherseits aufgrund geschäftlicher Verbindungen meines Großvaters nach St. Goar. Dorthin hatte es nach Zwischenstation im Fränkischen auch die väterliche Familie verschlagen: Anfang der 1950er Jahre richtete mein Großvater im Untergeschoss eines größeren Wohnhauses direkt an der Rheinuferstraße (B 9) eine kleine Weberei ein, von der die Familie mehr schlecht als recht ernährt werden konnte. Natürlich musste jeder in der Familie mit anpacken.
Mein Vater, Jahrgang 1931, war ein Selfmade-Mann und brachte es mit Geschick und noch mehr Glück (wie ich vermute) zu viel Geld als Vertreter für Werkzeugmaschinen. So wurde ich in eine aufstrebende Wirtschaftswunder-Wohlstandsfamilie hineingeboren, die in vielem „nicht Fisch, nicht Fleisch“ war. Östliche, evangelische, aber kirchenfern bis kirchenkritisch eingestellte Flüchtlinge im katholischen Rheinland (später sind alle aus der Kirche ausgetreten). Liberal bis auf die Knochen, mit einem Bein betont weltläufig, mit dem anderen bodenständig–unprätentiös und relativ frei von sozialen Vorurteilen. Ein Potpourri aus Kaufleuten, Handwerksmeistern, Unternehmen mit ein paar Einsprengseln von künstlerisch Begabten und Beamten. Aus ursprünglich urbanem Milieu stammend, die es durch die Flucht- und Wanderungsbewegungen der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit in eine ländlich-konservative, provinzielle, bisweilen als rückständig wahrgenommene Umgebung verschlagen hatte. Meine Familie wurde aber offenbar schnell von den Einheimischen akzeptiert und konnte sich problemlos in das dörfliche Leben integrieren.
Meine Mutter hätte nach dem Krieg gerne Archäologie oder Kunstgeschichte studiert, das blieb ihr aus finanziellen Gründen versagt. Mein Vater nannte sich „Ingenieur“, ob er je eine richtige Ausbildung abgeschlossen hatte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er nach dem Krieg neben der Mitarbeit in der Weberei seine Abende als Kantinenwirt bei den französischen Besatzungstruppen in Moselweiß, einem Stadtteil von Koblenz, verbrachte und dass das, da er uns öfter davon erzählte, eine recht glückliche Zeit für ihn gewesen sein muss. Denn er war sonst nicht besonders gesprächig.
Mein Großvater mütterlicherseits war ein wohlhabender Berliner Kaufmann, der, nachdem er durch den Krieg seine Firma, seine Mietshäuser und sein Vermögen verloren hatte, alle seine wirtschaftlichen Hoffnungen in eine Erfindung setzte, für die ich für die Jahre 1953 und 1963 bei der Internet-Recherche zu diesem Text Patentanmeldungen finden konnte. (30) Für die Patente und Patentrechtsprozesse, die ihm von einem damals marktführenden US-amerikanischen Konzern aufgezwungen wurde, verscherbelte meine Großmutter ihren letzten Schmuck. Dieser Kampf kostete meinen Großvater nicht nur sehr viel Geld, sondern auch die Gesundheit. Kurz vor seinem frühen Tod, – er starb mit 63 im Jahr vor meiner Geburt – hatte er – von den Prozessen zermürbt und von einem Herzleiden schwer gezeichnet – zusammen mit einem jüngeren Sozius auf einem Nürnberger Hinterhof ein Unternehmen gegründet, das seine Erfindungen, Gleitverschlüsse für Kunststoff-Verpackungsbeutel, wirtschaftlich verwerten sollte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entwickelte sich das Unternehmen ab dem Ende der 1960er Jahre erfolgreich.
Meine Mutter durfte nach dem Krieg immerhin eine Lehre im Hotelgewerbe in einem der besten Häuser Münchens, dem Regina-Palast-Hotel, machen. Dort gingen UfA-Stars ein und aus. So verfügte sie später über ein reichhaltiges Repertoire an Anekdoten und Geschichten aus der mondänen Welt, über teils sehr sympathische, teils aber auch recht unsympathische Stars und Sternchen, mit denen sie uns gerne unterhielt. Wenn wir uns gemeinsam einen alten Spielfilm im Fernsehen anschaute, kam ihr fast immer die eine oder andere selbst erlebte Episode mit Schauspielern wieder in den Sinn, die zu den Mitwirkenden im Film gehörten.
Mein Großvater hatte sich als Inhaber und Chef einer kriegswichtigen Maschinenfabrik der Einberufung in die Wehrmacht erfolgreich entziehen können. Er soll Pazifist gewesen sein, hatte aber 1933 „aus Verzweiflung“ über die Lage in Deutschland die NSDAP gewählt. Der Röhm-Putsch im Juli 1934 hat ihn politisch aufwachen lassen, seitdem war er Gegner des Regimes.
Später habe ich mich gefragt, wie mein Großvater mit dem Widerspruch klarkam, einerseits Pazifist zu sein, andererseits sich dank der Kriegswichtigkeit seiner Fabrik von Wehrmacht und Kriegsdienst freigekauft zu haben. Und wie sicher konnte er sein damals, nicht doch noch an die Front gezogen zu werden? Die Tatsache, dass er dem Krieg auf andere Art und Weise diente – wie stark hat ihn das belastet? Meiner Großmutter zufolge soll er sich für den Rest seines Lebens Vorwürfe gemacht haben, dass er sich so über die Nazis täuschen ließ. Vor dem Krieg wurde er sogar einmal von der Gestapo verhaftet. Er war wegen Hitler-Witzen, die er unvorsichtigerweise in einer Kneipe erzählt hatte, denunziert worden.
Mein anderer Großvater, den ich als liebevollen, immer zu Späßen aufgelegten Opa und guten und geduldigen Schachlehrer in Erinnerung habe, soll in der SS gewesen sein. Darüber wurde zu Hause nie gesprochen. Ich habe erst viel später von meiner Tante davon erfahren.
Obwohl ich schon als Kind wusste, dass mein Opa im Krieg war, habe ich ihn mir merkwürdigerweise nie als Soldat vorgestellt. Er hat auch nichts Persönliches über diese Zeit erzählt. Es heißt, er sei Fotograf gewesen und ist vielleicht dadurch vor unmittelbaren Kampfhandlungen verschont geblieben, was erklären könnte, dass er aus dem Krieg ohne sichtbare Blessuren zurückkehrte. Ich will mir aber auch heute noch nicht ausmalen, welche Gräueltaten er als Fotograf der SS möglicherweise ins Bild gebannt hat.
Nur dem beherzten Eingreifen meiner Großmutter soll es übrigens zu verdanken gewesen sein, dass mein Berliner Großvater nach ein paar Tagen Gestapo-Haft wieder nach Hause zurückehrte. Sie hatte den Gestapo-Mann, der in dieser Angelegenheit das Sagen oder zumindest genug Einfluss hatte, becirct und umgarnt, vielleicht auch bestochen – das ließ sie offen. Meine Großmutter, die eine sehr schöne Frau gewesen ist und auf den alten Fotos immer sehr ladylike aussah, war sich ihrer Wirkung auf Männer wohl sehr bewusst. Außerdem besaß sie – als uneheliches Kind in einfachen Verhältnissen im Arbeiterbezirk Treptow geboren, ihre Mutter hatte die vierköpfige Familie als Näherin allein über Wasser gehalten – die Schlagfertigkeit der sprichwörtlichen „Berliner Schnauze“.
Hitler hielt sie übrigens wegen seines Geschreis, seines lächerlichen Grimassierens und Gestikulierens, schon vor 1933 für verrückt. Sie nahm sich heraus auf den „Heil Hitler!“-Gruß mit „Schönen guten Tag“ zu antworten. Dem Blockwart, der sie wiederholt dafür zur Rede stellte, bot sie Paroli. Diese kleinen Widerstandsakte blieben für sie völlig folgenlos. Meine Großmutter klärte mich auch schon früh darüber auf, dass der nach dem Krieg oft geäußerte Satz „Wir konnten ja nicht wissen, was mit den Juden geschieht“ eine Mär gewesen sei. Ihr Argument war, dass, wenn selbst eine so völlig unpolitische Frau wie sie von den Konzentrationslagern und Gaskammern im Krieg erfahren habe, jeder davon hätte hören und wissen können. Sie hat in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft die Verhaftungen und das Zusammentreiben von Juden, die, wie sie sagte, „keiner Seele etwas zuleide getan hatten“, zu den Deportations- Sammelplätzen, von wo aus sie in die Vernichtungslager transportiert wurden, mitbekommen. Der Gedanke daran sowie die verstörenden Bilder an die Judenverfolgung, insbesondere an die Reichspogromnacht 1938, suchten sie immer wieder heim.
Manchmal sah ich sie, wenn ich ihr abends vor dem Schlafengehen noch einen Gute-Nacht-Kuss geben wollte (was ich, seitdem sie in die Wohnung über uns gezogen war, fast jeden Abend tat) weinend in ihrem Fernsehsessel sitzen. Dann wurden wieder einmal in Filmen oder TV-Dokumentationen die von den Nazis und ihren Mitläufern begangenen Grausamkeiten gezeigt. Sie nahm mich dann meist auf den Schoß und erzählte mir, manchmal völlig aufgelöst, Geschichten aus dieser Zeit, um so ihrem Herzen, das von diesen quälenden Erinnerungen beschwert war, Erleichterung zu verschaffen. Doch neben der Linderung war es ihr ausdrücklicher Wunsch – und so sprach sie zu mir auch – diese schrecklichen Erinnerungen weiterzugeben, damit sich so etwas niemals mehr wiederholen kann. Das war ein wichtiges Motiv dieser ganz besonderen Geschichtsstunden und intuitiv verstand ich die Dringlichkeit ihres Anliegens – für ihren inneren Frieden und aus Sorge um die Zukunft ihrer Enkel.
VII Über Vergangenheit und Zukunft der Utopie einer glücklichen Kindheit und des guten Lebens
Ihren Ursprung hatte die als idyllisch im Gedächtnis gebliebene Kindheit nicht nur in der Natur und dem Bild, das sich von ihr eingeprägt hat: Die meditativ-sanftmütig wirkenden Kühe auf der Weide, die lebhaft-lustigen Schweine im Stall, das umfriedete Leben in unserem Gutshof , wo wir mit großem Garten und altem Baumbestand auf einem parkähnlichen Gelände zur Miete wohnten, die Hühner, die in den angrenzenden Bauern-Gärten herumliefen, gackerten und pickten, das Plätschern des Baches, der durch unser Dorf fließt und dessen Lauf durch die Gemarkung die natürliche Grenze unserer kindlichen Welt bildete, die vielen Kirschen, Äpfel und Pflaumen im Sommer an den Bäumen in den Streuwiesen gleich hinter unserem Haus.
„Das Paradies ist nebenan“, heißt eine Erzählung des niederländischen Schriftstellers Cees Nooteboom. Für mich fing das Paradies hinter dem Hoftor und später gleich links um die Ecke unserer Garagenauffahrt an. Da waren die Obstbaum-Plantagen und Bimsgruben (das vulkanische Gestein der Eifel, das hier zum Bauen gefördert wurde), in denen wir tobten und von den von Baggern aufgetürmten Sandbergen purzelten. Da war das hohe Gras im Sommer, der Dschungel an Unkraut und Brennnesseln, vor denen man sich beim Entdecker-Spiel in Acht nehmen musste, dort legte sich der Duft frisch gedroschener Getreidefelder im August über eine unspektakuläre, aber das Auge und die anderen Sinne beruhigenden Landschaft.
Das Idyll und seine Anmutungen hatten also nicht nur mit der Natur, sondern auch mit der Prosperität und der Aussicht zu tun, dass die Kinder, also unsere Generation, es einmal besser haben würden. Die Zukunft in den 1970er Jahren war trotz Ölkrise und Sonntagsfahrverboten – an zwei Sonntagen radelte ich in Begleitung meiner Eltern staunend und von der Leere wie gebannt über die für PKW und LKW gesperrte Autobahn – eine rosige Zukunft.
Von dieser Vorstellung hat sich unsere Boomer-Generation längst verabschieden müssen: Wir werden es nicht mehr so gut wie unsere Elterngeneration im Alter haben. Wir leben wieder in unsicheren, prekären Zeiten. Der nahende Lebensabend erscheint für uns nicht gerade im idyllisch-milden Licht. Als Produkt der Baby-Boomer-Generation verbindet mich mit meinen Zeitgenossen zwar „das Glück der späten Geburt“, doch wird dieses Glück an der Schwelle, an der wir beginnen, uns langsam aus dem Erwerbsleben zurückzuziehen (wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass viele meiner Generation noch bis 70 oder länger arbeiten werden), wieder als das wahrgenommen, was es historisch – bis auf ganz wenige Ausnahmen – immer war: etwas äußerst Fragiles.
Die Abwesenheit steinerner Zeugen bei gleichzeitiger Anwesenheit versteinerter Zeugen
Zu diesem Idyll gehörte auch, dass es in meiner Kindheit irgendwie ganz unglaubhaft zu sein schien, dass die nur knapp sechs Kilometer Luftlinie entfernte Koblenzer Innenstadt, wo ich dann ab 1977 das Gymnasium besuchte, 1944/45 in 40 Bombenhageln zu 87 Prozent zerstört worden war. Auf alten Aufnahmen sehe ich, dass der Friedrich-Ebert-Ring, an dem meine Schule, das Eichendorff-Gymnasium steht (sie wurde zwischen 1950 und 1957 wiederaufgebaut), einer Trümmerwüste glich.
Damals – 21 Jahre vor meiner Geburt – warfen insgesamt 3772 US-amerikanische und britische Flugzeuge 10.000 Tonnen Bomben auf Koblenz. 1100 Menschen starben. „Das historische Stadtbild der Hauptstadt der Rheinprovinz ging in der Folge für immer verloren.“ Die relativ niedrige Opferzahl – in Köln starben bei den Luftangriffen 20.000, in Dresden 25.000 Menschen – liegt daran, dass etwa 70.000 Koblenzer bis Ende 1944 nach Thüringen evakuiert worden waren. Nur etwa 9000 Menschen waren aus „kriegswichtigen Gründen“ in der Stadt verblieben. Diese „lebten wochenlang in den großen Betonbunkern der Innenstadt“. Für viele nach dem Krieg in die Stadt zurückkehrenden Menschen dienten diese Bunker dann noch lange als „provisorische Wohnungen“.
Manchmal denke ich heute, angesichts der Kriegsbesoffenheit (nicht nur) unserer dysfunktionalen Eliten, es wäre gut gewesen, einen Straßenzug in jeder vom Krieg zerstörten Stadt, in Koblenz z.B. einen Teil der oberen Löhrstraße, zwischen Löhrrondell und Rizzastraße, nicht wiederaufzubauen. Dort fand am 6. November 1944 der Angriff der Royal Air Force auf die Koblenzer Innenstadt statt, der die meisten Opfer forderte: 109 Tote, 558 Verletzte und 25.000 Obdachlose. (31)
Natürlich weiß ich, dass der Krieg und eine solche Trümmerstraße sich nicht musealisieren lassen. Mit der Zeit bekämen sie nolens volens etwas Disneyworldartiges. Auch Trümmer und Ruinen müssen denkmalpflegerisch und erinnerungskulturell konserviert werden: Das dürfte sich am Ende also nicht als die geniale List des Erinnerns herausstellen, durch welche man das „Nie wieder!“ stark und unverbrüchlich in die Herzen und Köpfe der Nachkriegsgenerationen pflanzt, auf dass es als ein zutiefst Verinnerlichtes, Identitätsbildendes transgenerational wirke und die Menschen für Kriegspropaganda unempfänglich mache. Es böte schließlich auch keine Lösung dafür an, erfolgreich Anti-Militarismus, Pazifismus und Menschlichkeit als Botschaft und Lehre dieser dunklen Kriegszeiten in eine bessere Zukunft zu tragen.
Dies beiseitegelassen: Hätte ich als Kind und alle meine Altersgenossen dadurch eine klarere Vorstellung davon erhalten, was es heißt, dem Krieg entronnen zu sein?
Vermutlich. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, glaube ich, dass die stehen gelassenen Trümmer mich mit der Nase auf Fragen gestoßen hätten, die ich weit weniger abstrakt, dafür aber mit größerer Dringlichkeit an meine Eltern und Großeltern gerichtet hätte. Ich vermute, dass ein solches Trümmerfeld, das man absichtsvoll als eine aus der Zeit gefallene Ansicht, als ein Standbild des Krieges bewahrt hätte, in mir mehr und mich hartnäckiger beschäftigende Fragen aufgeworfen hätte (aus der Romantik wissen wir, dass und wie Ruinen die Fantasie anregen: „Was mag früher sich hier alles zugetragen haben? Wie war das Leben hinter diesen Mauern, die jetzt Ruinen sind?“).
Weiter denke ich, dass diese Fragen womöglich auch das hätten aufbrechen können, was bei meinen Eltern und Großeltern als Erinnerung larviert war und was dadurch auch für mich lange, sehr lange unterhalb der Wahrnehmungsschwelle blieb.
Da es eine solche Ansicht der schrecklichen Vergangenheit in dieser Unmittelbarkeit nicht gab, blieb vieles in meiner Sozialisation doch dem Zufall überlassen. Aber auch der formte schließlich ein eindrückliches, für meine Identität bedeutsam werdendes Bild vom Krieg und seinen Zerstörungen. Viel weniger schuf er aber eine Vorstellung von oder besser ein Sensorium für die Verletzungen oder Versehrtheiten, von denen ich in bestimmter Weise in der Gestalt meiner Mutter, meines Vaters und meiner Großeltern umgeben war. Dabei nahmen diese Versehrtheiten ja auch indirekt Einfluss auf meine Erziehung, mein Denken und Fühlen. Auf diese Verletzungen werde ich im Schlussteil meines Erinnerungspuzzles näher eingehen.
VIII Meine „zufälligen“ Bildungserlebnisse – Das Lob der Lehrer und eine merkwürdige Beobachtung
Ich denke, wenn ich hier vom Zufall spreche, so muss diese Rede – mit Blick auf die Bildungserlebnisse, die mich und mein Bild des Vergangenen formten – doch noch präzisiert werden. Womit wir zugleich beim Thema Schule und Lehrer und der Rolle angekommen wären, die sie für meine anti-militaristische Mensch-Werdung spielten.
Meinen Lehrern verdanke ich viel. Sie haben mir die Lust am Denken beigebracht. Gewiss nicht alle meine Lehrer waren gut, aber alle waren nützlich, um mir mein eigenes Wertegerüst zu bauen und mir meine eigene Weltanschauung außerhalb des familiären Mikrokosmos zu bilden.
Unter den Lehrern waren auch ein paar mediokre und ein paar, die zweifelsfrei auch sadistisch veranlagt waren. Aber erstaunlich ist für mich vor allem, wie sehr sich mir bestimmte Szenen, Momente, Situationen gerade mit den Lehrerpersönlichkeiten für immer eingeprägt haben, die ich auf eine bewundernde Art und Weise liebte und verehrte. In ihnen begegneten mir lohnende Beispiele, Mensch zu sein.
Vor alten Nazi-Lehrern bin ich zum Glück verschont geblieben. Ob das etwas mit dem liberalen Ruf meiner Schule zu tun hatte, kann ich nur vermuten. Für mich wie einige meiner besten Grundschul-Freunde war bei der Schulwahl das Gerücht ausschlaggebend gewesen, dass das Eichendorff unter den Gymnasien in Koblenz dasjenige sei, auf dem man am leichtesten sein Abi machen könne. Da ich natürlich mitbekommen hatte, wie schwer sich mein fünf Jahre älterer Bruder auf dem altsprachlichen Koblenzer Honoratioren-Gymnasium tat, auf das meine Eltern den Erstgeborenen geschickt hatten, war das verständlicherweise für mich das entscheidende Kriterium (nach einer Wiederholung wechselte mein Bruder nach der 7. oder 8. Klasse vom „Görres“ auf die Clemens-Brentano-Realschule, wo der „Schulversager“, der den Eltern viel Kummer und Sorgen bereitete, dann eine ganz ordentliche Mittlere Reife ablegte.) Tatsächlich habe ich das Eichendorff als eine liberale, im besten Wortsinn tolerante Schule erlebt. Eine Schule, die den Widerspruch nicht unterdrückte und erstickte, sondern pädagogisch meist engagiert und produktiv bearbeitete.
In komprimierter Fassung lautet das Lob meiner Lehrer so: Man konnte in eurem Unterricht gut diskutieren, ihr hattet fast immer ein Ohr für abweichende Meinungen, meinen Eigensinn habt ihr mehr gefördert als unterdrückt. Danke dafür! Euer Wissen, das ihr mir vermittelt habt und euer Verständnis der Welt machten mich zu einem Suchenden, Fragenden, Zweifelnden und eröffneten mir geistige Horizonte. Sie regten vor allem dazu an, intellektuelle Abenteuer auf eigene Faust zu unternehmen (denn das war noch viel spannender als sich mit dem in der Schule „Durchgekauten“ zu beschäftigen, dass man auch mit den „blöden Mitschülern“ teilen musste. Diese Abenteuer hingegen gehörten mir als mein Schatz ganz allein!). Und danke dafür, dass ihr mich trotz meiner Unreife ernst nahmt!
In der Schule bekam ich die Impulse, die ich zuhause und im Austausch mit Freunden vertiefte. Da ich naturwissenschaftlich eine Niete war, haben mich immer nur die geisteswissenschaftlichen Fächer angezogen und interessiert. Dort sind mir die Lehrer begegnet, die Vorbilder für mich wurden und denen ich den Wunsch verdanke, selbst Lehrer werden zu wollen. Wichtig wurde auch schon früh das Theater für mich. In Theatergruppen an der Schule sprach ich mich frei, erprobte mich, gewann Selbstbewusstsein und entwickelte einen Sinn für die Ambivalenzen und die Pluralität des Wesens Mensch und für das spannungsgeladene und oft widersprüchliche Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft.
Wenn ich über die zahlreichen Impulse spreche, die ich durch den Unterricht und über ihn hinaus von meinen Lehrern erhielt und die ich hier unmöglich alle aufzählen kann, so gilt das natürlich auch bzw. sogar in besonderem Maße für die Themen Krieg und NS-Vergangenheit. Sie nahmen ohnehin fächerübergreifend einen breiten Raum in der Mittel- und Oberstufe ein.
Mein Sozialkundelehrer in der 9. und 10. Klasse schien regelrecht „besessen“ von diesem Thema zu sein. Er zeigte uns viele Dokumentationen der NS-Zeit aus dem Bundesarchiv, darunter einige mit sehr, sehr harten Aufnahmen der Leichenberge, Skelette, Krematorien aus den Konzentrationslagern und von den Gräueltaten der SS im Krieg. Mitschülerinnen liefen weinend aus dem Raum, weil sie die gezeigten Bestialitäten nicht länger ertrugen. Meist war ich wie benommen, wenn die Pause uns aus dem abgedunkelten Chemielabor, das als Filmvorführraum diente, entließ. Das normale Schulleben, die Pausenhofszenerie schien plötzlich alles andere als ganz normal zu sein.
Natürlich habe ich nie gefragt, wie es zu dieser „Besessenheit“ des Sozialkunde-Lehrers gekommen war und wir haben auch nie mit ihm darüber gesprochen und etwa gefragt, wie er diese Zeit als Kind persönlich erlebt hat. Das Thema Nationalsozialismus / Drittes Reich auf Personen und Persönliches, gar auf meine Lehrer zu beziehen, lag mir und meinen Mitschülern fern. Wir sind nicht auf die Idee gekommen, sie als Zeitzeugen selber zu befragen. Das kommt mir heute komisch vor, denn es wäre doch naheliegend gewesen. So kann man sagen, dass meine Kindheit und Jugend in Bezug auf den Krieg rückblickend geprägt war durch die Gleichzeitigkeit einer An- und einer Abwesenheit, die zusammengenommen eine verzögerte, latente Bildungswirksamkeit entfaltete: Die Anwesenheit irgendwie versteinerter Zeugen des Krieges bei gleichzeitiger Abwesenheit seiner steinernen Zeugen.
Heute vermute ich, dass die Obsession meines Sozialkundelehrers mit einem offenkundig labilen Charakter oder einer Persönlichkeitsstörung korrespondierte, die aus seiner Kriegskindheit herrührte. Wir erlebten es wiederholt, dass er betrunken zu uns in den Unterricht kam und sich sehr daneben benahm. Aber wir Schüler wären nicht auf die Idee gekommen, zwischen dem einen und dem anderen irgendeinen Zusammenhang herzustellen.
IX Die sichtbaren und die unsichtbaren Beschädigungen durch den Krieg
An dieser Stelle möchte ich auf den Satz von Patrick Baab aus der Einleitung zurückkommen, das diesem Text den Titel gab.
Obwohl in meiner Familie niemand sichtbare Beschädigungen oder Versehrtheiten aus dem Krieg mit nach Hause gebracht hatte, lässt sich die Erkenntnis „Keiner kommt aus dem Geschehen in einem Kriegsgebiet wieder heil raus, das macht etwas mit einem“ auch auf meine Familie anwenden.
Je länger ich darüber nachdenke – das betrifft jene Erfahrungen des zweiten und dritten Blicks, auf die ich in der Einleitung hingewiesen habe – desto stärker komme ich zu dem Schluss, dass ich diese Beschädigungen als ihr Sohn auch mit mir herumtrage. Das, was der Krieg aus ihnen gemacht hat, wirkt(e) sich auch auf mich aus, ist an mich vererbt worden. Ich habe – ich wiederhole es an der Stelle noch einmal – doch nur zwanzig Jahre nach Kriegsende das Licht der Welt erblickt. Wie haben sich die Spuren des Krieges also in mir und meiner Persönlichkeitsentwicklung sedimentiert? (Es dürfte sinnvoll sein, dass jeder, der dem Frieden näherkommen möchte, sich diese Frage stellt.)
Ich sprach von den Wunden des Krieges als Verlarvungen, die im familiären Leben, meist unterschwellig, spürbar wurden und die ich als Kind und Jugendlicher zwar nur unzureichend erfassen konnte, aber dennoch aufgenommen habe. Sie traten für mich fast ausschließlich maskiert in Erscheinung. Nur bei meiner Mutter wurden sie etwas greifbarer für mich, denn sie ging offener damit um. Während es bei meinem Vater nur ganz selten einmal geschah, dass die Maske etwas angehoben oder ein Stück weit heruntergezogen wurde. Immer ging es dabei – was mir erst jetzt richtig klar geworden ist – um direkte oder indirekte Folgen des Krieges.
Ich habe noch nicht berichtet, dass ich unter dem liebevollen Schirm der Mütter (Mutter, Großmutter) groß geworden bin. Mein Vater blieb eigentlich ein Randgänger in meiner Welt als Heranwachsender. Eine Art Dauer- oder Stammgast der Familie. Da er als Handlungsreisender viel unterwegs war, passte das natürlich zu dem Eindruck, den er auf mich machte. Dies und die dominanten Mutterfiguren, ließen meinen Vater zwar männlich (auch im Sinne einer Unerreichbarkeit), aber blass und eindimensional aussehen. Seine berufsbedingte Absenz ist nicht der einzige Grund für sein schattenhaftes Dasein gewesen. Vielmehr blieb mir mein Vater emotional fern. Denke ich an ihn heute und will meine Eindrücke mit einem Wort zusammenfassen, kommt mir vor allen anderen Bezeichnungen das Wort „Gehemmtheit“ in den Sinn. Auch wenn ich über die Frage, wie er auf mich wirkte, länger nachgrüble, will mir kein besseres Wort dafür einfallen. Irgendwie wirkte seine Abwesenheit bei physischer Anwesenheit so, als sei er von seinen eigenen Kräften in einem existenziellen Sinn abgeschnitten worden.
IX. 1 Im Volkssturm – Die larvierten Grenzerfahrungen meines Vaters
Was sehe ich heute als den Hauptgrund für diese Gehemmtheit an, die meinen Vater charakterisierte?
Rufe ich mir sein Bild vor Augen – er ist jetzt dreißig Jahre tot – begegnet mir ein Mensch, der große Schwierigkeiten damit hatte, Gefühle zu zeigen. Dieses Problem hatte großen Anteil daran, dass wir uns später ganz entzweiten. Ich bin auch der Meinung, dass ihn diese Unfähigkeit nach dem Tod meiner Mutter (sie starb neun Jahre vor ihm, mit 51 an Krebs) in eine selbstzerstörerische Spirale getrieben hat. Auch mein Unverständnis der Blockade gegenüber, die mein Vater nicht überwinden konnte (worunter er sichtlich litt) trug natürlich dazu bei, dass sich die Fronten zu den Zeiten, in der ich selbst schon ein junger Erwachsener geworden war und mir in der Rolle des angry young man gefiel, verhärteten.
Wenn ich etwas Schlechtes über mich sagen soll, so ist hier ein guter, besonders passender Moment dafür gekommen, ein Moment, der quasi dazu einlädt. Denn schon in früher Jugend fand ich diebisches Gefallen daran, meine Umgebung über die Schmerzgrenze hinaus zu provozieren. Da konnte ich sehr grob, sehr ungerecht und penetrant werden. Das war die andere, die harte Seite meiner empfindsamen, introvertierten Seele, auf der allerdings auch gerne seitens meines Vaters und meines älteren Bruders herumgehackt wurde.
Wie ich schon sagte, rief diese Wahrnehmung, dass mein Vater irgendwie von seinem Gefühlsleben abgeschnitten worden sei, den Eindruck der Maskierung bei mir hervor. Sie verdunkelte den Blick auf meinen Vater. Mit dem Beginn eigenständigen Denkens wurde er für mich zu einer Rätselfigur, gleichzeitig aber war er marginalisiert. Alles, was ich brauchte und wonach ich verlangte, holte ich mir von meinen Müttern. Aber objektiv betrachtet musste ich es mir von ihnen holen, da mein Vater gefühlt zu 95 Prozent ausfiel.
Nur wenn er zuviel trank, stellte sich eine, wenn auch verquere Verbindung zu seinen Gefühlen her. Dann waren die Schwerfälligkeit und Schattenhaftigkeit plötzlich weg und er kam in Fahrt, redete sich in Rage. Heraus kam aber in der Regel eine kaum ungenießbare Mischung aus Wehleidigkeit (als meine Mutter noch lebte, kommentierte sie dies oft mit dem Satz: „Du bedauerst Dich wieder selbst!“) und Aggressivität, ein Jähzorn, von dem man merkte, dass sich da etwas stark in ihm aufgestaut hatte.
Ganz selten fiel die Maske so, dass ich es merkte und hellhörig wurde. Ich hatte schon erwähnt, dass mein Vater uns wenig aus seiner Vergangenheit erzählte. Ich kann mich aber an ein oder zwei Situationen am Küchentisch erinnern, wo in eigentlich gelöster, guter, doch zugleich intensiver Stimmung mein Vater vom Krieg zu erzählen begann. Ohne mich noch genau an die Details erinnern zu können, weiß ich, dass mir auffiel, dass mein Vater anders als sonst redete. In der Stimme und den Worten, so hatte man das Gefühl, brach sich etwas Bahn, was irgendwie verschüttet gewesen war. Doch dann begriff ich rasch, dass mein Vater seine Erfahrungen aus dem Krieg und seine Flucht daraus schilderte und erst da kam mir zum ersten Mal klar zu Bewusstsein, dass mein Vater den Krieg im Kampf ja miterlebt hatte!
Noch nicht 15-jährig habe man ihn, da er schon so erwachsen ausgesehen habe, für den Volkssturm, Hitlers letztes Aufgebot, rekrutiert. Ob er sich aus jugendlichem Übermut, aus Langeweile oder politischer Indoktrination selbst für den Volkssturm gemeldet hatte (meinem Vater fehlte in seinen wichtigsten Jahren der Entwicklung ja sein eigener Vater. Der war in den Krieg gezogen, als er sieben oder acht Jahre alt war) oder ob er in einem „Heimatschutz“-Verband ohne eigenes Zutun gelandet war, ist mir nicht bekannt. Es ist bei ihm aber wohl so abgelaufen, dass aus Schieß- und anderen militärischen Übungen, die ihm Spaß gemacht hätten machten und bei denen er sich als 14-jähriger in einem Fluidum von Abenteuer, Gefahr und vielleicht auch Heldentum austoben konnte, bald blanker Ernst wurde. Denn irgendwann im Winter 1944/45 rückte die Front dann näher und näher.
Als sein Verband (wohl eher eine versprengte Gruppe, schließlich war alles schon in Auflösung begriffen) Feindesberührung bekam, das heißt Rotarmisten auf nächste Nähe zur Stellung vorgerückt waren, auf der er Posten stand und Kampfhandlungen aufflammten, sei er zum ersten Mal völlig ungeschützt und sofort besonders heftig mit der Realität des Krieges konfrontiert worden. Mehrere seiner Kameraden seien bei den Kämpfen zu Tode gekommen. Überall sei Blut gewesen und er hätte schreiende Verletzte und auch Leichenteile gesehen, über diese Bilder als die Tonspur des Schreckens gelegt, höre er immer noch manchmal nachts und im Traum die laut ratternden Salven aus den Maschinengewehrläufen. So oder so ähnlich erzählte es unser Vater. Und dass es ihm gelang, irgendwie abzutauchen und diesem Inferno zu entfliehen. Er sei auf einen der letzten Züge, die von Schlesien gen Westen fuhren, aufgesprungen, und schaffte es sich dorthin abzusetzen, wo die US-Amerikaner eine Zone bereits besetzt hielten.
Bei seinen Schilderungen habe ich damals, glaube ich, nur kurz daran gedacht, dass ich ja ungefähr genauso alt bin wie er damals war, als er dem sinnlosen Tod auf dem Schlachtfeld nur um Haaresbreite entging. Aber erst jetzt glaube ich zumindest ansatzweise ermessen zu können, was diese Erfahrungen, von denen mein Vater in meiner Gegenwart nur ein oder zwei Mal sprach, für einen 14-Jährigen bedeutet haben.
Dazu habe ich einen Abschnitt über Kriegstraumata gefunden:
„Kriegserlebnisse können bei Kindern und Jugendlichen schwerste Traumatisierung zur Folge haben.
Erfahrungen wie der Tod der Eltern oder naher Verwandter, Bombardierung, Raketenbeschuss, Granaten, Explosionen, Flucht, Verlust von Haus und Heimat, langfristige Trennung von den Eltern, (...) Zeuge oder Zeugin von Ermordung, Erschießung, Folter gehören für Kinder in Kriegsgebieten zum Alltag.
Traumatische Ereignisse treffen ein Kind sowohl auf mentaler als auch auf physischer Ebene völlig unvorbereitet. Solche Ereignisse sind außergewöhnlich, unvorhersehbar und liegen außerhalb der normalen Lebenserfahrung eines jungen Menschen. (...)
Kinder und Jugendliche können innere Mechanismen entwickeln, u. a. die Strategie der Vermeidung, indem sie die eigenen Gefühle verdrängen, inneres Unbehagen und Wünsche nicht zur Kenntnis nehmen und eine positive Fassade vorspielen. (...)
Sehr oft wirken diese jungen Menschen selbstständig, selbstständiger als sie sind. Sie können emotional distanziert wirken, meiden Nähe und Freundschaft und sind oft sehr leistungsbereit.
Nach einem traumatisierenden Ereignis ist Stabilisierung besonders wichtig. Die Erregung, die jede traumatische Situation hervorruft, kann dadurch modifiziert und reguliert werden. Darüber reden fördert das Denken, Denken modifiziert Gefühle und Handlungsmöglichkeiten und die Bewältigungsstrategien werden dadurch vielfältiger.“ (32)
IX.2 Der Verzicht aufs eigene Leben: Die larvierten Erfahrungen meiner Mutter
Worin bestand das, was ich als die Larvierung von lebensgeschichtlich besonders wichtigen Erfahrungen bezeichnet habe, bei meiner Mutter?
Ich hatte bereits kurz angesprochen, dass der große Wunsch meiner Mutter Kunstgeschichte oder Archäologie zu studieren, nach dem Krieg unerfüllt blieb. Nach ihrer Ausbildung hatte sie nicht mehr gearbeitet, sondern meinen Großvater in beruflichen Angelegenheiten unterstützt. Auch krankheitsbedingt, nach ein oder zwei Herzinfarkten, Aufenthalten in Sanatorien usw. war er immer stärker auf die Hilfe seines einzigen Kindes angewiesen, das er wohl zu besitzergreifend sehr geliebt hat.
Die Sache mit dem Studium projizierte meine Mutter später stark auf ihre Kinder (darin kam exakt dieses: „Ich will, dass meine Kinder es mal besser haben als ich“ zum Ausdruck). Dass mein Bruder nicht studieren wollte, sondern lieber nach einer Lehre einen technischen Beruf ergriff und „nur“ Facharbeiter wurde, hat ihr stark zu schaffen gemacht. Sie selbst hatte in oder vielleicht auch schon vor der ersten Schwangerschaft, sich entschlossen zu Hause zu bleiben und sich ganz den Kindern, dem Haushalt und ihrer dann früh zur Witwe gewordenen Mutter zu widmen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass meine Mutter später diese Entscheidung bereut hat. Und am Schluss ging alles so schnell. Sicher aber hatte sie das Gefühl, etwas Wichtiges, Entscheidendes, Erfüllendes in ihrem Leben versäumt zu haben.
X. Der Verzicht auf das eigene Leben – als Kriegsfolge
Walter Benjamin: „Wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg.“ (33)
Der Traum vom eigenen Leben
Meine Mutter hat, als wir Kinder etwas größer waren, geklagt, sie wäre gern noch etwas anderes als unsere Putzfrau geworden.
Sie war eine gute, aber keine leidenschaftliche Köchin und Hausfrau, sie brachte unsere Wohnung und später unser Haus und, so muss man rückblickend sagen, unser aller Leben gut in Ordnung (denn als sie starb, zerbrach der innere Zusammenhalt der Familie schon bald), aber sie tat sich mit den Routinen dieses Lebens schwer und vor allem nagte wohl die Frage: „Soll das alles gewesen sein?!“ stark an ihr.
Dazu muss man wissen, dass sie ein sehr aufgeschlossener, neugieriger Mensch war, der sich für vieles interessierte, für ganz unterschiedliche Dinge begeistern konnte und gerne viel mehr von der Welt gesehen hätte. Ganz anders mein Vater. Wenn meine Mutter einen anderen Partner gehabt hätte, der sich selbst gern mit ihr zusammen hin und wieder aus dem Alltagstrott herausgerissen und Freude daran gehabt hätte, seine Frau zu entführen und zu verwöhnen, dann hätte sie vermutlich weniger unter der Hausfrauenrolle gelitten. So aber witterte sie mit den Jahren eine Art familiärer Verschwörung gegen sich.
Als ich etwa zwölf, dreizehn Jahre alt war, begann sie unabhängig von meinem Vater, der am liebsten allein in seinem Bastelkeller saß und seine Märklin-Eisenbahn dort im Kreis fahren ließ, sich einen eigenen Bekannten- und Freundeskreis aufzubauen, ging ins Theater, fuhr mit einem Freund der Familie zu Tennisturnieren in andere Städte, traf sich regelmäßig zum Schwof mit ihrem Damen-Kegelclub, ging mit ihrem zweitgeborenen Sohn, der früh einen Faible dafür entwickelte, gerne in Restaurants und auf kulinarische Kurzreisen in die nahe gelegenen Mutterländer der Haute Cuisine, Frankreich, Belgien, Luxemburg. Dennoch litt sie darunter, dass ihr Mann so gar nicht gern gemeinsam mit ihr etwas unternahm.
Mir vermittelten die Reisen mit meiner Mutter als Teenager, dass es noch etwas anderes als das Leben im schläfrigen und provinziell beengten Beamtenstädtchen Koblenz gab. Gleich hinter dem Schlagbaum begann in den frankophonen Nachbarländern eine Welt für mich, die, so klischeehaft das auch klingen mag, Freiheit, Abenteuer und eine intensivere, höhere Lebensart, das savoir vivre, versprach. Auch meine Mutter empfand das ähnlich; die kleinen Fluchten hatten etwas komplizenhaftes.
„Wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, dann werde ich mir endlich meinen Traum erfüllen“. Das hörten wir in den letzten Lebensjahren oft aus dem Mund meiner Mutter und sie sprach mit mir gern über ihren Plan irgendwo dort, wo ein schöner Flecken Erde ist, am besten in einer Weingegend, ein kleines Hotel zu pachten oder zu kaufen. Sie wollte es nach ihren Vorstellungen herrichten und einen Partner zu finden, der selber ein guter Koch ist oder einen guten Koch für das Restaurant, das dazu gehören sollte, anheuert, einen Partner, der mit ihr dieses Projekt, ihren Lebenstraum verwirklicht. Sie hätte sich von meinem Vater nicht scheiden lassen, aber der Gedanke, getrennte Wege zu gehen, schien sie aufatmen und Hoffnung schöpfen zu lassen: endlich keine Rücksicht mehr nehmen müssen! Endlich sein eigenes Leben leben können!
Sie hatte nicht nur all die Jahre auf ihre Kinder Rücksicht genommen, für die sie immer da war, wofür ich ihr immer dankbar bleiben werde, sondern auch auf ihre Mutter, die sie aus Mitleid und Verantwortungsgefühl ins Haus geholt hatte. Das versperrte ihr jetzt, wie sie merkte, den Schritt zum eigenen Leben, denn die Mutter wurde älter und gebrechlicher und vor allem noch anspruchsvoller in der Erwartung, dass ihre einzige Tochter sich um sie und ihre Neurosen kümmert. So war meine Großmutter, nachdem sie siebzig Jahre alt wurde, nicht mehr von dem Gedanken abzubringen, dass nichts mehr lohne, keine Anschaffungen mehr sinnvoll, keine Planungen mehr möglich seien, da sie ja nun bald stürbe. Tatsächlich sollte sie noch über zwanzig Jahre weiterleben und dabei in dieser Zeit drei Mal am Grab ihrer Nächsten stehen, erst am Grab ihrer Tochter, dann am Grab ihres ersten Enkels und schließlich am Grab ihres Schwiegersohns.
Meine Mutter ging zunehmend offensiv mit diesem Problem um, begehrte auf, schuf sich ihre eigenen Freiräume, was aber wohl viel Kraft kostete. Was bei meinem Vater die innere Blockade war, die ihn bedrängte, war bei ihr die äußere Blockade, der freilich eine innere korrespondierte: sich von Mutter, Mann und Kindern in ihrem Leben ausgebremst, an die Kette gelegt zu fühlen und in einen „goldenen Käfig“ gesperrt leben zu müssen. Den Ausdruck „goldener Käfig“ benutzte meine Mutter öfter. Ich fand ihn übertrieben, schließlich lebten wir weder im Palast, noch fuhr mein Vater einen Porsche, nicht einmal einen Mercedes. Wenn du im Wohlstand aufwächst, dabei aber nicht von dessen typischen Statussymbolen umgeben bist, ist das alles ganz normal für dich. Es sei denn, du hast gute Freunde, die arm sind, und die hatte ich nicht. Erst später habe ich erkannt, wie privilegiert mein Zuhause war.
Trotzdem war etwas verlarvt in ihr, was zum Ausbruch kam, als sie, kaum war der zweite Sohn aus dem Haus (ich war damals gerade frisch an der Uni in Frankfurt am Main eingeschrieben, besuchte als Erstsemester die Seminare und Vorlesungen – das meiste verwirrte mich sehr –, und hatte meine erste eigene Wohnung bezogen) an Krebs erkrankte und nur drei Monate nach der schrecklichen Diagnose starb. Ich brauchte Jahre, um mich nach ihrem Tod wieder zu fangen. Das waren die dunklen Jahre meines Lebens. An sie denke ich nur höchst ungern zurück.
XI Schluss: Der Krieg als schlimmster Exterminator menschlicher Möglichkeiten
Krieg tötet und verstümmelt nicht nur Menschen, zerstört nicht nur materielle und immaterielle Werte und die Natur. Krieg vernichtet auch menschliche Lebenschancen.
Krieg zeitigt immer, auch dann, wenn man äußerlich mit heiler Haut davonkommt, eine Engführung, Verarmung des Lebens. Lebensengführung bedeutet, dass menschliche Möglichkeiten, das Potenzial zur Entfaltung persönlicher Anlagen und Neigungen absterben oder gänzlich getilgt, ausradiert werden. Dieses Absterben von Freiheit und dieses Tilgen oder Ausradieren von Neuem erzeugt jede Menge Leid. Unserer Existenz werden dadurch Sinn, Glückserfahrungen, Erfüllung, Zufriedenheit und Anerkennung vorenthalten. Und im Kriegsfall werden sie uns geraubt.
Zwei besonders schlimme Exterminatoren menschlicher Möglichkeiten gibt es daher: Die Armut und den Krieg. Der Krieg ist der schlimmste, weil man sich, anders als bei der Armut, an ihn nicht gewöhnen kann. Gewöhnt man sich an den Krieg, dann um den Preis, alles Menschliche aufgeben zu müssen.
Das Leuchten der Jugend besteht darin noch voller Möglichkeiten zu sein.
Vor diesem Horizont sehe ich auch das meinem Text vorangestellte Zitat aus Sean O‘ Caseys „Der Preispokal“. Kurz zum Inhalt des Theaterstücks:
„Der Pokal ist eine Fußball-Trophäe, die der F. C. Avondales dem Entscheidungstor verdankt, das Harry Heegan schoss. Er und seine Kameraden müssen in den Ersten Weltkrieg, und als sie wiederkommen, gibt es ein paar Krüppel in der ehemaligen Mannschaft. Harrys Beine sind gelähmt, sein Mädchen tanzt mit einem anderen, er wirft ihr den Preispokal vor die Füße und hadert mit Gott und der Welt.“ (34)
Interpretiert man das Zitat des irischen Schriftstellers, so sind mit dem Krieg der Glanz und die innere Spannkraft des Lebens dahin. Durch diesen Verlust kehren alle Versprechungen des Lebens verkrüppelt von den Schlachtfeldern heim. Aus dem Spiel ist bitterer Ernst geworden. Der Preispokal ist verloren, auch dann, wenn man ihn gewinnt.
Deshalb – und weil nichts mehr so sein wird wie es war, als es anfing – „werden kräftige Beine nutzlos und strahlende Augen dunkel“, wie es O‘ Casey anschaulich und schön traurig ausdrückt.
Über die Wünsche und Träume meines Vaters, über seinen „Preispokal“, habe ich nie mit ihm gesprochen. Heute frage ich mich, wieso ich ihn nicht einfach mal danach gefragt habe. Aber dieses eine Mal gab es nicht. Die Wünsche und Träume meiner Mutter hingegen waren in meiner Jugend durchaus präsent, begegneten mir aber doch eher als eine Form von Leid. Das machte etwas mit mir. Es hat in mir das Gefühl bestärkt, meinen eigenen Weg gehen zu wollen und dabei keine faulen Kompromisse zu machen. Ich bekam eine Vorstellung davon, was zu viel falsche Rücksichtnahme auf andere für Dich selber heißen kann und dass es in der Familie auch um Macht über andere, nicht nur um Liebe, gegenseitiges Verständnis und altruistisches Füreinander-Sorgen geht.
An diesem Punkt komme ich nun auf das längere Zitat von Erich Fromm aus dem Vortrag „Zur Theorie und Strategie des Friedens“ zurück, das ich meinem Essay ebenfalls vorangestellt habe. Mit diesem Zitat kann gut zur Koda meiner Überlegungen übergeleitet werden. Fromm betont darin, dass bedeutende und lange auf den geschichtlichen Prozess einwirkende Nebenerscheinungen des Krieges in „der Verdummung, der Lähmung der Vitalität, der Einbildungskraft“ und „dem Schöpferischsein des Menschen“ liegen. Er gibt zu bedenken, dass diese Folgen kriegerischen Handelns „für die (…), die die Gewalt ausüben“ nicht von Nachteil, sondern im Gegenteil durchaus intendiert sein können, da aus diesen Nebenerscheinungen für die Herrschenden zusätzlicher Nutzen gezogen werden kann.
Am Schluss möchte ich daher näher auf das Phänomen der Traumatisierung durch Kriegshandlungen und Kriegsfolgen eingehen, das näher untersucht werden muss, sofern wirklich Aufklärung über die von Fromm benannten Symptome „der Verdummung, der Lähmung der Vitalität, der Einbildungskraft und dem Schöpferischsein des Menschen“ gewollt ist. Wir werden sehen, dass und wie daraus eine Lehre entwickelt werden kann, in der das Persönliche – meine Familiengeschichte – mit dem Allgemeinen – der Mobilisierung der Gesellschaft zu Militarismus und Krieg als Herrschaftsmittel bzw. die Verweigerung der Mobilisierung als Widerstand gegen solch eine Herrschaft – konvergiert.
Für Fromm stand außer Frage, dass die Theorie des Friedens „eine Theorie vom Menschen, eine Theorie von der Gesellschaft und eine Theorie von der Interaktion zwischen Mensch und Gesellschaft erfordert, und zwar eine dynamische Theorie, die von den sichtbaren und noch nicht-manifesten Kräften handelt, die sowohl im Menschen wie in der Gesellschaft vor sich gehen.“
Bedeutung und Wirkungsweisen des Kriegstraumas
Das Zitat von Fromm über die Nebenerscheinungen des Krieges und seine Rede über den Anteil der nicht- bzw. noch nicht manifesten Kräften führen mich an der Stelle zur Trauma-Problematik, weil sich m.E. hinter ihr etwas verbirgt, was aufzuschlüsseln für eine Theorie des Friedens heute von größter Wichtigkeit wäre. Damit schließe ich zugleich nochmal an das Benjamin-Zitat „Wer den Frieden will, rede über den Krieg“ an, denn das „Reden über den Krieg“ – genauer das Reden darüber, was es heißt, nicht heil aus dem Krieg wieder herausgekommen zu sein, also die nicht bewältigten und verarbeiteten Belastungen mit sich herumzuschleppen und weiterzugeben – ist in den Generationen unserer Eltern und Großeltern unter einem Berg von Traumata verschüttet und bis heute nicht geborgen worden.
Diese Traumata sind angesichts der vitiösen massenpsychologischen Mechanismen, so wie sie in der Corona-Plandemie generalstabsmäßig Anwendung fanden (ich erinnere hier nur an das Strategie-Panikpapier aus dem Bundesinnenministerium vom März 2020) und angesichts akuter Kriegsgefahr, gezielter Angsterzeugung und Gehorsamkeitsproduktion durch die Cognitive Warfare (Kognitive Kriegsführung) erneut stark virulent geworden.
Unter Traumapsychologen besteht heute ein breiter Konsens darüber, dass die Gesellschaft an den Folgen einer kollektiven Traumatisierung leidet, die durch den Zweiten Weltkrieg verursacht wurde.
In einem interessanten Aufsatz von Susanne Wolf, der im Mai 2025 vom Multipolar-Magazin veröffentlicht wurde (35), wird dazu die Traumatherapeutin Dami Charf mit den Worten zitiert, dass manche Trauma-Forscher „von einer verdeckten Epidemie“ von Entwicklungstraumata sprechen. Entwicklungstraumata hätten „gravierenden Einfluss auf das Verständnis der Welt, von sich selbst und der eigenen Sicherheit“. Es sei davon auszugehen, dass „traumatische Erfahrungen (…) unser Leben massiv beeinflussen.“ (36)
In diesem Kontext dürfte die Corona-Krise als wichtigste Zäsur in der Nachkriegszeit anzusehen sein, in der dieses kollektiv latent wirkende Trauma erneut zum Ausbruch gebracht wurde. Wolf zitiert hier die Psychotherapeutin und Traumaexpertin Michaela Huber, die die „ganze Corona-Krise als eine Art gesellschaftlicher Schock“ bezeichnet. (37)
Transgenerationale Weitergabe des Traumas und Traumaheilung
Dabei ist wichtig zu wissen, dass Traumata über Generationen weitergegeben werden. Allerdings so, dass „die sichtbaren Auswirkungen manchmal eine Generation überspringen.“ Misst man danach den Zeitabstand zwischen dem Traumaherd und dem Moment seines Wiederaufflammens, wird die Annahme plausibel, dass die Auswirkungen in den letzten fünf Jahren die gesamtgesellschaftliche Sichtbarkeitsgrenze signifikant überschritten haben. In Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, so schreibt Susanne Wolf, „würden Traumaforscher davon ausgehen, dass unsere Gesellschaft an den Folgen eines kollektiven, transgenerationalen Traumas, leidet“. Dabei wird allgemein auf die Rolle der Umweltfaktoren und Lebenserfahrungen als Faktoren hingewiesen, die die Gene beeinflussen. Traumata werden aber nicht eins zu eins weitergegeben, vielmehr ist davon auszugehen, dass sie ihre Gestalt und ihre Erscheinungsweisen ändern.
Einen Weg zur Traumaheilung, auf den Wolf verweist, hat Thomas Hübl, Autor und Mitentwickler des Collective Trauma Integration Process, aufgezeigt: „Wenn eine Person eine individuelle Geschichte erzählt, geht eine Heilungswelle durch die Nervensysteme, die sich auf das Kollektiv“ auswirke. Auch durch künstlerischen Ausdruck werde „nicht-gesehenes sichtbar und Unausgesprochenes hörbar gemacht“. (38)
Diese Methoden sind als Schlüssel anzusehen, um Traumata, d.h. die darin verkapselten oder larvierten und abgespaltene Erfahrungen, produktiv bearbeitbar zu machen und eine Heilung zu erreichen.
Wer inneren wie äußeren Frieden will, muss das Schweigen und die Abwehr durchbrechen, also vom Krieg und dem, was ihm/uns im Krieg widerfuhr, reden. Solange wir unter dem Bann des Verschweigens stehen und uns nicht selbst ermächtigen, wird man immer wieder „Rettung ausgerechnet von jenen (...) erhoffen, die eigentlich ihre (unsere) Peiniger sind“ (Arno Gruen). Erforderlich dafür ist aber eine gemeinsame gesellschaftliche Anstrengung. Ein Klima der Offenheit und Achtsamkeit für diese Phänomene müsste Voraussetzung sein, damit solche individuellen Prozesse gefördert und überhaupt wahrgenommen werden können.
Sind diese Möglichkeiten, wie derzeit, nicht gegeben, fehlt weiterhin die Bereitschaft zu einer ernsthaften (nicht bloß selektiven und ritualisierten) Aufarbeitung des geschichtsmächtigen Traumas des Zweiten Weltkriegs, ist zu befürchten, dass der dem Trauma inhärente Lernvorgang sowohl individuelle weiter krankmachende Überforderungen als auch gesellschaftlich einen noch höheren Anpassungs- und Konformitätsdruck produziert. Wichtig zum Verständnis der Problematik ist, dass Traumata, die zu einer Identifizierung mit dem Aggressor führen, nur aus einer Situation der Angstüberwältigung entstehen. Die Identifizierung mit dem Aggressor ist, wie der Psychologe und Psychoanalytiker Arno Gruen schreibt, „eine Reaktion äußerster Hilflosigkeit“. Für die Psychoanalytikerin Sue Grand, erfüllt sie „die Funktion, das Ausmaß des Missbrauchs weiterhin leugnen zu können.“ Für Sándor Ferenczi „halten die Betroffenen so die Bindung an den misshandelnden Elternteil aufrecht.“ (39) Arno Gruen schreibt:
„Das, was Gehorsam bewirkt und zugleich steuert, ist ein uralter Mechanismus, dessen Wurzeln in früher Kindheit liegen, als wir dem Versuch der uns versorgenden Erwachsenen ausgesetzt waren, uns ihren Willen aufzuzwingen. Diese Erfahrung bedroht jedes Kind mit dem Erlöschen seines eigenen, gerade im Keimen begriffenen Selbst. Das Ergebnis dieses Prozesses ist, dass gerade solche Kinder, deren Willen besonders stark einem Ausmerzen unterworfen war, einen verhängnisvollen Gehorsam und Treue gegenüber Autoritäten entwickeln.“ (40)
Die Überforderungssituation wirkt sich toxisch auf das Zusammenleben aus. Genauer qualifiziert Wolfgang Schmidbauer (41) den durch die Traumatisierung ablaufenden innerpsychischen Lernprozess: „Das seelische Trauma ist ein Lernvorgang, in dem bestimmte Verhaltensweisen in einer ungerechtfertigten Verallgemeinerung erworben werden. (…) Die Abwehr des Traumas erfolgt durch Identifizierung mit dem Angreifer.“ Der Hass auf den Verursacher des Traumas wird in sein Gegenteil verkehrt, weil dadurch die Angst vor dem hasseinflößenden Objekt vermindert wird. Als Beispiele nennt Schmidbauer „ein Kind, dass den Gesichtsausdruck des Lehrers nachahmt, vor dem es besondere Angst hat, oder einen Lehrer, der die Ausdrucksweise eines Vorgesetzten kopiert, den er zutiefst hasst.“ (42)
Für Arno Gruen ist die Abwehr des Traumas gleichbedeutend mit der Quelle für die Entstehung von Feindbildern. „Das Eigene“, das von den Eltern vernachlässigt, missachtet, bestraft wird, „wird (...) zum Fremden, um es dann außerhalb der Grenzen des eigenen Selbst zu bestrafen. (...) Der innere Feind, der mit dem Fremden identisch ist, ist jener Anteil im Kind, der verwirkt wurde, weil Mutter oder Vater oder beide ihn verwarfen, wenn es auf seine eigene Sicht bestand. (...) Der Hass auf das Eigene bringt Kinder hervor, die sich nur noch (...) erleben können, wenn sie diesen Hass nach außen wenden können.“ (43)
Die „ungerechtfertigte Verallgemeinerung“ eines womöglich qua Traumatisierung induzierten Lernvorgangs, der den Hass auf den Verursacher des Traumas verleugnet, den Verursacher idealisiert und daher den Hass nach außen wenden muss, um seine Ich-Schwäche zu überdecken, ist in Bezug auf die Bewertung und Behandlung des Russland-Ukraine- und des Gaza-Konflikts im herrschenden deutschen Mainstream mit Händen zu greifen. Hier kann besichtigt werden, wie die eigenen Bedürfnisse missachtet werden, die moralische Integrität beschädigt und die Entwicklung zur eigenen Autonomie unterdrückt wird.
Identifikation mit dem Angreifer – Deutsche Geschichtsumschreibung als Traumafolge?
Die Nachfahren der Täter des größten Verbrechens des Zweiten Weltkrieges „verallgemeinern“ den russischen Angriff auf die Ukraine nicht nur dahingehend „ungerechtfertigt“, dass sie sich durch das Weglassen bzw. Verzerren seiner Historie moralischen Dispens über die von ihren Großeltern und Urgroßeltern getöteten 27 Millionen Menschen der Sowjet-Republiken, nach Überfall des Hitler-Reichs auf die Sowjetunion am 22.6.1941, erteilen. Welche Erleichterung für das so lange schuldbeladen in Sack und Asche gehende Land! Darüber hinaus wähnen sie sich im Recht, im Namen von Anti-Faschismus, Frieden, Demokratie und Menschenrechten ihre eigenen Waffen erneut gegen die Menschen in Russland zu richten, um ein teils krypto-faschistisches, teils offen faschistisches Regime in der Ukraine zu verteidigen. Der Überhöhung des Objekts – mit der Ukraine verteidigen wir unsere Demokratie und alles, was uns lieb und teuer ist; fällt die Ukraine so werden wir dem aggressiven Ivan auch in die Hände fallen – korrespondiert mit der Dämonisierung Putins als neuem Hitler.
Hinzu kommt, dass der Antisemitismus als „deutsche Staatsräson“ immer absurdere Blüten treibt: In der Ukraine duldet man Antisemitismus und die ihn legitimierende faschistische Ideologie nicht nur, sondern man unterstützt beides. In Bezug auf Israel und den Völkermord der dortigen, ebenfalls mit Faschisten und ultrarechten Zionisten durchsetzten Regierung an den Palästinensern im Gaza-Streifen, stellt man sich schützend vor diese Faschisten und zionistischen Rassisten, die die Palästinenser entmenschlichen, bevor sie sie – auch mit deutschen Waffen – wahllos töten. In Deutschland hingegen rahmt man jede vergleichsweise harmlose Kritik an Migranten als Nazi-Hassrede und würde sie denunziatorisch am liebsten verfolgen. Dort aber wird jeder Palästinenser, werden auch Kinder, zu Hamas-Terroristen, mindestens aber Terror-Kollaborateuren oder willfährigen Werkzeugen (der von Israel erst groß gemachten) Hamas gestempelt, weshalb sie an ihrem Tod letztlich selber schuld seien.
Dabei entgeht den sich „Israelfreunde“ nennenden Akklamateuren und Beihelfern zum Völkermord, dass Kollektiv- (Vor-)Urteile über Völker und die Reduktion von Individuen auf eine einzige Eigenschaft, ihre Zugehörigkeit zu einer Gruppe, immer schon der beste Nährboden für genuin faschistisches Gedankengut waren. Arno Gruen bemerkt: „Diese Abstrahierung macht ein emphatisches Erleben des andern unmöglich.“ Empathie aber „sei die Schranke zur Unmenschlichkeit und der Kern unseres Menschseins.“ (44)
Den symbolhaften Höhepunkt dieser Identifikation mit dem Aggressor, in dessen Zuge die Umschreibung, der Revisionismus der eigenen Geschichte auf dem weggebrochenen Fundament von menschlicher Anteilnahme, Einfühlungsvermögen und gegenseitigem Verstehen, die nichts mehr gelten sollen, mit Hochdruck von statten geht, markiert bislang der 8. Mai 2025, konkret die offizielle Gedenkfeier der Bundesrepublik im Deutschen Bundestag zum Kriegsende vor achtzig Jahren am 8. Mai 1945. Obwohl ohne die sowjetische Rote Armee die Befreiung Deutschlands vom Nazi-Regime noch länger gedauert hätte und die Rote Armee mit Abstand die meisten Opfer in diesem von Nazi-Deutschland als Vernichtungsfeldzug gegen Russland geführten Krieg zu beklagen hatte, verweigerten die Repräsentanten des Täter- und Aggressorenvolks im Berliner Reichstag und auch an vielen anderen offiziellen Gedenkorten Russland und Weißrussland ein Mindestmaß an diplomatischem und menschlichem Respekt.
Die Repräsentanten der Täternation entschieden in geschichtsblindem, moralischem Hochmut, ihre Opfer vom Gedenken auszuschließen. Sie fügten dem schweren Unrecht der Tat ein schweres Unrecht des Erinnerns hinzu. Eine bemerkenswerte Verharmlosung der nationalsozialistischen Gräueltaten paarte sich mit dem stolz vorgetragenen, verantwortungsethisch fatalen Eigenlob, man habe aus der Geschichte gelernt.
Neben der moralischen Widerwärtigkeit, ja Schändlichkeit, die aus diesen Vorgängen sprechen, die auf Entscheidungen deutscher Amtsträger zu einem Zeitpunkt zurückgehen, wo der Frieden zwischen Russland und der Ukraine zum ersten Mal nach drei Jahren wieder in greifbare Nähe gerückt ist, müssen sie auch politisch als ein unüberlegter, dummer und selbstschädigender Akt gewertet werden. Denn, so kommentierte das Schweizer Journal21 die Vorgänge:
„Der Feind von heute wird irgendwann wieder zum Nachbarn, mit dem man Verträge schließt. Das erscheint gegenwärtig in Bezug auf Russland undenkbar. Aber auf die Dauer ist es unausweichlich. Auch daran könnte eine Gedenkfeier erinnern und vor den russischen Gästen den Wunsch zum Ausdruck bringen, dass diese Zeiten nicht allzu lange auf sich warten lassen.“ (45)
„Keiner kommt heil aus dem Krieg wieder raus!“
Eingedenk der transgenerationalen Wirkungsweisen des Weltkriegstraumas, ist es unumgänglich, dass, wenn Krieg und Faschismus sich nicht wiederholen sollen, die obige Erkenntnis sowie das, was aus dieser Erkenntnis folgt, öffentlich, breit und intensiv auf nationaler Bühne diskutiert werden muss. Was der Satz millionenfach und doch jeweils ganz individuell bedeutet, gilt es gerade mit Blick auf den gefährdeten Zustand, in dem sich die Republik heute befindet, zu beleuchten. Ich bin mir sicher, dass aus der Vielzahl an (noch nicht) erzählten Geschichten und (noch nicht) gehaltenen Reden über den Krieg, seinen Interpretationen und Evokationen, wie als Folge eines Dominoeffekts, ein ganzes Diskursuniversum den Raum für die richtigen und dringend notwendigen, da überfälligen Schritte zur Verbesserung (= Zivilisierung) unseres Gemeinwesens und zur Stärkung seiner politischen Kultur schaffen kann. Diese Erneuerung der politischen Kultur muss, so lautet meine These, beim Erinnern ansetzen.
Am Beispiel meiner Familie habe ich mit diesen Erinnerungen meine persönlich grundierte Warnung vor Krieg und Faschismus zu formulieren versucht. Nur dank der Friedenstaube, d.h. nur weil ich wegen der Friedenstaube überhaupt begann, mich mit meinem persönlichen Bezug zum Thema Krieg und Frieden auseinanderzusetzen, bin ich zu der Erkenntnis des besonderen Wertes gelangt, der im persönlichen (nicht im rhetorisch-formelhaft vorgestanzten) Reden über Krieg und Faschismus liegt.
Deshalb finde ich das Pareto-Projekt der unzensierbaren Friedenstaube auch so wichtig, weil genau das sein Anliegen ist: Das Pareto-Projekt möchte diese Erkenntnis – wie sie mir jetzt, aber erst nach diesem Durchgang durch meine Familiengeschichte, unmittelbar vor Augen steht – stiften und kommunizieren!
Bedenkt man, dass laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend über 50% der Bevölkerung der gefährlichen und sozial bedrohlichen Aufrüstung zustimmen (also sich massiv gegen ihre eigenen Interessen aussprechen) und sieht man sich die Schwäche der Friedensbewegung an, wird vor dem Hintergrund der Erkenntnisse der Traumaforschung die Notwendigkeit einer tiefergehenden und differenzierteren Ursachenanalyse deutlich.
Natürlich muss man hier fragen, wie es dazu kommen kann, dass mehr als jeder Zweite – ähnlich wie bei Corona, wo es noch mehr gewesen sein dürften – einem fiktiven Bedrohungsnarrativ glaubt, das ihnen eingehämmert wird, obwohl sich dieses Bedrohungsnarrativ und seine Folgen klar gegen die Interessen der allergrößten Bevölkerungsmehrheit richtet. Dann wird klar, dass es nicht ausreicht, solche Befunde und Ergebnisse allein „auf eine zugespitzte Propaganda (...) und Meinungsmache“, die „Gehirnwäsche in Rekordzeit“ ermöglicht habe, zurückzuführen (46). Es muss auch eine spezifische innerpsychische Disposition dafür geben, eine Disposition, die uns auf die Spur des Traumas bringt.
Die lange anhaltenden Traumatisierungen als Ursprünge für diese psycho-sozialen Fehlentwicklungen, müssen für die Analyse der grassierenden Un-Friedfertigkeit in unserem Land unbedingt mit herangezogen werden, um zu erklären, wie der Friedenskonsens in der Bundesrepublik so schnell und widerstandslos aufgekündigt werden konnte. Dabei muss insbesondere daran gegangen werden, die psycho-sozialen Wurzeln der „Freiwilligen Knechtschaft“ aufzudecken, über die vor über fünfhundert Jahren der Richter, Philosoph und Freund Michel de Montaignes, Étienne de La Boétie (1530-1536), einen noch immer brandaktuellen Essay (47) geschrieben hat.
Psychogenetisch gälte es dafür, den Entwicklungspfad dieser Identifizierung mit dem Aggressor zurückzuverfolgen. Indem man sich die Mechanismen und Projektionen dieses Lernvorgangs vergegenwärtigen würde und dagegen im Sinne Walter Benjamins anspräche, könnte man hinter das Geheimnis des inneren Zwiespalts steigen. Dann ließe sich erkennen, dass der Zwiespalt, unter dem man leidet, selber Produkt eines Gehorsams ist, den man nur aufbringen und leisten kann, weil man von sich selbst entfremdet wurde:
„Besondere Bedeutung gewinnt dieses Problem im Hinblick auf jene Phase (...) des unglücklichen Bewusstseins, in der die Wir-gegen-sie-Mentalität mit ihrer Betonung der Gegensätze überwunden wird und der Mensch erkennt, dass die Knechtschaft auf rätselhafte Weise seinen eigenen Wünschen entspringt.“ (48)
Abschließend, sozusagen als Quintessenz meiner Ausführungen zur Traumatisierung, die in einen Merk-Satz gefasste Forderung:
Die politischen Konsequenzen der Identifikation mit dem Aggressor müssen in der Bundesrepublik für eine nachhaltige Friedensarbeit, Friedenserziehung und Friedensfähigkeit aufgeklärt und aufgearbeitet werden.
Da die Reste der „Friedensdividende“ der Nachkriegsordnung von kriegsgeil gewordenen europäischen Politikern gerade verspielt werden, läuft, wo doch zugleich das Verdrängte stark zur Wiederkehr drängt, die Zeit sonst dafür ab.
Fußnoten
29 Online-Projekt Gefallenendenkmäler Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, http://www.denkmalprojekt.org/2012/eggenfelden_lk-rottal-inn_wk2_bay.html
30 https://patents.google.com/patent/US2652611A/en, https://patents.google.com/patent/DE1435791A1/en?inventor=Jaster+Erich+Hermann+Ernst
31 Alle Zitate und Angaben aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Luftangriffe_auf_Koblenz, letzter Zugriff 15.05.2025.
32 Kriegstrauma bei Kindern und Jugendlichen, http://www.whywar.at/whywar-im-unterricht-nutzen/whywar-fuer-lehrerinnen/kriegs-trauma-bei-kindern-und-jugendlichen/, letzter Zugriff am 15.05.2025.
33 Siehe dazu: Rudolph Bauer, „Wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg“, Vortrag auf der Jahrestagung der Neuen Gesellschaft für Psychologie in Berlin am 11.4.2025, http://www.nrhz.de/flyerbeitrag.php?id=29464
34 https://www.suhrkamptheater.de/stueck/sean-o-casey-der-preispokal-tt-100496
35 https://multipolar-magazin.de/artikel/eine-traumatisierte-gesellschaft, 16.05.2025.
36 Ebd.
37 Wolf, ebd.: „Gründe für die Traumatisierung habe es viele gegeben: rigorose freiheitseinschränkende Maßnahmen, Angst vor einem tödlichen Virus, Existenzangst derjenigen, die schlagartig alleingelassen waren, aber auch von Selbständigen, Geschäftsinhabern oder Künstlern.“ Hinzu sei „der Druck durch die Impfung und der Ausschluss der ‚Ungeimpften‘ wie auch schon vorher die Ausgrenzung derer“ gekommen, „welche die Maßnahmen als ungerechtfertigt kritisierten.“ Dies und die „(fast) Gleichschaltung der öffentlich-rechtlichen und restlichen Mainstream-Medien“ hätten „eine tief verunsicherte und gespaltene Gesellschaft hinterlassen.“
38 Wolf, ebd.
39 https://www.philomag.de/artikel/sue-grand-als-analytikerin-kuemmere-ich-mich-um-die-kulturellen-und-historischen-wunden, 19.06.2025.
40 Arno Gruen, Die Konsequenzen des Gehorsams für die Entwicklung von Identität und Kreativität, https://www.lptw.de/archiv/vortrag/2003/gruen-arno-konsequenzen-des-gehorsams-auf-entwicklung-von-identitaet-und-kreativitaet-lindauer-psychotherapiewochen2003.pdf, 12.04.2003.
41 Wolfgang Schmidbauer, Lexikon Psychologie, Reinbek bei Hamburg, 2001, S.210.
42 Schmidbauer, a.a.O., S.121.
43 Arno Gruen, Die politischen Konsequenzen der Identifizierung mit dem Aggressor, https://web.archive.org/web/20240420223140/http://bidok.uibk.ac.at/library/beh1-00-identifikation.html
44 Gruen, ebd.
45 https://www.journal21.ch/artikel/gedenken-das-kriegsende-ohne-russland, 24.04.2025.
46 So Tobias Riegel in den NachDenkSeiten vom 05.06.2025: „Na, herzlichen Dank an alle Rüstungs-Propagandisten – Wegen Euch unterwerfen sich die Bürger massenhaft einem irren ‚Fünf-Prozent-Ziel’“.
47 Ètienne de La Boétie, Abhandlung über die Freiheit, Innsbruck, 2019.
48 Richard Sennett, Autorität, Frankfurt/M. 1990, S.160.
Teil 1 des Essays von Bernd Schoepe:
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=29563
Online-Flyer Nr. 851 vom 05.09.2025