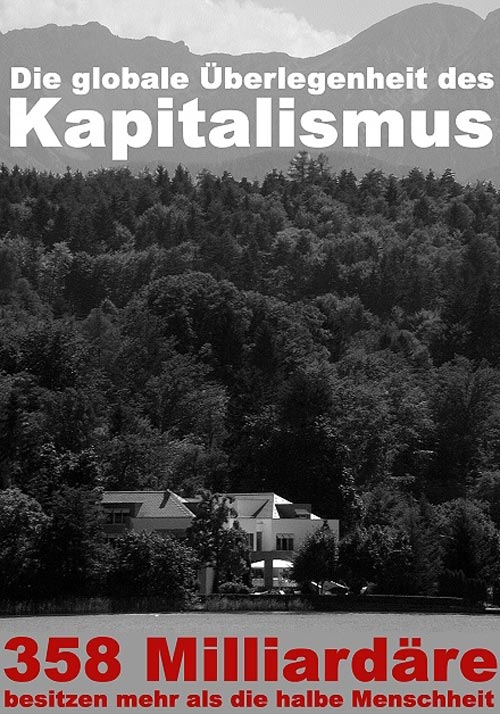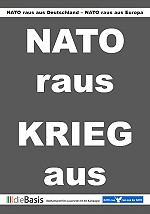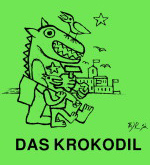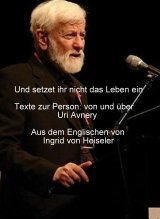SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Globales
Wozu wurde die EWG gegründet?
Wo steht die EU heute?
Von Daniel Jenny
 «Die Staatsmänner, die für die Gestaltung der heutigen Welt durch die Verhandlungen nach jedem dieser beiden [Welt-]Kriege verantwortlich waren, hatten schlechte Karten. Ihr Ziel war es nicht so sehr, Situationen zu schaffen, die zu einer weitreichenden und blühenden Entwicklung führen könnten, sondern vielmehr, die Ergebnisse des Sieges auf Dauer zu sichern.» (1) so sprach Albert Schweitzer zur Verleihung seines Friedensnobelpreises (am 2. November) 1954 in Oslo. In diesem Artikel werden Abläufe und Einflussversuche beschrieben, die zu einem unheilvollen und immer unverfroreneren Duo, der NATO und der EU, geführt haben. Es gibt aber auch Lichtblicke.
«Die Staatsmänner, die für die Gestaltung der heutigen Welt durch die Verhandlungen nach jedem dieser beiden [Welt-]Kriege verantwortlich waren, hatten schlechte Karten. Ihr Ziel war es nicht so sehr, Situationen zu schaffen, die zu einer weitreichenden und blühenden Entwicklung führen könnten, sondern vielmehr, die Ergebnisse des Sieges auf Dauer zu sichern.» (1) so sprach Albert Schweitzer zur Verleihung seines Friedensnobelpreises (am 2. November) 1954 in Oslo. In diesem Artikel werden Abläufe und Einflussversuche beschrieben, die zu einem unheilvollen und immer unverfroreneren Duo, der NATO und der EU, geführt haben. Es gibt aber auch Lichtblicke.
Einleitung
Die Schule von Salamanca im 15. und 16. Jahrhundert (2) begründete das moderne Völkerrecht und formulierte ein neues Konzept einer Völkergemeinschaft, die auf der Basis des Naturrechts alle Völker umfasst. Nach der «Schule von Salamanca» verfügt der Mensch über eine von der Natur gegebene, daher natürliche Freiheit. Der Mensch schliesst sich in Gemeinschaften zusammen, um ganz Mensch sein zu können. Neben dem Zweck der gegenseitigen Hilfe und der Entfaltung aller Kräfte kann der Bildung menschlicher Gemeinschaften noch ein anderer Zweck zugeschrieben werden: die Erhaltung des sozialen und politischen Friedens. Ohne die friedliche Koexistenz der Völker ist die gegenseitige Hilfe schwer aufrechtzuerhalten. Diese menschliche Gemeinschaft kann man auch als Volk oder Staat bezeichnen. Diesen steht als Teil des Kulturgutes ein Schutz zu, wie sie auch in der UN-Charta der Vereinten Nationen von 1945 (3) mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker enthalten ist. Die Wichtigkeit dieses Kulturerbes hat der französische Staatspräsident Charles de Gaulle (von 1958 bis 1969) erkannt: Auch er sucht die europäische Zusammenarbeit, aber in Form einer Allianz zwischen souveränen Regierungen. (4)
Die Gegenspieler dieses Konzepts sind die Gründer der EWG, die eine verdeckt arbeitende «einigende Kraft» einsetzen müssen, um anstelle eines Verbundes von gleichberechtigten Ländern ein zentralistisches Gebilde (Brüssel) zu errichten. Durch verschiedene Vertragswerke wird es künstlich zusammengehalten, an die sich die einzelnen Länder nur bedingt (vgl. Maastricht-Kriterien) halten. Der Hang der EU zu einem bürokratischen Moloch ist augenfällig. (5)
Ich meine, es lohnt sich als Westeuropäer, sich mit dem Thema «Wozu wurde die EWG gegründet? Wo steht die EU heute?» zu beschäftigen.
Ausgangslage nach dem 2. Weltkrieg
1948 wurde die OEEC, die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit, gegründet. In den ersten Jahren ihres Bestehens zählte die OEEC 20 Mitglieder (18 europäische Staaten sowie die USA und Kanada). (7)
Auch Jugoslawien war dabei. Die Schweizer Diplomatie setzte sich im Rahmen dieser Organisation dafür ein, für alle westeuropäischen Länder eine Freihandelszone einzurichten, in der sie als souveräne Staaten auf eine freiheitliche Art zusammenarbeiten konnten. Die Arbeit begann gut. Der im Krieg zusammengebrochene Zahlungsverkehr wurde wieder eingerichtet, Kapitalverkehr wurde wieder möglich und Handelsschranken wurden (nach und nach) abgebaut. (8)
Eine weitere Aufgabe der OEEC war die Koordinierung der Mittel aus dem Marshallplan. (9) (Die Hilfsleistungen bestanden zu einem großen Teil aus Krediten sowie Lieferungen von Rohstoffen, Lebensmitteln und Industriegütern.)
Das Programm verstand sich als Hilfe zur Selbsthilfe und war an Bedingungen geknüpft, wie den Abbau von Handelshemmnissen, die Stabilisierung der eigenen Währung oder die zwischenstaatliche Kooperation. (10)
Offensichtlich gab es in dieser OEEC zwei Kräfte:
Es waren die Amerikaner, die in der Organisation OEEC ihr Veto eingelegt hatten. (11) Sie wollten nicht, dass eine gemeinsame Freihandelszone ohne das Ziel «Vereinigte Staaten von Europa» entsteht. Mit anderen Worten: Entweder kein Freihandel oder Freihandel mit politischer Integration.
Jean Monnet hat die Geschichte Europas in der Nachkriegszeit wesentlich geprägt. Er entwickelte die Idee der Montanunion, der Vorgängerin der EWG. Monnet entwickelte diesen Plan, den er dem französischen Aussenminister Robert Schuman vorlegte. Dieser besprach das Projekt mit der eigenen Regierung und mit dem deutschen Bundeskanzler Adenauer. (Am Abend des 9. Mai) 1950 verkündete (Robert) Schuman den Plan der Öffentlichkeit. (12) So ist die offizielle Geschichte gemäß der Generaldirektion Kommunikation der EU. (13) Die westeuropäischen Länder sollten ihre Kohle- und Stahlindustrie gemeinsam verwalten und einem Gremium (der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, kurz) einer Montanunion (mit Sitz in Luxemburg) übertragen. Diese Montanunion war den Staaten übergeordnet. Die sechs Länder Deutschland, Frankreich, Italien und die drei Benelux-Staaten Belgien, die Niederlande und Luxemburg waren dabei. 1952 wurde Monnet zum ersten Chef der «Hohen Behörde» ernannt. Sein eigentliches Ziel war jedoch die «Vereinigten Staaten von Europa» nach US-Vorbild.
1955 gründete er ein Aktionskomitee für die «Vereinigten Staaten von Europa», um zahlreiche Vertreter aus Parteien und Gewerkschaften der Montanunion (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) einzubeziehen. Er richtete in der Schweiz (in Lausanne am Genfersee) dafür ein Büro ein. Wenig später kam ein Dokumentationszentrum dazu. Hier lagern alle (Entwürfe und) Gründungsdokumente von der Montanunion bis zur EU (der Montanunion, der EWG, der späteren Europäischen Union mit ihren verschiedenen Verträgen). (Jean) Monnet (1957) gründete in Lausanne einen Verein, der die Verwaltung seines Aktionskomitees übernehmen sollte. Die Ford-Stiftung in den USA ermöglichte die Gründung eines Zentrums für europäische Studien und die Universität Lausanne errichtete den ersten Monnet-Lehrstuhl für europäische Integration. Heute gibt es etwa 200 Lehrstühle dieser Art an den europäischen Universitäten. (14)
In der Präambel des EWG-Gründungsvertrages in Rom 1957 wird der feste Wille zum Ausdruck gebracht, «die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen». Es gehörte zum Credo von (Jean) Monnet (und seinen Netzwerken), dass die Wirtschaftsintegration nur ein Schritt auf dem Weg zur Gründung eines europäischen Bundesstaates ist. Die Gesamtheit der europäischen Völker wird zu einer Einheit gefasst, um zu einem einzigen Staat und einem einzigen Staatsvolk zu werden. Der Gruppe von Einzelstaaten und den Volksgruppen fehle es an einer entsprechenden Organisation.
Es drohte eine weitere Spaltung in Europa. Die Initiative einer Minderheit von sechs Ländern, Deutschland, Frankreich, Italien und den drei Benelux-Staaten (Belgien, die Niederlande und Luxemburg), einen separaten Verbund mit einer supranationalen Institution (EWG) einzurichten, wurden deshalb von den anderen als «separatistisch» und «diskriminierend» empfunden. (Peter Thorneycroft) Der Präsident der britischen Handelskammer, äusserte sich 1956 wie folgt: «Worte können es nicht beschönigen, dass mitten in Europa ein diskriminatorischer Block entsteht, der sich abschottet […].» Die meisten Länder Westeuropas bevorzugten eine gleichberechtigte, freiheitliche Zusammenarbeit zwischen souveränen Staaten, wie sie im Rahmen der OEEC eigentlich begonnen hatte.
Mit der Gründung der EWG 1957 wurden jedoch Tatsachen geschaffen. Die nicht beteiligten Länder versuchten zunächst (– trotz der Gründung der EWG –) die Politik der OEEC weiterzuführen und eine Freihandelszone mit allen westeuropäischen Ländern (inklusive der 6 EWG-Länder) einzurichten. Als dies nicht gelang, kam in informellen Treffen der Gedanke auf, (eine Alternative zur EWG zu entwickeln und) einen eigenen Verbund, eine kleine Freihandelszone, zu gründen, in der souveräne Nationen gleichberechtigt, auf freiheitlicher Basis miteinander zusammenarbeiten.
(Am 1. Dezember) 1958 wurde die Schweiz aktiv – nachdem zuvor eine Besprechung mit dem britischen Aussenminister stattgefunden hatte. Die Schweiz lud alle interessierten Kreise zu einer Konferenz in Genf ein. An diesem Treffen wurde das Konzept der EFTA entworfen (und die Konferenzen in Oslo und Stockholm vorbereitet), die wenige Monate später stattfanden. Wichtig war die Rolle Großbritanniens, das sich an den Gründungsverhandlungen der EFTA beteiligt hatte.
Die sieben Länder Großbritannien, Norwegen, Dänemark, Schweden, Portugal, Schweiz und Österreich gründeten (am 4.1.)1960 in Stockholm die EFTA und schufen eine Freihandelszone für Industriegüter. Der Bereich der Landwirtschaft blieb ausgeklammert. Von nun an existierten zwei Organisationen, die beide – auf unterschiedliche Art und Weise – das Ziel verfolgten, die Länder Europas wirtschaftlich zu integrieren. In der Zentrale der EWG in Brüssel arbeiteten etwa 5’000 Personen. Die EFTA richtete ihren Sitz in Genf ein mit etwa 150 Mitarbeitern, worin bereits ihre unterschiedliche Philosophie zum Ausdruck kam – nicht bürokratischer Machtapparat, sondern Förderung des Freihandels. Konkurrierende Vorstellungen, wie «Europa» wirtschaftlich (und politisch) zu integrieren sei, sorgten für Spannung. (15)
Fassen wir die Situation zusammen:
Kaum waren die Unterschriften auf dem Vertrag von Stockholm (1960) trocken, äußert Großbritannien die Absicht, der EWG beitreten zu wollen. Die EFTA als Organisation war noch nicht gefestigt, um einen solchen Rückschlag wegstecken zu können. Großbritannien war mit Abstand die grösste Volkswirtschaft der Vereinigung. – Was nun?
Die sieben EFTA-Staaten kamen (nach einigem Hin und Her) überein, offensiv vorzugehen, das heisst, dass nicht nur Großbritannien, sondern dass alle mit der EWG Beziehung aufnehmen sollten. Kein Mitglied sollte für sich allein agieren und nur in gemeinsamer Absprache aktiv werden. Sie bekräftigen in der Londoner Erklärung vom 28. Juni 1961 ihr Ziel, in Westeuropa eine Freihandelszone für alle einzurichten und die wirtschaftliche Spaltung in Europa zu überwinden. Das war aber nicht das Ziel der USA. Trotzdem artikulierten die Europäer, was sie brauchen und was ihre Interessen sind, im Gegensatz zu heute.
Am 14. Juli 1961 besuchte der US-Unterstaatssekretär George Ball auf eigenen Wunsch die Schweizer Regierung (in Bern und bat um eine Unterredung mit Bundesrat Schaffner und Bundespräsident Wahlen). Er erklärte (den beiden Bundesräten) den amerikanischen Standpunkt:
Es ergab sich die paradoxe Situation, dass die EFTA, noch kaum gegründet, bereits wieder aufgelöst werden sollte – und zwar nach den «Regieanweisungen» der USA.
Die Schweizer Regierung (Der Schweizer Bundesrat Schaffner) suchte den Kontakt zum damalig starken Mann der EWG, General de Gaulle, und traf ihn am 17. November 1961 in Paris. Er erklärte ihm die Lage der Schweiz als neutrales Land (und stiess auf volles Verständnis). Im Bericht ist zu lesen: «Präsident de Gaulle macht wohl den Eindruck einer sehr selbstbewussten Persönlichkeit, ohne aber irgendwie in den Ausdrucksformen eine Überlegenheit zu manifestieren. Im Gegenteil, er strömt eine Atmosphäre der Gastlichkeit aus und weiss sehr gut zuzuhören.»
Das Europa-Konzept von (des französischen Staatspräsidenten Charles) de Gaulle ist wie folgt: Grundlage der Einigung Europas soll nicht die Abtretung nationaler Souveränitätsrechte an überstaatliche Behörden sein, sondern vielmehr die Bewahrung und Kräftigung der bestehenden Nationalstaaten. Auch er beteuert die Notwendigkeit des Fortbestehens der Partnerschaft zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika. Den Amerikanern soll nicht nur der Form, sondern auch der Sache nach ein gleichberechtigtes Europa gegenüberstehen, (nicht «une Europe intégrée, donc diminiuée») kein Juniorpartner.
Grossbritannien begann die Beitrittsverhandlungen mit der EWG, die (Am 14. Januar) der französische Staatspräsident de Gaulle 1963 unterbrach. Er befürchtete zu Recht, dass die Amerikaner mit Grossbritannien ihren Einfluss in Europa verstärken. Damit waren auch die Beitrittsgesuche von Norwegen und Dänemark vom Tisch. Die Assoziationsbemühungen der drei Neutralen Schweiz, Österreich und Schweden wurden auf Eis gelegt. De Gaulle hatte mit seinem Veto (die Umsetzung des «USA-Konzepts» verhindert und) die «Regieanweisungen» aus Washington durchkreuzt, die EFTA-Länder nach und nach in die EWG zu «überführen». Dank ihm konnte die EFTA nun mit ihrer eigentlichen Arbeit beginnen. (19)
Nach diesem Veto (des französischen Staatspräsidenten) nahmen die sieben EFTA-Länder ihren ursprünglichen Plan wieder auf, eine grosse Freihandelszone zu schaffen, die sowohl die Länder der EWG wie auch der EFTA als gleichberechtigte Teilnehmer umfasste. Es gelang, zwischen der EWG und der EFTA einen Freihandelsvertrag zu verhandeln. Die EWG und die EFTA erlebten in der Folgezeit ihre besten Jahre. Die Landwirtschaft blieb den einzelnen EFTA-Ländern überlassen. Das Projekt, die Länder Westeuropas wirtschaftlich zu integrieren, hatte sein Ziel weitgehend erreicht. (20) Der EFTA gelang genau das, was die Amerikaner nicht wollten: Sie handelte einen Freihandelsvertrag mit der EWG ohne politische Einbindung aus.
Die heutige EFTA mit den 4 Mitgliedsländern Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz hat mit 33 Staaten der Weltgemeinschaft Freihandelsabkommen abgeschlossen und mit 3 Staaten steht sie in Verhandlungen (mit 6 weiteren Staaten gibt es eine Erklärung über eine Zusammenarbeit bzw. einen Dialog über engere Handels- und Investitionsbeziehungen). Diese Staaten können gewiss sein, dass sie auf ehrliche Verhandlungspartner treffen, die dem Dialog Vorrang geben und jedwede Form von Zwang verabscheuen. Beachten Sie in Länderstatistiken die Werte dieser 4 Länder. Sie werden feststellen, dass es ihnen gut geht.
Inzwischen zeigt auf Weltebene auch das BRICS-Bündnis (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, Ägypten, Äthiopien, Indonesien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate), dass gedeihliche Entwicklung nur unter Respekt der Souveränität der beteiligten Länder möglich ist. (21)
Die ASEAN ist eine Vereinigung südostasiatischer Staaten (22) (Association of Southeast Asian Nations, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar und Kambodscha), aber kein militärisches Bündnis und keine Union wie die EU. Als erstes Ziel verfolgen sie Frieden und Stabilität und meinen damit Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten und friedliche Konfliktlösung. Diese Länder steckten 1998 wie heute die EU in einer schweren Krise (, die als Asien-Krise in die Geschichte einging). Sie haben es eigenverantwortlich geschafft, ihre ebenfalls riesigen Schuldenberge in den Griff zu bekommen. Die meisten sind praktisch schuldenfrei und haben in den letzten Jahren Reserven gebildet, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein.
Übrigens läutete ebenfalls in den 70er-Jahren die «Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa» (KSZE) den Ost-West-Entspannungsprozess ein, der auch die Sowjetunion umfasste. Auch hier brachte Washington sein Missfallen zum Ausdruck, aber die Europäer führten dies aufgrund eigener Interessen bis zur Unterschrift 1975 weiter. Heute heisst die Organisation OSZE. Wenn es damals ging, warum nicht auch heute?
Jean Monnet
Wer ist Jean Monnets (1888-1979)? Er wurde 1888 in Frankreich geboren. Mit 16 Jahren wurde er zu einem Geschäftspartner seines Vaters nach London geschickt, um dort in die Arbeit der City eingeweiht zu werden. Der 26-jährige Monnet wurde 1914 nicht zum Kriegsdienst eingezogen.
Er führte eine Unterredung mit dem französischen Staatspräsidenten. Monnet präsentierte ihm das Angebot eines kanadischen Handelsunternehmens, der Hudson’s Bay Company, Frankreich einen Kredit über 100 Millionen Gold-Francs zugunsten der französischen Nationalbank (Banque de France) zu bewilligen, damit es in den USA kriegswichtige Güter kaufen konnte. Das Geschäft kam zustande. Die Hudson’s Bay Company stellte der französischen Regierung zusätzlich auch ihre Handelsflotte zur Verfügung. Wie ist es möglich, dass ein 26-jähriger einem Staat ein Rüstungsgeschäft samt Finanzierung einfädelt? War Hr. Monnet ein Werkzeug?
Nachdem das franko-amerikanische Geschäft getätigt war, begab sich Monnet nach London, um dort ein ähnliches franko-britisch-amerikanisches Geschäft in die Wege zu leiten.
Auf Grund seiner engen Beziehungen zu englischen Politikern und Geschäftsleuten, zur amerikanischen Geschäfts- und Bankenwelt und zu einflussreichen französischen Politikern und Bankiers wurde Monnet 1920 zum stellvertretenden Generalsekretär des neu gegründeten Völkerbundes ernannt. 1922 verliess Monnet den Völkerbund und wendete sich verstärkt der Finanzwelt zu. Er wurde Investmentbanker bei «Blair and Co». (23) In seiner Funktion als Vizepräsident der Pariser Filiale der Bank «Blair & Co» (24) spielte Monnet eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung der französischen Währung im Jahre 1926. Er genoss das Vertrauen des Präsidenten der amerikanischen Zentralbank (Federal Reserve Board FED) und übernahm infolgedessen offiziell die Rolle des Vermittlers zwischen Frankreich und den USA bei der Frage der Rückzahlung der französischen Kriegsschulden. Er legte die amerikanische Position dar, die vorsah, dass die französische Nationalbank (Banque de France) (mit anderen Notenbanken, insbesondere) mit der amerikanischen Zentralbank Verträge eingeht (und band Frankreich enger an die USA). Ausserdem gründete er 1935 die Bank «Monnet, Murnane and Co» nach kanadischem Recht, registriert auf Prince Edward Island, Kanada, aber ihrem Hauptsitz in New York. Diese Bank schliesst später einträgliche Geschäfte mit Hitler-Deutschland ab. Damit stand er im Zentrum der internationalen Hochfinanz. Weiterhin war er beteiligt an der Gründung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ, 1930 gegründet) in Basel.
So war es nicht überraschend, dass der französische Premierminister (Daladier 1884–1970) ihn 1938, beauftragte, für die französische Armee Flugzeuge in Amerika zu besorgen. Bei der Ausführung dieses Auftrages lernte er den amerikanischen Präsidenten (1933–1945) Roosevelt kennen. Der amerikanische Finanzminister (1934–1945, Henry Morgenthau) wollte die Finanzierung gesichert sehen. Ausserdem mussten Wege gefunden werden, das amerikanische Neutralitätsgesetz ausser Kraft zu setzen. Nachdem dieses im November 1939 gelockert worden war, kamen der britische Regierungsberater (in Industrieangelegenheiten und Kabinettchef) Chamberlains (Horace Wilson, der schon eine Schlüsselrolle in Chamberlains Appeasement-Politik gespielt hatte,) und Monnet überein, die französischen und britischen Waffenkäufe zu vereinen. Hier erkennt man, wie das Rüstungskartell seine Wege bahnt. Monnet, der schon während des Ersten Weltkriegs (in London) Erfahrungen im Waffenhandel gesammelt hatte, fand bekannte Bedingungen vor. Er hatte schnell verstanden, dass die Amerikaner seit dem Ersten Weltkrieg eine grössere Rolle in der Welt spielten und sich darauf eingestellt. (25)(26)
Gemäss Generaldirektion Kommunikation der EU (27) wird dies so dargestellt: «Während der beiden Weltkriege hatte er hochrangige Positionen im Zusammenhang mit der Koordinierung der Industrieproduktion in Frankreich und im Vereinigten Königreich inne.»
1978 gründete er kurz vor seinem Tod die «Stiftung Jean Monnet für Europa», die über ein weitgesponnenen Netz von Beziehungen verfügt. Über 300 Persönlichkeiten aus ganz Europa – viele von ihnen Politiker und hohe Beamte – gehören dem Stiftungsrat an. Die Stiftung verleiht jedes Jahr eine Ehrenmedaille an Persönlichkeiten (aus ganz Europa), die sich für das Stiftungsziel der «Vereinigten Staaten von Europa» verdient gemacht haben. Dazu gehören zum Beispiel der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl, der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt, Jean Claude Juncker, Romano Prodi und Jacques Delors, von dem wir noch hören werden.
Finanziert wird das Zentrum von der Schweiz, vom Kanton Waadt, von der US-amerikanischen Ford-Stiftung und aus Brüssel. (29)
Es folgen zwei kritische Stimmen aus Frankreich. Philippe de Villiers war (von 1988 bis) 2010 Präsident des Generalrats des französischen Departements Vendée und (zwischen 1994 und 2014) mehrfach Mitglied des Europäischen Parlaments. Er hatte Forschergeist, begab sich in die Archive und hatte den Mut, das Gefundene in einem Buch (32) zu veröffentlichen:
Monnet ist in seiner systemischen Welt gefangen und lässt dem Zusammenleben der Menschen keinen Platz. Offensichtlich kennt er nur Unterordnung und Organisation, wenn er meint (33):
Man muss sich das einmal vorstellen: Jedes Land hat seine Schätze – Österreich hat (die Moskauer Deklaration (36)), das Moskauer Memorandum (, den Staatsvertrag) und das Neutralitätsgesetz. Der EU bleibt nichts anderes übrig, als Jean Monnet, einen Bankier, Waffenhändler und willfährigen Ausführer von amerikanischen Plänen, als ihren Gründer zu loben, der als «einigende Kraft» gegen die Selbstbestimmung (und Souveränität) der nach dem 2. Weltkrieg geschundenen Völker Europas vorging. Man erkennt bei Monet keinerlei Verbundenheit zu den Menschen oder Gedanken über das gesellschaftliche Gemeinwohl. (China orientiert sich an ihrem Philosophen Konfuzius als Vorbild. Was wird sich China über die EU denken?)
EU
Von den vielen Umwandlungen von der EWG über die EG zur EU möchte ich einige herausgreifen:
Länder der BRICS und der ASEAN arbeiten auf eine ähnliche Weise wie die EFTA, ohne politische Vereinigungsversuche, zusammen – mit Erfolg. «Europa» wird es sich nicht leisten können, seine Augen davor zu verschliessen. (46)
Um Verträge abzuschliessen, ist es nicht nötig, Machtpolitik so wie die EU zu betreiben. So ist es der EFTA in den letzten Jahren gelungen (– oft noch vor der EU –), rund um den Globus mit einer Vielzahl von Ländern massgeschneiderte Freihandelsverträge abzuschliessen.
Die Menschen leben als Teil eines Volkes in Nationen. Jede Nation verfügt über ihre eigene Kultur, die folgende Bereiche umfasst (47)
Ende 2024 finden nur mehr 60 Prozent, dass Österreich Mitglied in der EU bleiben sollte. (48)
Nach drei Jahrzehnten EU-Mitgliedschaft sehen sich
Aktuell herrscht im EU-Raum in den Medien die Kriegspropaganda vor. Politik und Militär arbeiten daran, die Mentalität der Bevölkerung den Kriegsszenarien anzupassen. So fordert der NATO-Generalsekretär Rutte im Dezember 2024 (49): «Es ist an der Zeit, eine Kriegsmentalität anzunehmen». Das Ziel der Humanität in unseren Kulturen erfährt durch solche Einflussversuche eine harte Prüfung.
Viele beobachten die Entwicklung besorgt. Die Menschheit will das Ziel der Humanität nicht aus den Augen verlieren und hat das auch klar formuliert. So ist in der UN-Charta (50) (in Kapitel I – Ziele und Grundsätze, Artikel 1, Ziffer 2) über die Ziele der Vereinten Nationen zu lesen:
Fußnoten:
1 https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2024/nr-23-12-november-2024/vor-70-jahren-albert-schweitzer-haelt-seine-rede-zur-verleihung-des-friedensnobelpreises
2 Z.B. mit Francisco de Vitoria (1492–1546) und Francisco Suárez (1548–1617)
3 «Die Vorbereitungen dafür hatten schon zuvor begonnen, nun wurden entscheidende Weichen für die weiteren Beratungen gestellt, so dass schon am 26. Juni 1945 die Satzung der neuen Organisation, die Charta der Vereinten Nationen, ratifiziert und am 24. Oktober 1945 in Kraft treten konnte.» gemäß https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2025/nr-4-18-februar-2025/die-un-charta-sollte-die-rechtliche-grundlage-einer-multipolaren-welt-werden
4 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 2)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr3-vom-1712012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
5 René Roca, https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2025/nr-10-29-april-2025/schweiz
6 Kurt Bayer, Artikel «Die entstehende multipolare Unordnung der Welt-Finanzen» in International I/2024, 2024-1_International_KurtBayer_MultipolareWelt-Finanzen.pdf
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation_fC3%BCr_wirtschaftliche_Zusammenarbeit_und_Entwicklung
8 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 2)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr3-vom-1712012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
9 Andreas Wehr: «Die Europäische Union», PapyRossa
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Marshallplan
11 Werner Wüthrich, «Wirtschaft und direkte Demokratie in der Schweiz», Zeit-Fragen, Kap. 24/Seite 297, siehe auch https://dodis.ch/15113
12 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 1)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2011/nr-50-vom-12122011/die-methode-monnet-als-schluessel-zum-verstaendnis-der-euro-krise
13 https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-pioneers/jean-monnet_de und eu-pioneers-jean-monnet_de.pdf
14 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 1)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2011/nr-50-vom-12122011/die-methode-monnet-als-schluessel-zum-verstaendnis-der-euro-krise
15 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 2)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr3-vom-1712012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
16 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 2)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr3-vom-1712012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
17 Werner Wüthrich, «Wirtschaft und direkte Demokratie in der Schweiz», Zeit-Fragen, Kap. 24/Seite 297
18 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 2)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr3-vom-1712012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
19 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 2)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr3-vom-1712012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
20 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 3)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr5-vom-3012012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
21 Ewald Wetekamp, https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr1415-vom-342012/die-efta-eine-vitale-alternative-zur-eu und https://www.efta.int/
22 https://vintageasia.eu/en/blogs/news/wer-sind-die-asean-staaten-und-wofur-stehen-sie-politisch
23 https://books.openedition.org/igpde/3793
24 Mail vom 15.9.2025 10:43
25 Zeit-Fragen Nr. 38 vom 27.9.2010 und https://eu-austritt.blogspot.com/2015/04/eu-und-strippenzieher-jean-monnet-teil-1.html
26 https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2011/nr-25-vom-2062011/jean-monnet-als-sondergesandter-des-amerikanischen-praesidenten-roosevelt
27 https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-pioneers/jean-monnet_de und eu-pioneers-jean-monnet_de.pdf
28 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 3)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr5-vom-3012012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
29 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 1)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2011/nr-50-vom-12122011/die-methode-monnet-als-schluessel-zum-verstaendnis-der-euro-krise
30 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 2)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr3-vom-1712012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
31 Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 26.1.2012, zitiert in Andreas Wehr «Die europäische Union», PappyRossa
32 Vom 10.06.2020, https://www.fayard.fr/livre/jai-tire-sur-le-fil-du-mensonge-et-tout-est-venu-9782818506189/
33 Kapitel 21: Der Europarat , Seiten 633 bis 662 aus Jean Monnet: Erinnerungen eines Europäers, Carl Hanser Verlag, ISBN 3-446-12421-7, 1978, Titel der Originalausgabe: Mémoire, Edition Fayard, Paris 1976
34 Er spricht hier von Helmut Schmidt.
35 Rita Müller-Hill, https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2019/nr-10-23-april-2019/ich-habe-an-einem-faden-des-luegengespinstes-gezogen-und-es-ist-alles-ans-licht-gekommen
36 1943, https://hdgoe.at/moskauer-deklaration
37 https://de.wikipedia.org/wiki/Einheitliche_Europ%C3%A4ische_Akte
38 https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2021/nr-1213-1-juni-2021/es-ist-allein-das-geld-was-die-eu-noch-zusammenhaelt
39 https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2021/nr-1213-1-juni-2021/es-ist-allein-das-geld-was-die-eu-noch-zusammenhaelt
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/euro/countries-using-euro_de
40 Finanzhoheit: Befugnis zur autonomen Regelung der eigenen Finanzwirtschaft sowie zur Begrenzung der finanzwirtschaftlichen Rechte der übrigen Körperschaften. Finanzhoheit umfasst Gesetzgebungshoheit (Gesetzgebungskompetenz), Verwaltungshoheit und Steuerertragshoheit über öffentliche Einnahmen, bes. Steuereinnahmen. Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/finanzhoheit-35113
41 Zeit-Fragen Nr. 38 vom 27.9.2010 und https://eu-austritt.blogspot.com/2015/04/eu-und-strippenzieher-jean-monnet-teil-1.html
42 https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Lissabon
43 Dank Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider wurde erreicht, dass ein Austritt mit oder ohne Vertrag möglich ist:43 Im EU-Vertrag, Artikel 50, ist unter der 3. Ziffer folgender Text zu lesen: "Die Verträge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mitteilung keine Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu verlängern." Der springende Punkt ist das Wort «andernfalls»: Die sich der EU andienenden Juristen haben den Umstand offensichtlich so verschlungen formuliert, dass die Möglichkeit eines Ausstiegs ohne Vertrag verborgen bleiben sollte. Vermutlich fühlen sich EU-Verantwortliche gekränkt, wenn jemand auf die Idee eines Austritts kommt. Der Austritt Großbritanniens ist leider mit einem Vertrag erfolgt. Dieser Vertrag war für Grossbritannien ungünstig, da die leitenden Verhandler auf britischer Seite alles BREXIT-Gegner waren. Für Großbritannien wäre ein Austritt ohne Vertrag besser gewesen.
44 Offener Brief von Prof. Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas, https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2024/nr-15-23-juli-2024/glaubwuerdigkeit-als-friedensvermittler-wiederherstellen
45 Peter Mattmann-Allamand, https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2025/nr-12-27-mai-2025/weltweite-vorherrschaft-des-westens-die-linke-die-rechte-und-das-reaktionaere-eu-usa-nato-projekt-gefragt-waere-eine-oeko-soziale-kritik-der-kolonialen-lebensweise
46 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 3)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr5-vom-3012012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
47 https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2022/nr-34-8-februar-2022/der-mensch-als-schoepfer-und-geschoepf-der-kultur
48 https://www.meinbezirk.at/c-politik/nur-60-prozent-sehen-einen-mehrwert-in-der-eu_a7080937 Umfragen von Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE)
49 https://www.manova.news/artikel/die-militarisierung-der-gedanken
50 https://unric.org/de/charta/
51 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 5)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr27-vom-2562012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
Online-Flyer Nr. 853 vom 31.10.2025
Wozu wurde die EWG gegründet?
Wo steht die EU heute?
Von Daniel Jenny
 «Die Staatsmänner, die für die Gestaltung der heutigen Welt durch die Verhandlungen nach jedem dieser beiden [Welt-]Kriege verantwortlich waren, hatten schlechte Karten. Ihr Ziel war es nicht so sehr, Situationen zu schaffen, die zu einer weitreichenden und blühenden Entwicklung führen könnten, sondern vielmehr, die Ergebnisse des Sieges auf Dauer zu sichern.» (1) so sprach Albert Schweitzer zur Verleihung seines Friedensnobelpreises (am 2. November) 1954 in Oslo. In diesem Artikel werden Abläufe und Einflussversuche beschrieben, die zu einem unheilvollen und immer unverfroreneren Duo, der NATO und der EU, geführt haben. Es gibt aber auch Lichtblicke.
«Die Staatsmänner, die für die Gestaltung der heutigen Welt durch die Verhandlungen nach jedem dieser beiden [Welt-]Kriege verantwortlich waren, hatten schlechte Karten. Ihr Ziel war es nicht so sehr, Situationen zu schaffen, die zu einer weitreichenden und blühenden Entwicklung führen könnten, sondern vielmehr, die Ergebnisse des Sieges auf Dauer zu sichern.» (1) so sprach Albert Schweitzer zur Verleihung seines Friedensnobelpreises (am 2. November) 1954 in Oslo. In diesem Artikel werden Abläufe und Einflussversuche beschrieben, die zu einem unheilvollen und immer unverfroreneren Duo, der NATO und der EU, geführt haben. Es gibt aber auch Lichtblicke. Einleitung
Die Schule von Salamanca im 15. und 16. Jahrhundert (2) begründete das moderne Völkerrecht und formulierte ein neues Konzept einer Völkergemeinschaft, die auf der Basis des Naturrechts alle Völker umfasst. Nach der «Schule von Salamanca» verfügt der Mensch über eine von der Natur gegebene, daher natürliche Freiheit. Der Mensch schliesst sich in Gemeinschaften zusammen, um ganz Mensch sein zu können. Neben dem Zweck der gegenseitigen Hilfe und der Entfaltung aller Kräfte kann der Bildung menschlicher Gemeinschaften noch ein anderer Zweck zugeschrieben werden: die Erhaltung des sozialen und politischen Friedens. Ohne die friedliche Koexistenz der Völker ist die gegenseitige Hilfe schwer aufrechtzuerhalten. Diese menschliche Gemeinschaft kann man auch als Volk oder Staat bezeichnen. Diesen steht als Teil des Kulturgutes ein Schutz zu, wie sie auch in der UN-Charta der Vereinten Nationen von 1945 (3) mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker enthalten ist. Die Wichtigkeit dieses Kulturerbes hat der französische Staatspräsident Charles de Gaulle (von 1958 bis 1969) erkannt: Auch er sucht die europäische Zusammenarbeit, aber in Form einer Allianz zwischen souveränen Regierungen. (4)
Die Gegenspieler dieses Konzepts sind die Gründer der EWG, die eine verdeckt arbeitende «einigende Kraft» einsetzen müssen, um anstelle eines Verbundes von gleichberechtigten Ländern ein zentralistisches Gebilde (Brüssel) zu errichten. Durch verschiedene Vertragswerke wird es künstlich zusammengehalten, an die sich die einzelnen Länder nur bedingt (vgl. Maastricht-Kriterien) halten. Der Hang der EU zu einem bürokratischen Moloch ist augenfällig. (5)
Ich meine, es lohnt sich als Westeuropäer, sich mit dem Thema «Wozu wurde die EWG gegründet? Wo steht die EU heute?» zu beschäftigen.
Ausgangslage nach dem 2. Weltkrieg
1948 wurde die OEEC, die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit, gegründet. In den ersten Jahren ihres Bestehens zählte die OEEC 20 Mitglieder (18 europäische Staaten sowie die USA und Kanada). (7)
Auch Jugoslawien war dabei. Die Schweizer Diplomatie setzte sich im Rahmen dieser Organisation dafür ein, für alle westeuropäischen Länder eine Freihandelszone einzurichten, in der sie als souveräne Staaten auf eine freiheitliche Art zusammenarbeiten konnten. Die Arbeit begann gut. Der im Krieg zusammengebrochene Zahlungsverkehr wurde wieder eingerichtet, Kapitalverkehr wurde wieder möglich und Handelsschranken wurden (nach und nach) abgebaut. (8)
Eine weitere Aufgabe der OEEC war die Koordinierung der Mittel aus dem Marshallplan. (9) (Die Hilfsleistungen bestanden zu einem großen Teil aus Krediten sowie Lieferungen von Rohstoffen, Lebensmitteln und Industriegütern.)
Das Programm verstand sich als Hilfe zur Selbsthilfe und war an Bedingungen geknüpft, wie den Abbau von Handelshemmnissen, die Stabilisierung der eigenen Währung oder die zwischenstaatliche Kooperation. (10)
Offensichtlich gab es in dieser OEEC zwei Kräfte:
- einerseits die Europäer, die ohne Störung von aussen ihr zerstörtes Gemeinwesen wieder aufbauen wollten und
- andererseits die amerikanischen Gewinner des Krieges, die ihre Führerschaft nicht aus der Hand geben wollten.
Es waren die Amerikaner, die in der Organisation OEEC ihr Veto eingelegt hatten. (11) Sie wollten nicht, dass eine gemeinsame Freihandelszone ohne das Ziel «Vereinigte Staaten von Europa» entsteht. Mit anderen Worten: Entweder kein Freihandel oder Freihandel mit politischer Integration.
Jean Monnet hat die Geschichte Europas in der Nachkriegszeit wesentlich geprägt. Er entwickelte die Idee der Montanunion, der Vorgängerin der EWG. Monnet entwickelte diesen Plan, den er dem französischen Aussenminister Robert Schuman vorlegte. Dieser besprach das Projekt mit der eigenen Regierung und mit dem deutschen Bundeskanzler Adenauer. (Am Abend des 9. Mai) 1950 verkündete (Robert) Schuman den Plan der Öffentlichkeit. (12) So ist die offizielle Geschichte gemäß der Generaldirektion Kommunikation der EU. (13) Die westeuropäischen Länder sollten ihre Kohle- und Stahlindustrie gemeinsam verwalten und einem Gremium (der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, kurz) einer Montanunion (mit Sitz in Luxemburg) übertragen. Diese Montanunion war den Staaten übergeordnet. Die sechs Länder Deutschland, Frankreich, Italien und die drei Benelux-Staaten Belgien, die Niederlande und Luxemburg waren dabei. 1952 wurde Monnet zum ersten Chef der «Hohen Behörde» ernannt. Sein eigentliches Ziel war jedoch die «Vereinigten Staaten von Europa» nach US-Vorbild.
1955 gründete er ein Aktionskomitee für die «Vereinigten Staaten von Europa», um zahlreiche Vertreter aus Parteien und Gewerkschaften der Montanunion (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) einzubeziehen. Er richtete in der Schweiz (in Lausanne am Genfersee) dafür ein Büro ein. Wenig später kam ein Dokumentationszentrum dazu. Hier lagern alle (Entwürfe und) Gründungsdokumente von der Montanunion bis zur EU (der Montanunion, der EWG, der späteren Europäischen Union mit ihren verschiedenen Verträgen). (Jean) Monnet (1957) gründete in Lausanne einen Verein, der die Verwaltung seines Aktionskomitees übernehmen sollte. Die Ford-Stiftung in den USA ermöglichte die Gründung eines Zentrums für europäische Studien und die Universität Lausanne errichtete den ersten Monnet-Lehrstuhl für europäische Integration. Heute gibt es etwa 200 Lehrstühle dieser Art an den europäischen Universitäten. (14)
In der Präambel des EWG-Gründungsvertrages in Rom 1957 wird der feste Wille zum Ausdruck gebracht, «die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen». Es gehörte zum Credo von (Jean) Monnet (und seinen Netzwerken), dass die Wirtschaftsintegration nur ein Schritt auf dem Weg zur Gründung eines europäischen Bundesstaates ist. Die Gesamtheit der europäischen Völker wird zu einer Einheit gefasst, um zu einem einzigen Staat und einem einzigen Staatsvolk zu werden. Der Gruppe von Einzelstaaten und den Volksgruppen fehle es an einer entsprechenden Organisation.
Es drohte eine weitere Spaltung in Europa. Die Initiative einer Minderheit von sechs Ländern, Deutschland, Frankreich, Italien und den drei Benelux-Staaten (Belgien, die Niederlande und Luxemburg), einen separaten Verbund mit einer supranationalen Institution (EWG) einzurichten, wurden deshalb von den anderen als «separatistisch» und «diskriminierend» empfunden. (Peter Thorneycroft) Der Präsident der britischen Handelskammer, äusserte sich 1956 wie folgt: «Worte können es nicht beschönigen, dass mitten in Europa ein diskriminatorischer Block entsteht, der sich abschottet […].» Die meisten Länder Westeuropas bevorzugten eine gleichberechtigte, freiheitliche Zusammenarbeit zwischen souveränen Staaten, wie sie im Rahmen der OEEC eigentlich begonnen hatte.
Mit der Gründung der EWG 1957 wurden jedoch Tatsachen geschaffen. Die nicht beteiligten Länder versuchten zunächst (– trotz der Gründung der EWG –) die Politik der OEEC weiterzuführen und eine Freihandelszone mit allen westeuropäischen Ländern (inklusive der 6 EWG-Länder) einzurichten. Als dies nicht gelang, kam in informellen Treffen der Gedanke auf, (eine Alternative zur EWG zu entwickeln und) einen eigenen Verbund, eine kleine Freihandelszone, zu gründen, in der souveräne Nationen gleichberechtigt, auf freiheitlicher Basis miteinander zusammenarbeiten.
(Am 1. Dezember) 1958 wurde die Schweiz aktiv – nachdem zuvor eine Besprechung mit dem britischen Aussenminister stattgefunden hatte. Die Schweiz lud alle interessierten Kreise zu einer Konferenz in Genf ein. An diesem Treffen wurde das Konzept der EFTA entworfen (und die Konferenzen in Oslo und Stockholm vorbereitet), die wenige Monate später stattfanden. Wichtig war die Rolle Großbritanniens, das sich an den Gründungsverhandlungen der EFTA beteiligt hatte.
Die sieben Länder Großbritannien, Norwegen, Dänemark, Schweden, Portugal, Schweiz und Österreich gründeten (am 4.1.)1960 in Stockholm die EFTA und schufen eine Freihandelszone für Industriegüter. Der Bereich der Landwirtschaft blieb ausgeklammert. Von nun an existierten zwei Organisationen, die beide – auf unterschiedliche Art und Weise – das Ziel verfolgten, die Länder Europas wirtschaftlich zu integrieren. In der Zentrale der EWG in Brüssel arbeiteten etwa 5’000 Personen. Die EFTA richtete ihren Sitz in Genf ein mit etwa 150 Mitarbeitern, worin bereits ihre unterschiedliche Philosophie zum Ausdruck kam – nicht bürokratischer Machtapparat, sondern Förderung des Freihandels. Konkurrierende Vorstellungen, wie «Europa» wirtschaftlich (und politisch) zu integrieren sei, sorgten für Spannung. (15)
Fassen wir die Situation zusammen:
- 1948 wird die Organisation OEEC gegründet, die spätere OECD, in der alle europäischen Länder vertreten sind. Hier hätte die Möglichkeit bestanden, den Handel für alle auszubauen.
- 1957 wird die EWG mit 6 Ländern gegründet, die neben dem Ausbau des Handels das Ziel der «Vereinigten Staaten von Europa» verfolgt.
- Als Antwort darauf wird 1960 die EFTA von 7 Ländern gegründet, die zwar mehr Handel treiben wollen, aber keine politische Integration wünschen.
Kaum waren die Unterschriften auf dem Vertrag von Stockholm (1960) trocken, äußert Großbritannien die Absicht, der EWG beitreten zu wollen. Die EFTA als Organisation war noch nicht gefestigt, um einen solchen Rückschlag wegstecken zu können. Großbritannien war mit Abstand die grösste Volkswirtschaft der Vereinigung. – Was nun?
Die sieben EFTA-Staaten kamen (nach einigem Hin und Her) überein, offensiv vorzugehen, das heisst, dass nicht nur Großbritannien, sondern dass alle mit der EWG Beziehung aufnehmen sollten. Kein Mitglied sollte für sich allein agieren und nur in gemeinsamer Absprache aktiv werden. Sie bekräftigen in der Londoner Erklärung vom 28. Juni 1961 ihr Ziel, in Westeuropa eine Freihandelszone für alle einzurichten und die wirtschaftliche Spaltung in Europa zu überwinden. Das war aber nicht das Ziel der USA. Trotzdem artikulierten die Europäer, was sie brauchen und was ihre Interessen sind, im Gegensatz zu heute.
Am 14. Juli 1961 besuchte der US-Unterstaatssekretär George Ball auf eigenen Wunsch die Schweizer Regierung (in Bern und bat um eine Unterredung mit Bundesrat Schaffner und Bundespräsident Wahlen). Er erklärte (den beiden Bundesräten) den amerikanischen Standpunkt:
- Die wichtigsten Punkte werden in einer Aktennotiz festgehalten. (dodis.ch/30116) Der amerikanische Gesandte legte offen, dass die amerikanische Regierung die britische Regierung sehr zu einem Beitritt zur EWG «ermuntert» habe. Gemäss Aktennotiz habe eine Unterredung zwischen dem US-Präsidenten Kennedy und dem englischen Premier MacMillan stattgefunden.
- Ein bloss wirtschaftliches Arrangement zwischen der EWG und den EFTA-Ländern würde den politischen Gehalt der EWG verwässern. Die Amerikaner betrachteten Verhandlungen zwischen der EWG und der EFTA im Hinblick auf eine rein wirtschaftliche Zusammenarbeit als nicht wünschenswert. (16)
- Mit dieser Einmischung in innere Angelegenheiten der Europäer war der Gesandte noch nicht fertig: Die USA würden einen Wirtschaftsvertrag zwischen der EWG und der EFTA nicht tolerieren, sondern sie erwarteten, dass die NATO-Länder innerhalb der EFTA so schnell wie möglich der EWG beitreten – allen voran Großbritannien, danach auch Dänemark, Norwegen und Portugal.
- Danach sollten die drei Länder Schweiz, Österreich und Schweden mit Brüssel Verhandlungen aufnehmen und einzeln einen Assoziierungsvertrag abschließen, der die politische Zielsetzung der EWG unterstützt. Der Wortlaut der Aktennotiz lautete wie folgt: «Die Amerikaner erachten Verhandlungen zwischen der EWG und der EFTA als Gruppe im Hinblick auf eine rein wirtschaftliche Vereinbarung als nicht wünschenswert und im übrigen als von vornherein aussichtslos.» Ball liess durchblicken, dass eine Freihandelszone für ganz Westeuropa – ohne politische Ausrichtung – von den USA nicht geduldet würde. Die Schweizer Regierung (Bundespräsident Wahlen) kommentierte den Besuch aus Washington wie folgt: «Die USA unterstützen die Zielsetzung der EWG und erstreben die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa. Wer sich dieser Zielsetzung verschliesst, kann nicht mit der Sympathie Washingtons rechnen.» (17)
Es ergab sich die paradoxe Situation, dass die EFTA, noch kaum gegründet, bereits wieder aufgelöst werden sollte – und zwar nach den «Regieanweisungen» der USA.
Die Schweizer Regierung (Der Schweizer Bundesrat Schaffner) suchte den Kontakt zum damalig starken Mann der EWG, General de Gaulle, und traf ihn am 17. November 1961 in Paris. Er erklärte ihm die Lage der Schweiz als neutrales Land (und stiess auf volles Verständnis). Im Bericht ist zu lesen: «Präsident de Gaulle macht wohl den Eindruck einer sehr selbstbewussten Persönlichkeit, ohne aber irgendwie in den Ausdrucksformen eine Überlegenheit zu manifestieren. Im Gegenteil, er strömt eine Atmosphäre der Gastlichkeit aus und weiss sehr gut zuzuhören.»
Das Europa-Konzept von (des französischen Staatspräsidenten Charles) de Gaulle ist wie folgt: Grundlage der Einigung Europas soll nicht die Abtretung nationaler Souveränitätsrechte an überstaatliche Behörden sein, sondern vielmehr die Bewahrung und Kräftigung der bestehenden Nationalstaaten. Auch er beteuert die Notwendigkeit des Fortbestehens der Partnerschaft zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika. Den Amerikanern soll nicht nur der Form, sondern auch der Sache nach ein gleichberechtigtes Europa gegenüberstehen, (nicht «une Europe intégrée, donc diminiuée») kein Juniorpartner.
Grossbritannien begann die Beitrittsverhandlungen mit der EWG, die (Am 14. Januar) der französische Staatspräsident de Gaulle 1963 unterbrach. Er befürchtete zu Recht, dass die Amerikaner mit Grossbritannien ihren Einfluss in Europa verstärken. Damit waren auch die Beitrittsgesuche von Norwegen und Dänemark vom Tisch. Die Assoziationsbemühungen der drei Neutralen Schweiz, Österreich und Schweden wurden auf Eis gelegt. De Gaulle hatte mit seinem Veto (die Umsetzung des «USA-Konzepts» verhindert und) die «Regieanweisungen» aus Washington durchkreuzt, die EFTA-Länder nach und nach in die EWG zu «überführen». Dank ihm konnte die EFTA nun mit ihrer eigentlichen Arbeit beginnen. (19)
Nach diesem Veto (des französischen Staatspräsidenten) nahmen die sieben EFTA-Länder ihren ursprünglichen Plan wieder auf, eine grosse Freihandelszone zu schaffen, die sowohl die Länder der EWG wie auch der EFTA als gleichberechtigte Teilnehmer umfasste. Es gelang, zwischen der EWG und der EFTA einen Freihandelsvertrag zu verhandeln. Die EWG und die EFTA erlebten in der Folgezeit ihre besten Jahre. Die Landwirtschaft blieb den einzelnen EFTA-Ländern überlassen. Das Projekt, die Länder Westeuropas wirtschaftlich zu integrieren, hatte sein Ziel weitgehend erreicht. (20) Der EFTA gelang genau das, was die Amerikaner nicht wollten: Sie handelte einen Freihandelsvertrag mit der EWG ohne politische Einbindung aus.
Die heutige EFTA mit den 4 Mitgliedsländern Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz hat mit 33 Staaten der Weltgemeinschaft Freihandelsabkommen abgeschlossen und mit 3 Staaten steht sie in Verhandlungen (mit 6 weiteren Staaten gibt es eine Erklärung über eine Zusammenarbeit bzw. einen Dialog über engere Handels- und Investitionsbeziehungen). Diese Staaten können gewiss sein, dass sie auf ehrliche Verhandlungspartner treffen, die dem Dialog Vorrang geben und jedwede Form von Zwang verabscheuen. Beachten Sie in Länderstatistiken die Werte dieser 4 Länder. Sie werden feststellen, dass es ihnen gut geht.
Inzwischen zeigt auf Weltebene auch das BRICS-Bündnis (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, Ägypten, Äthiopien, Indonesien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate), dass gedeihliche Entwicklung nur unter Respekt der Souveränität der beteiligten Länder möglich ist. (21)
Die ASEAN ist eine Vereinigung südostasiatischer Staaten (22) (Association of Southeast Asian Nations, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar und Kambodscha), aber kein militärisches Bündnis und keine Union wie die EU. Als erstes Ziel verfolgen sie Frieden und Stabilität und meinen damit Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten und friedliche Konfliktlösung. Diese Länder steckten 1998 wie heute die EU in einer schweren Krise (, die als Asien-Krise in die Geschichte einging). Sie haben es eigenverantwortlich geschafft, ihre ebenfalls riesigen Schuldenberge in den Griff zu bekommen. Die meisten sind praktisch schuldenfrei und haben in den letzten Jahren Reserven gebildet, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein.
Übrigens läutete ebenfalls in den 70er-Jahren die «Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa» (KSZE) den Ost-West-Entspannungsprozess ein, der auch die Sowjetunion umfasste. Auch hier brachte Washington sein Missfallen zum Ausdruck, aber die Europäer führten dies aufgrund eigener Interessen bis zur Unterschrift 1975 weiter. Heute heisst die Organisation OSZE. Wenn es damals ging, warum nicht auch heute?
Jean Monnet
Wer ist Jean Monnets (1888-1979)? Er wurde 1888 in Frankreich geboren. Mit 16 Jahren wurde er zu einem Geschäftspartner seines Vaters nach London geschickt, um dort in die Arbeit der City eingeweiht zu werden. Der 26-jährige Monnet wurde 1914 nicht zum Kriegsdienst eingezogen.
Er führte eine Unterredung mit dem französischen Staatspräsidenten. Monnet präsentierte ihm das Angebot eines kanadischen Handelsunternehmens, der Hudson’s Bay Company, Frankreich einen Kredit über 100 Millionen Gold-Francs zugunsten der französischen Nationalbank (Banque de France) zu bewilligen, damit es in den USA kriegswichtige Güter kaufen konnte. Das Geschäft kam zustande. Die Hudson’s Bay Company stellte der französischen Regierung zusätzlich auch ihre Handelsflotte zur Verfügung. Wie ist es möglich, dass ein 26-jähriger einem Staat ein Rüstungsgeschäft samt Finanzierung einfädelt? War Hr. Monnet ein Werkzeug?
Nachdem das franko-amerikanische Geschäft getätigt war, begab sich Monnet nach London, um dort ein ähnliches franko-britisch-amerikanisches Geschäft in die Wege zu leiten.
Auf Grund seiner engen Beziehungen zu englischen Politikern und Geschäftsleuten, zur amerikanischen Geschäfts- und Bankenwelt und zu einflussreichen französischen Politikern und Bankiers wurde Monnet 1920 zum stellvertretenden Generalsekretär des neu gegründeten Völkerbundes ernannt. 1922 verliess Monnet den Völkerbund und wendete sich verstärkt der Finanzwelt zu. Er wurde Investmentbanker bei «Blair and Co». (23) In seiner Funktion als Vizepräsident der Pariser Filiale der Bank «Blair & Co» (24) spielte Monnet eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung der französischen Währung im Jahre 1926. Er genoss das Vertrauen des Präsidenten der amerikanischen Zentralbank (Federal Reserve Board FED) und übernahm infolgedessen offiziell die Rolle des Vermittlers zwischen Frankreich und den USA bei der Frage der Rückzahlung der französischen Kriegsschulden. Er legte die amerikanische Position dar, die vorsah, dass die französische Nationalbank (Banque de France) (mit anderen Notenbanken, insbesondere) mit der amerikanischen Zentralbank Verträge eingeht (und band Frankreich enger an die USA). Ausserdem gründete er 1935 die Bank «Monnet, Murnane and Co» nach kanadischem Recht, registriert auf Prince Edward Island, Kanada, aber ihrem Hauptsitz in New York. Diese Bank schliesst später einträgliche Geschäfte mit Hitler-Deutschland ab. Damit stand er im Zentrum der internationalen Hochfinanz. Weiterhin war er beteiligt an der Gründung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ, 1930 gegründet) in Basel.
So war es nicht überraschend, dass der französische Premierminister (Daladier 1884–1970) ihn 1938, beauftragte, für die französische Armee Flugzeuge in Amerika zu besorgen. Bei der Ausführung dieses Auftrages lernte er den amerikanischen Präsidenten (1933–1945) Roosevelt kennen. Der amerikanische Finanzminister (1934–1945, Henry Morgenthau) wollte die Finanzierung gesichert sehen. Ausserdem mussten Wege gefunden werden, das amerikanische Neutralitätsgesetz ausser Kraft zu setzen. Nachdem dieses im November 1939 gelockert worden war, kamen der britische Regierungsberater (in Industrieangelegenheiten und Kabinettchef) Chamberlains (Horace Wilson, der schon eine Schlüsselrolle in Chamberlains Appeasement-Politik gespielt hatte,) und Monnet überein, die französischen und britischen Waffenkäufe zu vereinen. Hier erkennt man, wie das Rüstungskartell seine Wege bahnt. Monnet, der schon während des Ersten Weltkriegs (in London) Erfahrungen im Waffenhandel gesammelt hatte, fand bekannte Bedingungen vor. Er hatte schnell verstanden, dass die Amerikaner seit dem Ersten Weltkrieg eine grössere Rolle in der Welt spielten und sich darauf eingestellt. (25)(26)
Gemäss Generaldirektion Kommunikation der EU (27) wird dies so dargestellt: «Während der beiden Weltkriege hatte er hochrangige Positionen im Zusammenhang mit der Koordinierung der Industrieproduktion in Frankreich und im Vereinigten Königreich inne.»
1978 gründete er kurz vor seinem Tod die «Stiftung Jean Monnet für Europa», die über ein weitgesponnenen Netz von Beziehungen verfügt. Über 300 Persönlichkeiten aus ganz Europa – viele von ihnen Politiker und hohe Beamte – gehören dem Stiftungsrat an. Die Stiftung verleiht jedes Jahr eine Ehrenmedaille an Persönlichkeiten (aus ganz Europa), die sich für das Stiftungsziel der «Vereinigten Staaten von Europa» verdient gemacht haben. Dazu gehören zum Beispiel der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl, der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt, Jean Claude Juncker, Romano Prodi und Jacques Delors, von dem wir noch hören werden.
Finanziert wird das Zentrum von der Schweiz, vom Kanton Waadt, von der US-amerikanischen Ford-Stiftung und aus Brüssel. (29)
Es folgen zwei kritische Stimmen aus Frankreich. Philippe de Villiers war (von 1988 bis) 2010 Präsident des Generalrats des französischen Departements Vendée und (zwischen 1994 und 2014) mehrfach Mitglied des Europäischen Parlaments. Er hatte Forschergeist, begab sich in die Archive und hatte den Mut, das Gefundene in einem Buch (32) zu veröffentlichen:
- Er fand Dokumente, die eindeutig beweisen, dass Monnet von der CIA für seine Aktivitäten als «Gründervater Europas» bezahlt wurde und dass (Robert) Schumann auch im Dienst der US-Amerikaner war.
- Und Walter Hallstein, NS-Ausbildungsoffizier und juristischer Spezialist der Nazis für «Das Neue Europa», war nach dem Weltkrieg in Deutschland (1951 bis 1958) Staatssekretär im Auswärtigen Amt und anschließend (bis 1967 der erste) Vorsitzender der Kommission der EWG. Auch er stellte seine Dienste den Amerikanern zur Verfügung.
Monnet ist in seiner systemischen Welt gefangen und lässt dem Zusammenleben der Menschen keinen Platz. Offensichtlich kennt er nur Unterordnung und Organisation, wenn er meint (33):
- «Ich beschäftigte mich weiterhin mit der Suche nach einer gemeinsamen Autorität, die fähig wäre, den Willen zum Zusammenleben, den die große Mehrheit der Europäer bei öffentlichen Umfragen gezeigt hatte, in Entscheidungen umzumünzen.»
- «Wesentlich ist, dass es keine getrennten nationalen Aktionen mehr gibt, sondern europäisches Handeln».
- «Entsprechend dem Vertrag und dem gesunden Menschenverstand haben sie angekündigt, daß sie im Rat nicht weiterhin Einstimmigkeit fordern werden».
- «Welche Schwierigkeiten auch auftreten mochten, sie hatten nur eine Möglichkeit: unaufhörlich weiterzufahren. Auch wir gehen auf unser Ziel, die Vereinigten Staaten von Europa zu, auf einem Weg ohne Umkehr. […] Die souveränen Nationen der Vergangenheit sind nicht mehr der Rahmen, in dem sich die Probleme der Gegenwart lösen lassen. Und die Gemeinschaft selbst ist nur eine Etappe auf dem Weg zu Organisationsformen der Welt von morgen.»
Man muss sich das einmal vorstellen: Jedes Land hat seine Schätze – Österreich hat (die Moskauer Deklaration (36)), das Moskauer Memorandum (, den Staatsvertrag) und das Neutralitätsgesetz. Der EU bleibt nichts anderes übrig, als Jean Monnet, einen Bankier, Waffenhändler und willfährigen Ausführer von amerikanischen Plänen, als ihren Gründer zu loben, der als «einigende Kraft» gegen die Selbstbestimmung (und Souveränität) der nach dem 2. Weltkrieg geschundenen Völker Europas vorging. Man erkennt bei Monet keinerlei Verbundenheit zu den Menschen oder Gedanken über das gesellschaftliche Gemeinwohl. (China orientiert sich an ihrem Philosophen Konfuzius als Vorbild. Was wird sich China über die EU denken?)
EU
Von den vielen Umwandlungen von der EWG über die EG zur EU möchte ich einige herausgreifen:
- Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) (37) und den später folgenden Vertragswerken (Maastricht, Amsterdam, Nizza und Lissabon) trat die EWG 1986 in den Dienst der amerikanischen und europäischen Grosskonzerne. Die EU wurde deren Statthalter. Sie sollte die Globalisierung in Europa durchsetzen und zusammen mit den USA weltweit vorantreiben. Der freie Verkehr von Kapital, Waren, Dienstleistungen und Personen ist die oberste, den nationalen Verfassungen übergestülpte Maxime. Die stetig anwachsende diesbezügliche EU-Gesetzgebung ist nicht demokratisch legitimiert. EU-Gesetzgeber ist die nicht gewählte, von über 10’000 Lobbyisten beeinflusste Exekutive.
- Ein großer Fehler war die Einführung einer gemeinsamen Währung in Österreich am 1. Jänner 2002. Alle EU-Länder ausser Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien, Schweden und Bulgarien (ab 1.1.2026) unterzogen sich der Einheitswährung. Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider (38) weist darauf hin, dass die Staaten mit dem Euro auf eine eigene Finanzhoheit (39) verzichten. Das bedeutet z.B., dass sie letzten Endes auf eine eigenständige Gesetzgebung für die Steuereinnahmen verzichten müssen (40). Damit hat der Staat «einen wesentlichen Teil seiner Souveränität aufgegeben».
- Der Lissabon-Vertrag, der 2009 in Kraft trat, bedeutet einen weiteren Verzicht der einzelnen europäischen Staaten auf ihre Souveränität (und auf ihre Rechtsstaatlichkeit) zugunsten einer bürgerfernen Herrschaft der EU-Institutionen. Die Selbstbestimmung der verfassten Nation, wie sie seit der Französischen Revolution und in der UN-Charta definiert ist, wurde Schritt für Schritt abgebaut, ein Vorgehen, das sich durch die gesamte Geschichte der EU zieht. (41) Zu den Neuerungen des Vertrags von Lissabon zählte die erstmalige Regelung eines EU-Austritts. (42) Einem austretenden Land wird die Möglichkeit geboten, sich ohne wenn und aber, ohne Nachzahlungen, ohne Forderungen aus der EU auszutreten. (43) Österreich könnte jederzeit ohne Vertrag aus der EU austreten und der EFTA wieder beitreten, so wie wir bis 1994 waren. Damit könnten wir mit allen EU-Staaten weiter Handel treiben, so wie es Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein ebenfalls erfolgreich tun.
- Per Notrecht werden Windparks und Photovoltaik-Anlagen in die Natur gepflastert. Spürbar sind auch die negativen Folgen der vor Jahrzehnten gestarteten EU-Raumentwicklungspolitik. Ziel war es, im Interesse der transnationalen Wirtschaft die Bevölkerung in grösseren Zentren entlang der europäischen Hauptverkehrsachsen zu konzentrieren. Während sich «Randgebiete» entvölkern, werden die Bodenpreise in den Zentren unerträglich.
- Die NATO-Kriegspropaganda entspricht dem, was man in der psychologischen Fachsprache als «Projektion» bezeichnet. Es gibt keinen einzigen Beleg dafür, dass Russland plant oder in der Lage ist, andere Länder zu erobern, um ein neues russisches Grossreich zu schaffen. Die weltweite Vorherrschaft hingegen ist seit der Kolonialzeit die (explizite wirtschaftliche und) aussenpolitische Strategie der USA und der EU-Länder, die in der NATO militärisch kooperieren. Die Nato hat sie auch in neuerer Zeit umgesetzt und völkerrechtswidrige Kriege in Jugoslawien, Afghanistan, im Irak und in Libyen geführt. Für ihre Strategie der weltweiten Vorherrschaft hat sie Millionen von Toten und einige auf Jahrzehnte hinaus zerstörte Länder in Kauf genommen. Der Völkerrechtler Prof. (Dr. iur. et phil.) Alfred de Zayas war (2012–2018) unabhängiger Uno-Experte für Internationale Ordnung. (Er ist Professor für internationales Recht an der Genfer Schule für Diplomatie und internationale Beziehungen in der Schweiz und Autor vieler Bücher, zuletzt «Building a Just World Order», Clarity Press, 2021.) Er sagt zur NATO: «In einem sehr realen Sinne hat sich die Nato seit 1999 zu einer «kriminellen Organisation» [im Sinne der Artikel 9 und 10 des Statuts des Nürnberger Militärgerichtshofs (Londoner Abkommen vom 8. August 1945) und des Nürnberger Urteils von 1946] entwickelt. Es gibt solide Berichte und wissenschaftliche Studien, die zuverlässig die traurige Tatsache dokumentieren, dass Nato-Streitkräfte Verbrechen gegen den Frieden […] begangen haben.» (44)
- Die Links-rechts-Polarisierung blockiert jegliche Veränderung. Dies ist die einzige Aufgabe, die dem Begriffspaar links-rechts in der Politik heute zukommt: Links gegen rechts ist zu einer leeren ideologischen Formel zur Ausgrenzung der Globalisierungskritiker geworden. Die westlichen Mainstream-Medien versuchen, die Stimmen, die die koloniale Lebensweise in Frage stellen, auszugrenzen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns Bürger in Diskussionen austauschen und aktiv bleiben: mit einem Leserbrief, mit einem Bürgergespräch mit den Nachbarn, mit einer Teilnahme an einer Demonstration oder mit einer Unterschrift für eine den Frieden unterstützenden Petition bzw. Volksbegehren. Oder ich kann Kindern eine Friedensgeschichte vorlesen. (45)
Länder der BRICS und der ASEAN arbeiten auf eine ähnliche Weise wie die EFTA, ohne politische Vereinigungsversuche, zusammen – mit Erfolg. «Europa» wird es sich nicht leisten können, seine Augen davor zu verschliessen. (46)
Um Verträge abzuschliessen, ist es nicht nötig, Machtpolitik so wie die EU zu betreiben. So ist es der EFTA in den letzten Jahren gelungen (– oft noch vor der EU –), rund um den Globus mit einer Vielzahl von Ländern massgeschneiderte Freihandelsverträge abzuschliessen.
Die Menschen leben als Teil eines Volkes in Nationen. Jede Nation verfügt über ihre eigene Kultur, die folgende Bereiche umfasst (47)
- die gesellschaftliche Ordnung und die sozialen Einrichtungen,
- Sitten und Gebräuche,
• Menschenbild, Religion, Kunst, Literatur, Technik und Wissenschaften
Ende 2024 finden nur mehr 60 Prozent, dass Österreich Mitglied in der EU bleiben sollte. (48)
Nach drei Jahrzehnten EU-Mitgliedschaft sehen sich
- 47 Prozent sowohl als „Österreicherinnen und Österreicher und Europäerinnen und Europäer“ und
- 5 Prozent „nur als Bürger Europas".
Aktuell herrscht im EU-Raum in den Medien die Kriegspropaganda vor. Politik und Militär arbeiten daran, die Mentalität der Bevölkerung den Kriegsszenarien anzupassen. So fordert der NATO-Generalsekretär Rutte im Dezember 2024 (49): «Es ist an der Zeit, eine Kriegsmentalität anzunehmen». Das Ziel der Humanität in unseren Kulturen erfährt durch solche Einflussversuche eine harte Prüfung.
Viele beobachten die Entwicklung besorgt. Die Menschheit will das Ziel der Humanität nicht aus den Augen verlieren und hat das auch klar formuliert. So ist in der UN-Charta (50) (in Kapitel I – Ziele und Grundsätze, Artikel 1, Ziffer 2) über die Ziele der Vereinten Nationen zu lesen:
- «freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu treffen;»
Fußnoten:
1 https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2024/nr-23-12-november-2024/vor-70-jahren-albert-schweitzer-haelt-seine-rede-zur-verleihung-des-friedensnobelpreises
2 Z.B. mit Francisco de Vitoria (1492–1546) und Francisco Suárez (1548–1617)
3 «Die Vorbereitungen dafür hatten schon zuvor begonnen, nun wurden entscheidende Weichen für die weiteren Beratungen gestellt, so dass schon am 26. Juni 1945 die Satzung der neuen Organisation, die Charta der Vereinten Nationen, ratifiziert und am 24. Oktober 1945 in Kraft treten konnte.» gemäß https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2025/nr-4-18-februar-2025/die-un-charta-sollte-die-rechtliche-grundlage-einer-multipolaren-welt-werden
4 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 2)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr3-vom-1712012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
5 René Roca, https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2025/nr-10-29-april-2025/schweiz
6 Kurt Bayer, Artikel «Die entstehende multipolare Unordnung der Welt-Finanzen» in International I/2024, 2024-1_International_KurtBayer_MultipolareWelt-Finanzen.pdf
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation_fC3%BCr_wirtschaftliche_Zusammenarbeit_und_Entwicklung
8 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 2)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr3-vom-1712012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
9 Andreas Wehr: «Die Europäische Union», PapyRossa
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Marshallplan
11 Werner Wüthrich, «Wirtschaft und direkte Demokratie in der Schweiz», Zeit-Fragen, Kap. 24/Seite 297, siehe auch https://dodis.ch/15113
12 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 1)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2011/nr-50-vom-12122011/die-methode-monnet-als-schluessel-zum-verstaendnis-der-euro-krise
13 https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-pioneers/jean-monnet_de und eu-pioneers-jean-monnet_de.pdf
14 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 1)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2011/nr-50-vom-12122011/die-methode-monnet-als-schluessel-zum-verstaendnis-der-euro-krise
15 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 2)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr3-vom-1712012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
16 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 2)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr3-vom-1712012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
17 Werner Wüthrich, «Wirtschaft und direkte Demokratie in der Schweiz», Zeit-Fragen, Kap. 24/Seite 297
18 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 2)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr3-vom-1712012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
19 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 2)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr3-vom-1712012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
20 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 3)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr5-vom-3012012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
21 Ewald Wetekamp, https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr1415-vom-342012/die-efta-eine-vitale-alternative-zur-eu und https://www.efta.int/
22 https://vintageasia.eu/en/blogs/news/wer-sind-die-asean-staaten-und-wofur-stehen-sie-politisch
23 https://books.openedition.org/igpde/3793
24 Mail vom 15.9.2025 10:43
25 Zeit-Fragen Nr. 38 vom 27.9.2010 und https://eu-austritt.blogspot.com/2015/04/eu-und-strippenzieher-jean-monnet-teil-1.html
26 https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2011/nr-25-vom-2062011/jean-monnet-als-sondergesandter-des-amerikanischen-praesidenten-roosevelt
27 https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-pioneers/jean-monnet_de und eu-pioneers-jean-monnet_de.pdf
28 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 3)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr5-vom-3012012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
29 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 1)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2011/nr-50-vom-12122011/die-methode-monnet-als-schluessel-zum-verstaendnis-der-euro-krise
30 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 2)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr3-vom-1712012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
31 Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 26.1.2012, zitiert in Andreas Wehr «Die europäische Union», PappyRossa
32 Vom 10.06.2020, https://www.fayard.fr/livre/jai-tire-sur-le-fil-du-mensonge-et-tout-est-venu-9782818506189/
33 Kapitel 21: Der Europarat , Seiten 633 bis 662 aus Jean Monnet: Erinnerungen eines Europäers, Carl Hanser Verlag, ISBN 3-446-12421-7, 1978, Titel der Originalausgabe: Mémoire, Edition Fayard, Paris 1976
34 Er spricht hier von Helmut Schmidt.
35 Rita Müller-Hill, https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2019/nr-10-23-april-2019/ich-habe-an-einem-faden-des-luegengespinstes-gezogen-und-es-ist-alles-ans-licht-gekommen
36 1943, https://hdgoe.at/moskauer-deklaration
37 https://de.wikipedia.org/wiki/Einheitliche_Europ%C3%A4ische_Akte
38 https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2021/nr-1213-1-juni-2021/es-ist-allein-das-geld-was-die-eu-noch-zusammenhaelt
39 https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2021/nr-1213-1-juni-2021/es-ist-allein-das-geld-was-die-eu-noch-zusammenhaelt
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/euro/countries-using-euro_de
40 Finanzhoheit: Befugnis zur autonomen Regelung der eigenen Finanzwirtschaft sowie zur Begrenzung der finanzwirtschaftlichen Rechte der übrigen Körperschaften. Finanzhoheit umfasst Gesetzgebungshoheit (Gesetzgebungskompetenz), Verwaltungshoheit und Steuerertragshoheit über öffentliche Einnahmen, bes. Steuereinnahmen. Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/finanzhoheit-35113
41 Zeit-Fragen Nr. 38 vom 27.9.2010 und https://eu-austritt.blogspot.com/2015/04/eu-und-strippenzieher-jean-monnet-teil-1.html
42 https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Lissabon
43 Dank Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider wurde erreicht, dass ein Austritt mit oder ohne Vertrag möglich ist:43 Im EU-Vertrag, Artikel 50, ist unter der 3. Ziffer folgender Text zu lesen: "Die Verträge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mitteilung keine Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu verlängern." Der springende Punkt ist das Wort «andernfalls»: Die sich der EU andienenden Juristen haben den Umstand offensichtlich so verschlungen formuliert, dass die Möglichkeit eines Ausstiegs ohne Vertrag verborgen bleiben sollte. Vermutlich fühlen sich EU-Verantwortliche gekränkt, wenn jemand auf die Idee eines Austritts kommt. Der Austritt Großbritanniens ist leider mit einem Vertrag erfolgt. Dieser Vertrag war für Grossbritannien ungünstig, da die leitenden Verhandler auf britischer Seite alles BREXIT-Gegner waren. Für Großbritannien wäre ein Austritt ohne Vertrag besser gewesen.
44 Offener Brief von Prof. Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas, https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2024/nr-15-23-juli-2024/glaubwuerdigkeit-als-friedensvermittler-wiederherstellen
45 Peter Mattmann-Allamand, https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2025/nr-12-27-mai-2025/weltweite-vorherrschaft-des-westens-die-linke-die-rechte-und-das-reaktionaere-eu-usa-nato-projekt-gefragt-waere-eine-oeko-soziale-kritik-der-kolonialen-lebensweise
46 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 3)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr5-vom-3012012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
47 https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2022/nr-34-8-februar-2022/der-mensch-als-schoepfer-und-geschoepf-der-kultur
48 https://www.meinbezirk.at/c-politik/nur-60-prozent-sehen-einen-mehrwert-in-der-eu_a7080937 Umfragen von Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE)
49 https://www.manova.news/artikel/die-militarisierung-der-gedanken
50 https://unric.org/de/charta/
51 Werner Wüthrich, «Europäische Integration (Teil 5)», https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr27-vom-2562012/das-europaeische-orchester-wieder-zum-klingen-bringen
Online-Flyer Nr. 853 vom 31.10.2025