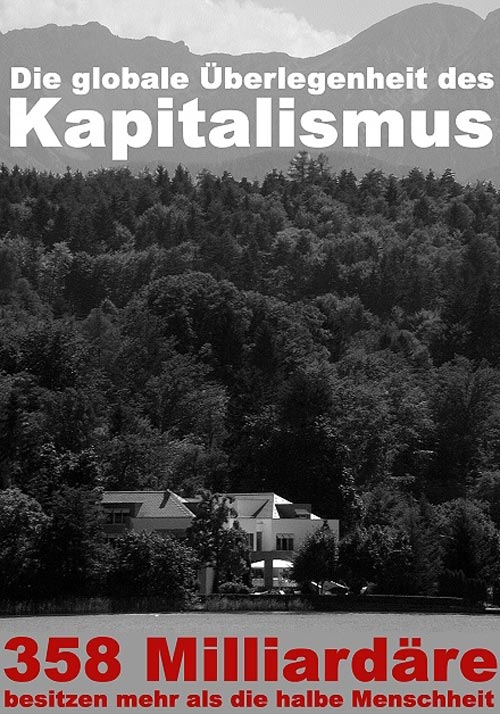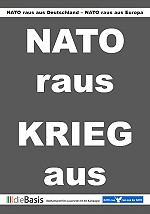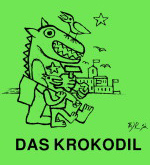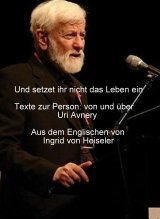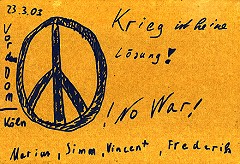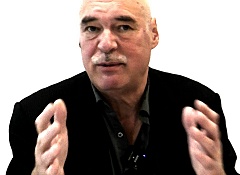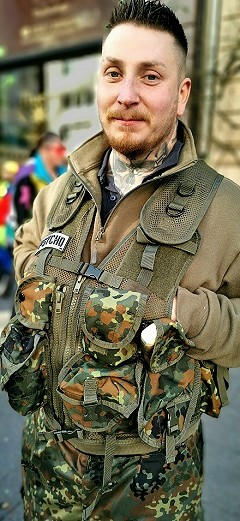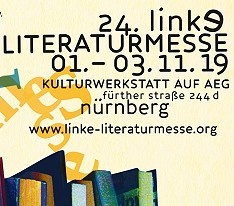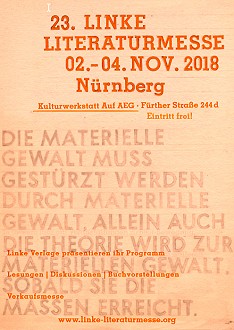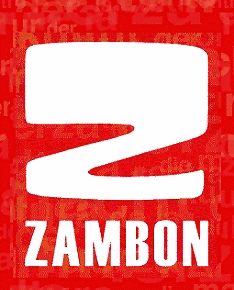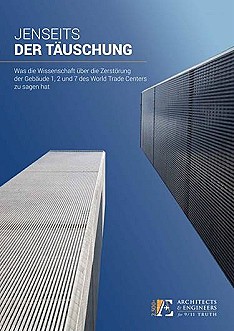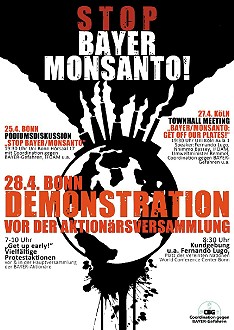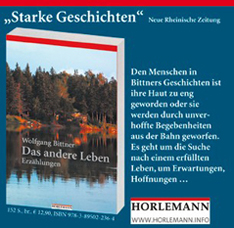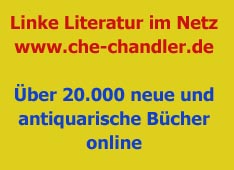SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Kultur und Wissen
„Asurot“ – ein Dokumentarfilm von Anat Even und Ada Ushpiz
Doppelt eingesperrt
Von Endy Hagen
Das hebräische Wort Asurot kann auf Frauen bezogen sowohl „eingesperrt“ als auch „verboten“ im Sinne von „unberührbar“ bedeuten. Beide Perspektiven nimmt der Film ein: Er zeigt die Auswirkung der Besatzung auf das Leben der PalästinenserInnen – und hier insbesondere die verfahrene Lage in Hebron – ebenso wie die Situation palästinensischer Frauen, die ihre Männer verloren haben.

Ein Blick aus dem Fenster
Die Besatzung – im Haus repräsentiert durch die israelischen Soldaten, die auf dem Dach des Hauses einen Beobachtungsposten eingerichtet haben – gibt dem Film wie dem Leben der Frauen einen Rahmen. „Asurot“ zeigt die Bedingungen, unter denen sie leben, die Ausgangssperre, in der beispielsweise selbst Arztbesuche der Kinder nicht möglich sind und Lebensmittel auf der palästinensischen Rückseite des Hauses durchs Fenster besorgt werden müssen. Er zeigt die Feiern jüdischer Siedler, die, unter den ungläubigen Augen der Palästinenser, von Soldaten geschützt an Purim den „Haman“[1] in der Gestalt einer mit Palästinenserschal geschmückten Arafat-Puppe symbolisch erschlagen. Die Kamera folgt den Blicken der Kinder durch die vergitterten Fenster auf die Straße zu den Soldaten und begleitet sie ins Treppenhaus, wo sie sich gegen die Wand drücken, wenn die Soldaten vorbeigehen. Ständig dringen die Soldaten in die Privatsphäre der Familien ein. Sie behandeln die Frauen und Kinder wie Luft. Schamlos urinieren sie aufs Dach, überall liegen ihre Patronenhülsen herum. Nur den ständigen Reinigungsarbeiten der drei Frauen ist zu verdanken, dass sich das Dach nicht in eine große Kloake verwandelt.
Doch eingeschlossen und bedrängt sind Siham, Nawal und Najwa nicht nur durch die Besatzung. Die Frauen haben ihre Männer, die alle aus der Familie Abu Minshar, stammten, durch Unfälle verloren.

Auf dem Dach
In konservativen Kreisen der palästinensischen Gesellschaft wird von einer verwitweten Frau erwartet, dass sie sich unauffällig kleidet, zu Hause bleibt und ihr Leben ihren Kindern widmet. Jede Abweichung bringt sie ins Gerede – in „engen“ Gesellschaften kann das schnell wie ein Todesurteil wirken. Heiratet eine Frau wieder, so in der Regel einen Witwer, dessen Kinder sie dann versorgen soll. Zugleich muss sie aber dann damit rechnen, ihre eigenen Kinder an die Familie ihres ersten Mannes zu verlieren. „Ich hasse das Wort ,Witwe’“, sagt Nawal. „Es stößt mich ab. Ich lehne es ab, dass man sagt, dass eine Frau ihren Wert verliert, wenn sie ihren Ehemann verliert.“ Gesteigert wird Nawals Frustration durch die Tatsache, dass ihre Söhne die traditionellen Auffassungen übernehmen und ihr gegenüber Machtallüren beginnen zu entwickeln. Siham, die schon in den Vierzigern ist, erlebt bereits, wie ihr erwachsener Sohn die Möbel umkippt, wenn sie das Essen nicht rechtzeitig fertig hat.
Über weite Strecken des Films bietet die Besatzung trotz ihrer allgegenwärtigen Präsenz nur die Folie, auf der sich Sihams, Nawals und Najwas Leben als Frauen und Witwen vor den ZuschauerInnen entfaltet. Dass dies die Regisseurinnen ursprünglich nicht beabsichtigt hatten, erzählte Anat Even in einem Gespräch mit arabischen Frauen in Israel: „Anfangs dachte ich, es sei nicht meine Sache, das aufzugreifen. Ich dachte, das sei Sache der palästinensischen Gesellschaft. Aber als die Frauen begannen, uns ihre Geschichte zu erzählen, war (…) klar, dass der Film auch von ihrer Rolle als Witwen in der palästinensischen Gesellschaft handeln würde. Auch aus ethischen Gründen... Vielleicht haben sie mit uns gerade deshalb gesprochen, weil sie innerhalb der palästinensischen Gesellschaft nicht sprechen können – nicht einmal untereinander. Die Angst sitzt tief. Die Gesellschaft hat sie ausgespuckt, und sie haben nichts zu verlieren.“ [2]

... wenn die Soldaten vorbeigehen ...
Die Stärke des Films liegt in seiner Glaubwürdigkeit. Anat Even und Ada Ushpiz haben ihre Protagonistinnen nicht zu Heldinnen stilisiert und jede Idealisierung vermieden. Es ist ihnen gelungen, ein Bild von der Komplexität der Charaktere wie der Situation zu entwickeln; sie lassen die ZuschauerInnen Stück für Stück in den Alltag der Frauen eintreten und ihre Lebensumstände nachvollziehen. So sieht man beispielsweise gleich zu Beginn, wie Najwa ihren aufgestauten Zorn an ihrem kleinen Sohn auslässt. Das findet man am Ende des Films nicht weniger erschütternd, dazwischen aber liegt eine tiefere Einsicht in weibliche Lebensrealitäten in Palästina.
Wer sich für die Auswirkungen der Besatzung auf die Lebenssituation palästinensischer Frauen interessiert, kommt an „Asurot“ nicht vorbei. (CH)
[1] Purim ist ein Fest, das an die Errettung des jüdischen Volkes aus drohender Gefahr in der persischen Diaspora erinnert. Nach dem Buch Ester versuchte Haman, der höchste Regierungsbeamte des persischen Königs, die gesamten Juden im Perserreich an einem Tag auszurotten.
[2] „A Prison Within“, Challenge, Ausgabe 102, März/April 2007
Online-Flyer Nr. 120 vom 07.11.2007
Druckversion
Kultur und Wissen
„Asurot“ – ein Dokumentarfilm von Anat Even und Ada Ushpiz
Doppelt eingesperrt
Von Endy Hagen
Das hebräische Wort Asurot kann auf Frauen bezogen sowohl „eingesperrt“ als auch „verboten“ im Sinne von „unberührbar“ bedeuten. Beide Perspektiven nimmt der Film ein: Er zeigt die Auswirkung der Besatzung auf das Leben der PalästinenserInnen – und hier insbesondere die verfahrene Lage in Hebron – ebenso wie die Situation palästinensischer Frauen, die ihre Männer verloren haben.

Ein Blick aus dem Fenster
Die Besatzung – im Haus repräsentiert durch die israelischen Soldaten, die auf dem Dach des Hauses einen Beobachtungsposten eingerichtet haben – gibt dem Film wie dem Leben der Frauen einen Rahmen. „Asurot“ zeigt die Bedingungen, unter denen sie leben, die Ausgangssperre, in der beispielsweise selbst Arztbesuche der Kinder nicht möglich sind und Lebensmittel auf der palästinensischen Rückseite des Hauses durchs Fenster besorgt werden müssen. Er zeigt die Feiern jüdischer Siedler, die, unter den ungläubigen Augen der Palästinenser, von Soldaten geschützt an Purim den „Haman“[1] in der Gestalt einer mit Palästinenserschal geschmückten Arafat-Puppe symbolisch erschlagen. Die Kamera folgt den Blicken der Kinder durch die vergitterten Fenster auf die Straße zu den Soldaten und begleitet sie ins Treppenhaus, wo sie sich gegen die Wand drücken, wenn die Soldaten vorbeigehen. Ständig dringen die Soldaten in die Privatsphäre der Familien ein. Sie behandeln die Frauen und Kinder wie Luft. Schamlos urinieren sie aufs Dach, überall liegen ihre Patronenhülsen herum. Nur den ständigen Reinigungsarbeiten der drei Frauen ist zu verdanken, dass sich das Dach nicht in eine große Kloake verwandelt.
Doch eingeschlossen und bedrängt sind Siham, Nawal und Najwa nicht nur durch die Besatzung. Die Frauen haben ihre Männer, die alle aus der Familie Abu Minshar, stammten, durch Unfälle verloren.

Auf dem Dach
In konservativen Kreisen der palästinensischen Gesellschaft wird von einer verwitweten Frau erwartet, dass sie sich unauffällig kleidet, zu Hause bleibt und ihr Leben ihren Kindern widmet. Jede Abweichung bringt sie ins Gerede – in „engen“ Gesellschaften kann das schnell wie ein Todesurteil wirken. Heiratet eine Frau wieder, so in der Regel einen Witwer, dessen Kinder sie dann versorgen soll. Zugleich muss sie aber dann damit rechnen, ihre eigenen Kinder an die Familie ihres ersten Mannes zu verlieren. „Ich hasse das Wort ,Witwe’“, sagt Nawal. „Es stößt mich ab. Ich lehne es ab, dass man sagt, dass eine Frau ihren Wert verliert, wenn sie ihren Ehemann verliert.“ Gesteigert wird Nawals Frustration durch die Tatsache, dass ihre Söhne die traditionellen Auffassungen übernehmen und ihr gegenüber Machtallüren beginnen zu entwickeln. Siham, die schon in den Vierzigern ist, erlebt bereits, wie ihr erwachsener Sohn die Möbel umkippt, wenn sie das Essen nicht rechtzeitig fertig hat.
Über weite Strecken des Films bietet die Besatzung trotz ihrer allgegenwärtigen Präsenz nur die Folie, auf der sich Sihams, Nawals und Najwas Leben als Frauen und Witwen vor den ZuschauerInnen entfaltet. Dass dies die Regisseurinnen ursprünglich nicht beabsichtigt hatten, erzählte Anat Even in einem Gespräch mit arabischen Frauen in Israel: „Anfangs dachte ich, es sei nicht meine Sache, das aufzugreifen. Ich dachte, das sei Sache der palästinensischen Gesellschaft. Aber als die Frauen begannen, uns ihre Geschichte zu erzählen, war (…) klar, dass der Film auch von ihrer Rolle als Witwen in der palästinensischen Gesellschaft handeln würde. Auch aus ethischen Gründen... Vielleicht haben sie mit uns gerade deshalb gesprochen, weil sie innerhalb der palästinensischen Gesellschaft nicht sprechen können – nicht einmal untereinander. Die Angst sitzt tief. Die Gesellschaft hat sie ausgespuckt, und sie haben nichts zu verlieren.“ [2]

... wenn die Soldaten vorbeigehen ...
Die Stärke des Films liegt in seiner Glaubwürdigkeit. Anat Even und Ada Ushpiz haben ihre Protagonistinnen nicht zu Heldinnen stilisiert und jede Idealisierung vermieden. Es ist ihnen gelungen, ein Bild von der Komplexität der Charaktere wie der Situation zu entwickeln; sie lassen die ZuschauerInnen Stück für Stück in den Alltag der Frauen eintreten und ihre Lebensumstände nachvollziehen. So sieht man beispielsweise gleich zu Beginn, wie Najwa ihren aufgestauten Zorn an ihrem kleinen Sohn auslässt. Das findet man am Ende des Films nicht weniger erschütternd, dazwischen aber liegt eine tiefere Einsicht in weibliche Lebensrealitäten in Palästina.
Wer sich für die Auswirkungen der Besatzung auf die Lebenssituation palästinensischer Frauen interessiert, kommt an „Asurot“ nicht vorbei. (CH)
[1] Purim ist ein Fest, das an die Errettung des jüdischen Volkes aus drohender Gefahr in der persischen Diaspora erinnert. Nach dem Buch Ester versuchte Haman, der höchste Regierungsbeamte des persischen Königs, die gesamten Juden im Perserreich an einem Tag auszurotten.
[2] „A Prison Within“, Challenge, Ausgabe 102, März/April 2007
Online-Flyer Nr. 120 vom 07.11.2007
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE