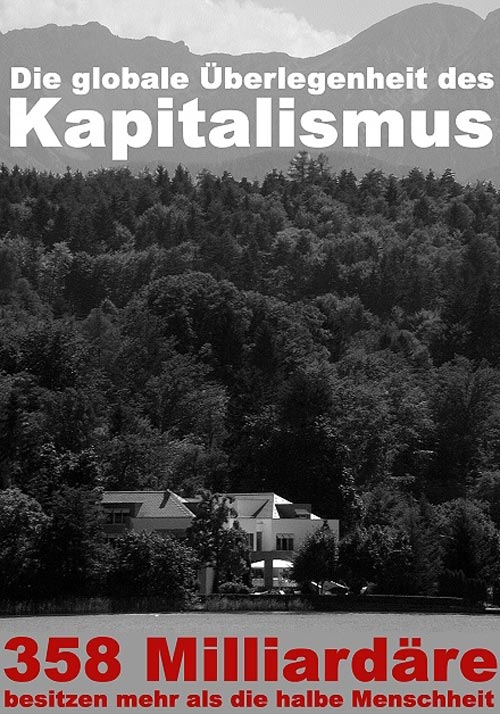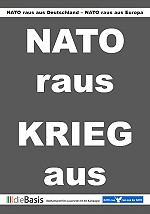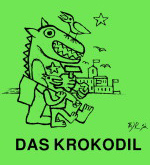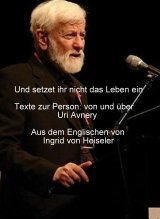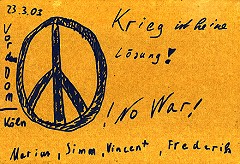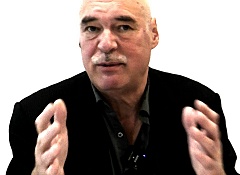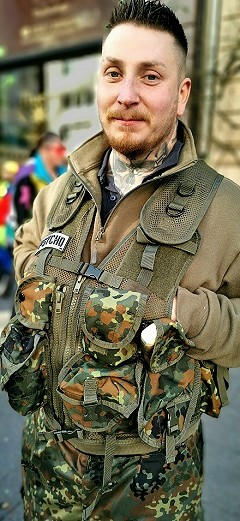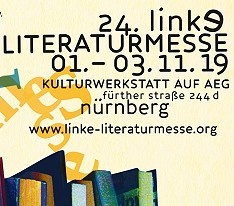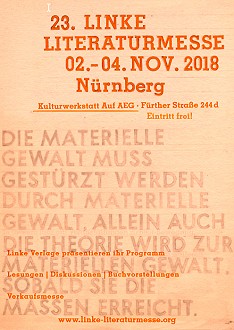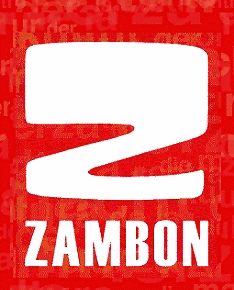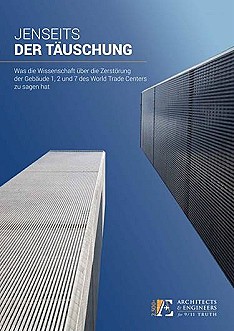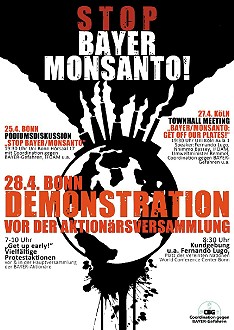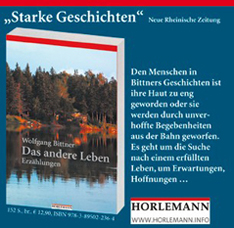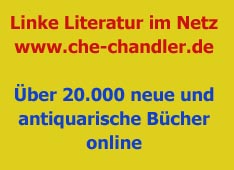SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Kultur und Wissen
Kinder- und Jugendliteratur als Prophylaxe - Teil 1
Lese-Kultur gegen Gewalt
Von Wolfgang Bittner
Der Stein des Sisyphos
»Ich glaube, dass dies das gewalttätigste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte war«, sagt der britische Schriftsteller und Nobelpreisträger William Golding über das 20. Jahrhundert. Der französische Ökologe René Dumont sieht es »nur als ein Jahrhundert der Massaker und Kriege«. Der britische Philosoph Isiah Berlin hält es für »das schrecklichste Jahrhundert in der Geschichte des Westens«. Und der Historiker Eberhard Jäckel nennt es unter Hinweis auf die beiden Weltkriege, den Faschismus und die Vernichtungsverbrechen sogar »das deutsche Jahrhundert«.
Sicher, man hat nach Aufklärung, industriellem und technischem Fortschritt kaum mehr mit diesem Rückfall in eine Barbarei, die mit dem Phänomen »Auschwitz« nicht hinreichend zu beschreiben ist, rechnen können. Aber das 20. Jahrhundert als besonders herausragend zu bezeichnen, was die Gewalt betrifft, erscheint mir doch etwas weitgehend. Wir stehen unserer unmittelbaren extremen Vergangenheit nur näher als den länger zurückliegenden Epochen, die absolut nicht friedlicher waren. Denken wir an Leibeigenschaft, Inquisition, Sklaverei und Kolonisation, an die zahlreichen Kriege, von denen die Geschichtsschreibung berichtet: Unterdrückungskriege, Freiheitskriege, Napoleonische Kriege, Unabhängigkeitskriege, Sezessionskrieg, Dreißigjähriger Krieg, Türken, Ungarn, Hunneneinfälle, Kreuzzüge, römische Imperialpolitik, Eroberungsfeldzüge der Perser, Mazedonier, Assyrer usw.
Jede Zeit hatte ihre Gräuel, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Summe allen Leidens auf dieser Welt über die Jahrhunderte gleich geblieben ist. Zwar hege ich die Hoffnung, dass es besser werde, gewaltfreier, friedvoller, humaner; aber ich sehe dafür momentan keine Anzeichen. Wir brauchen gar nicht nach Afrika, Südamerika, Afghanistan oder in den Irak zu schauen; seit dem Terroranschlag vom 11. September 2001 in New York und Washington, aber auch seit den Morden in Erfurt vom 26. April 2002, als ein 19-jähriger Schüler sechzehn Menschen erschoss, wissen wir, dass Gewalt ständig und überall gegenwärtig ist, dass sie - immer noch - jederzeit auch uns treffen kann. Nur die Formen der Gewalt verändern sich von Zeit zu Zeit.
Dennoch sind wir aufgefordert, ihr zu begegnen, wo es nur geht. Das ist eine unserer Aufgaben, die uns als Menschen, als sich fortentwickelnden geistigen Wesen, gestellt sind. Es ist sozusagen der Stein des Sisyphos, den wir immer wieder bergauf zu wälzen haben, so schwer es auch fällt. Diese Erkenntnis hat hier und da auch Eingang in die Literatur gefunden.
Die Gewaltproblematik in der Literatur
Seit jeher beschäftigen sich Schriftsteller - mehr oder weniger zentral - mit der Gewaltproblematik. Als Beispiele aus der Antike mögen Homers »Odyssee« und »Ilias« sowie Sophokles´ »Antigone« genügen. Im mitteleuropäischen Raum angesiedelt sind später das Nibelungenlied oder der Simplicissimus. Auch bei den Klassikern spielt die Gewaltproblematik eine wesentliche Rolle. Zu nennen sind beispielshalber Schillers »Räuber« und »Wilhelm Tell«, Goethes »Egmont« und »Götz von Berlichingen«, Kleists »Michael Kohlhaas«, Lessings »Nathan der Weise«, Shakespeares Königsdramen. Die Liste lässt sich - freilich sehr unvollständig - weiterführen mit Büchners »Woyzeck« und »Dantons Tod«, Dostojewskis »Schuld und Sühne«, Fontanes »Effi Briest«, Hauptmanns »Weber«, Kafkas »Prozess«, Werfels »Musa Dagh«, Brechts »Mutter Courage«, Orwells »1984«, Hemingways »Wem die Stunde schlägt«, Dürrenmatts »Versprechen« und »Besuch der alten Dame«, Bölls »Ansichten eines Clowns«, Grass´ »Im Krebsgang«.

Wolfgang Bittner: "Gewalt begegnen, wo es nur geht"
Foto: Archiv W. Bittner
In diesen Werken geht es häufig um absolute, unverhüllte Gewalt, nicht selten aber auch um Formen indirekter, nicht gleich als solcher erkennbarer Gewalt. Mit struktureller Gewalt haben wir es dagegen bei Fontanes »Effi Briest« oder Dürrenmatts »Besuch der Alten Dame« zu tun, mit institutioneller Gewalt in Kleist »Kohlhaas«, Hauptmanns »Weber« oder Kafkas »Prozess«.
Auch in der gegenwärtigen Kinder- und Jugendliteratur finden wir zahlreiche Beispiele von Jorge Amado bis Arnulf Zitelmann. Ganz abgesehen von den immer noch lesenswerten und aktuellen Klassikern auf diesem Gebiet: Friedrich Gerstäcker, B. Traven, Jack London oder Robert Louis Stevenson. Natürlich gibt es auch viel Schund, Kitsch und Kram. Aber der ist rasch herausgefunden und aussortiert.
Gewaltbegriff und Ursachen der Gewalt
Im täglichen Leben werden wir ständig mit den unterschiedlichsten Formen direkter und indirekter Gewalt konfrontiert. Ob auf der Straße, beim Autofahren, im Betrieb, auf dem Schulhof, in der Bahn oder sogar in der Familie: überall begegnet uns - mehr oder weniger - Gewalt. Ein Betrunkener pöbelt Passanten an, im Park ist jemand überfallen worden, der Vorgesetzte schikaniert die Sekretärin, zwei Schüler nehmen einem anderen die Mütze weg, ein Vater prügelt... Jeder hat ein Gefühl dafür, was Gewalt ist. Sofort fallen uns hundert weitere Beispiele dafür ein. Aber eine Definition zu geben, ist nicht einfach. Liegt denn Gewalt vor, wenn jemand ein Auto zerkratzt oder seine Aggressionen an einer Straßenlaterne auslässt? Ist das Gewalt, wenn jemand Schutzgelder kassiert oder wenn sich Kinder auf dem Schulhof anspucken?
Im Strafrecht ist Gewalt ein Zwangsmittel zur Einwirkung auf das Verhalten anderer. Es wird also auf die Willensfreiheit eines anderen Menschen Einfluss genommen. Das kann sowohl durch physische Kraft geschehen, als auch durch Betäubung beispielsweise mit Narkotika, durch Hypnose oder durch psychische Einwirkung. Darunter fallen Straftatbestände wie Raub, Entführung, Erpressung und Nötigung. Jemand schlägt einen anderen, bemächtigt sich seiner oder droht ihm, um ihn zu einer bestimmten Handlung beziehungsweise Unterlassung zu zwingen. Dagegen geht das Strafrecht bei Delikten wie Mord, Körperverletzung und Sachbeschädigung vom Ergebnis aus; das heißt jemand wird getötet, verletzt oder eine Sache wird beschädigt beziehungsweise zerstört.
Suchen wir nun nach einer allgemein gültigen Definition für Gewalt, müssen wir den Begriff über das Strafrecht hinaus vom Sprachgebrauch im täglichen Leben her entwickeln. Danach ist Gewalt jede Kraft- oder Machteinwirkung auf Menschen oder Sachen, und zwar in negativer Weise. Es ist ein Unterschied, ob ein Schüler einen Gleichaltrigen unflätig beschimpft (Beleidigung, Zankerei) oder der Lehrer einen Schüler (Gewalt in Form negativer Machteinwirkung). Es ist auch nicht dasselbe, ob ein Mitschüler einem anderen die Mütze wegnimmt (Rangelei, Schabernack) oder ob das ein aggressiver älterer Schüler tut (Gewalt). Ganz eindeutig liegt natürlich Gewalt vor, wenn einer den anderen erpresst oder zusammenschlägt oder jemand das Mobiliar demoliert.
Glaubt man der Statistik, hat eine so definierte Gewalt unter Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren stetig zugenommen. Das trifft nicht nur auf die USA oder Russland zu, sondern auch auf mitteleuropäische Länder wie Deutschland oder Österreich. Wir fragen uns natürlich, woran das liegt. Ausgehend von der Annahme, dass der Mensch a priori weder gut noch böse ist, vielmehr unterschiedliche Anlagen in sich trägt, gewinnen die gesellschaftlichen Bedingungen für seine Entwicklung ausschlaggebende Bedeutung und Erziehung stellt ein unerlässliches Regulativ dar. Unter diesen Voraussetzungen sind vor allem vier Faktoren für das Anwachsen von Gewalt festzustellen: Erstens die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft, zweitens die Einengung gesellschaftlichen Bewusstseins auf materielle Werte und damit einhergehend eine deutliche Ignoranz gegenüber Kultur, drittens die negativen Vorbilder in den Medien, viertens ein nicht befriedigter Abenteuerdrang.
Dem Beitrag liegt ein Vortrag von Wolfgang Bittner zugrunde. Eine Sammlung mit Essays und Vorträgen des Autors erscheint im April unter dem Titel "Schreiben, Lesen, Reisen" im Athena-Verlag in Oberhausen. Siehe auch das Interview mit dem Autor in dieser Ausgabe.
Online-Flyer Nr. 33 vom 28.02.2006
Druckversion
Kultur und Wissen
Kinder- und Jugendliteratur als Prophylaxe - Teil 1
Lese-Kultur gegen Gewalt
Von Wolfgang Bittner
Der Stein des Sisyphos
»Ich glaube, dass dies das gewalttätigste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte war«, sagt der britische Schriftsteller und Nobelpreisträger William Golding über das 20. Jahrhundert. Der französische Ökologe René Dumont sieht es »nur als ein Jahrhundert der Massaker und Kriege«. Der britische Philosoph Isiah Berlin hält es für »das schrecklichste Jahrhundert in der Geschichte des Westens«. Und der Historiker Eberhard Jäckel nennt es unter Hinweis auf die beiden Weltkriege, den Faschismus und die Vernichtungsverbrechen sogar »das deutsche Jahrhundert«.
Sicher, man hat nach Aufklärung, industriellem und technischem Fortschritt kaum mehr mit diesem Rückfall in eine Barbarei, die mit dem Phänomen »Auschwitz« nicht hinreichend zu beschreiben ist, rechnen können. Aber das 20. Jahrhundert als besonders herausragend zu bezeichnen, was die Gewalt betrifft, erscheint mir doch etwas weitgehend. Wir stehen unserer unmittelbaren extremen Vergangenheit nur näher als den länger zurückliegenden Epochen, die absolut nicht friedlicher waren. Denken wir an Leibeigenschaft, Inquisition, Sklaverei und Kolonisation, an die zahlreichen Kriege, von denen die Geschichtsschreibung berichtet: Unterdrückungskriege, Freiheitskriege, Napoleonische Kriege, Unabhängigkeitskriege, Sezessionskrieg, Dreißigjähriger Krieg, Türken, Ungarn, Hunneneinfälle, Kreuzzüge, römische Imperialpolitik, Eroberungsfeldzüge der Perser, Mazedonier, Assyrer usw.
Jede Zeit hatte ihre Gräuel, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Summe allen Leidens auf dieser Welt über die Jahrhunderte gleich geblieben ist. Zwar hege ich die Hoffnung, dass es besser werde, gewaltfreier, friedvoller, humaner; aber ich sehe dafür momentan keine Anzeichen. Wir brauchen gar nicht nach Afrika, Südamerika, Afghanistan oder in den Irak zu schauen; seit dem Terroranschlag vom 11. September 2001 in New York und Washington, aber auch seit den Morden in Erfurt vom 26. April 2002, als ein 19-jähriger Schüler sechzehn Menschen erschoss, wissen wir, dass Gewalt ständig und überall gegenwärtig ist, dass sie - immer noch - jederzeit auch uns treffen kann. Nur die Formen der Gewalt verändern sich von Zeit zu Zeit.
Dennoch sind wir aufgefordert, ihr zu begegnen, wo es nur geht. Das ist eine unserer Aufgaben, die uns als Menschen, als sich fortentwickelnden geistigen Wesen, gestellt sind. Es ist sozusagen der Stein des Sisyphos, den wir immer wieder bergauf zu wälzen haben, so schwer es auch fällt. Diese Erkenntnis hat hier und da auch Eingang in die Literatur gefunden.
Die Gewaltproblematik in der Literatur
Seit jeher beschäftigen sich Schriftsteller - mehr oder weniger zentral - mit der Gewaltproblematik. Als Beispiele aus der Antike mögen Homers »Odyssee« und »Ilias« sowie Sophokles´ »Antigone« genügen. Im mitteleuropäischen Raum angesiedelt sind später das Nibelungenlied oder der Simplicissimus. Auch bei den Klassikern spielt die Gewaltproblematik eine wesentliche Rolle. Zu nennen sind beispielshalber Schillers »Räuber« und »Wilhelm Tell«, Goethes »Egmont« und »Götz von Berlichingen«, Kleists »Michael Kohlhaas«, Lessings »Nathan der Weise«, Shakespeares Königsdramen. Die Liste lässt sich - freilich sehr unvollständig - weiterführen mit Büchners »Woyzeck« und »Dantons Tod«, Dostojewskis »Schuld und Sühne«, Fontanes »Effi Briest«, Hauptmanns »Weber«, Kafkas »Prozess«, Werfels »Musa Dagh«, Brechts »Mutter Courage«, Orwells »1984«, Hemingways »Wem die Stunde schlägt«, Dürrenmatts »Versprechen« und »Besuch der alten Dame«, Bölls »Ansichten eines Clowns«, Grass´ »Im Krebsgang«.

Wolfgang Bittner: "Gewalt begegnen, wo es nur geht"
Foto: Archiv W. Bittner
In diesen Werken geht es häufig um absolute, unverhüllte Gewalt, nicht selten aber auch um Formen indirekter, nicht gleich als solcher erkennbarer Gewalt. Mit struktureller Gewalt haben wir es dagegen bei Fontanes »Effi Briest« oder Dürrenmatts »Besuch der Alten Dame« zu tun, mit institutioneller Gewalt in Kleist »Kohlhaas«, Hauptmanns »Weber« oder Kafkas »Prozess«.
Auch in der gegenwärtigen Kinder- und Jugendliteratur finden wir zahlreiche Beispiele von Jorge Amado bis Arnulf Zitelmann. Ganz abgesehen von den immer noch lesenswerten und aktuellen Klassikern auf diesem Gebiet: Friedrich Gerstäcker, B. Traven, Jack London oder Robert Louis Stevenson. Natürlich gibt es auch viel Schund, Kitsch und Kram. Aber der ist rasch herausgefunden und aussortiert.
Gewaltbegriff und Ursachen der Gewalt
Im täglichen Leben werden wir ständig mit den unterschiedlichsten Formen direkter und indirekter Gewalt konfrontiert. Ob auf der Straße, beim Autofahren, im Betrieb, auf dem Schulhof, in der Bahn oder sogar in der Familie: überall begegnet uns - mehr oder weniger - Gewalt. Ein Betrunkener pöbelt Passanten an, im Park ist jemand überfallen worden, der Vorgesetzte schikaniert die Sekretärin, zwei Schüler nehmen einem anderen die Mütze weg, ein Vater prügelt... Jeder hat ein Gefühl dafür, was Gewalt ist. Sofort fallen uns hundert weitere Beispiele dafür ein. Aber eine Definition zu geben, ist nicht einfach. Liegt denn Gewalt vor, wenn jemand ein Auto zerkratzt oder seine Aggressionen an einer Straßenlaterne auslässt? Ist das Gewalt, wenn jemand Schutzgelder kassiert oder wenn sich Kinder auf dem Schulhof anspucken?
Im Strafrecht ist Gewalt ein Zwangsmittel zur Einwirkung auf das Verhalten anderer. Es wird also auf die Willensfreiheit eines anderen Menschen Einfluss genommen. Das kann sowohl durch physische Kraft geschehen, als auch durch Betäubung beispielsweise mit Narkotika, durch Hypnose oder durch psychische Einwirkung. Darunter fallen Straftatbestände wie Raub, Entführung, Erpressung und Nötigung. Jemand schlägt einen anderen, bemächtigt sich seiner oder droht ihm, um ihn zu einer bestimmten Handlung beziehungsweise Unterlassung zu zwingen. Dagegen geht das Strafrecht bei Delikten wie Mord, Körperverletzung und Sachbeschädigung vom Ergebnis aus; das heißt jemand wird getötet, verletzt oder eine Sache wird beschädigt beziehungsweise zerstört.
Suchen wir nun nach einer allgemein gültigen Definition für Gewalt, müssen wir den Begriff über das Strafrecht hinaus vom Sprachgebrauch im täglichen Leben her entwickeln. Danach ist Gewalt jede Kraft- oder Machteinwirkung auf Menschen oder Sachen, und zwar in negativer Weise. Es ist ein Unterschied, ob ein Schüler einen Gleichaltrigen unflätig beschimpft (Beleidigung, Zankerei) oder der Lehrer einen Schüler (Gewalt in Form negativer Machteinwirkung). Es ist auch nicht dasselbe, ob ein Mitschüler einem anderen die Mütze wegnimmt (Rangelei, Schabernack) oder ob das ein aggressiver älterer Schüler tut (Gewalt). Ganz eindeutig liegt natürlich Gewalt vor, wenn einer den anderen erpresst oder zusammenschlägt oder jemand das Mobiliar demoliert.
Glaubt man der Statistik, hat eine so definierte Gewalt unter Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren stetig zugenommen. Das trifft nicht nur auf die USA oder Russland zu, sondern auch auf mitteleuropäische Länder wie Deutschland oder Österreich. Wir fragen uns natürlich, woran das liegt. Ausgehend von der Annahme, dass der Mensch a priori weder gut noch böse ist, vielmehr unterschiedliche Anlagen in sich trägt, gewinnen die gesellschaftlichen Bedingungen für seine Entwicklung ausschlaggebende Bedeutung und Erziehung stellt ein unerlässliches Regulativ dar. Unter diesen Voraussetzungen sind vor allem vier Faktoren für das Anwachsen von Gewalt festzustellen: Erstens die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft, zweitens die Einengung gesellschaftlichen Bewusstseins auf materielle Werte und damit einhergehend eine deutliche Ignoranz gegenüber Kultur, drittens die negativen Vorbilder in den Medien, viertens ein nicht befriedigter Abenteuerdrang.
Dem Beitrag liegt ein Vortrag von Wolfgang Bittner zugrunde. Eine Sammlung mit Essays und Vorträgen des Autors erscheint im April unter dem Titel "Schreiben, Lesen, Reisen" im Athena-Verlag in Oberhausen. Siehe auch das Interview mit dem Autor in dieser Ausgabe.
Online-Flyer Nr. 33 vom 28.02.2006
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE