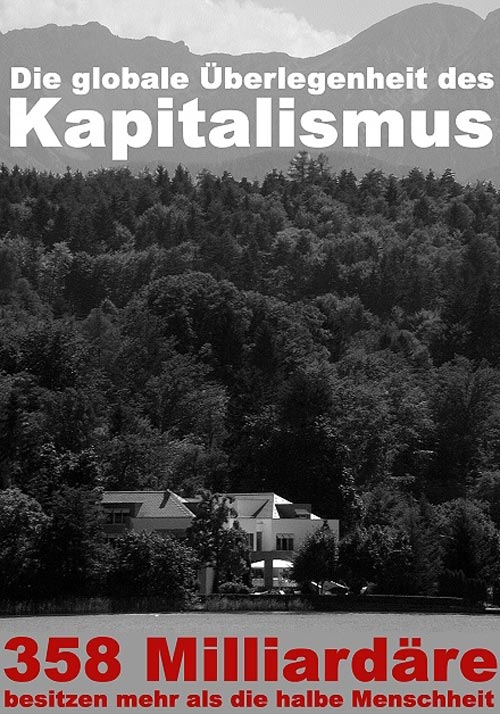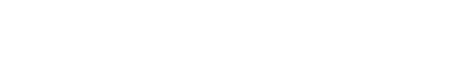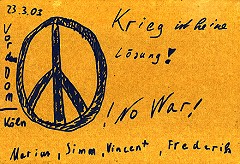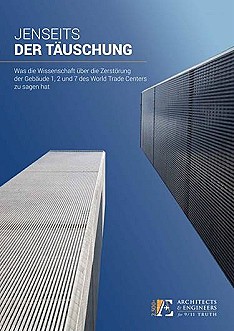SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Globales
Barack Obama – Eine Hoffnung? Eine Chance?
Eine Aufforderung!
Von George und Doris Pumphrey
Barack Obamas Wahl am 20. Januar 2009 war war ein historischer Durchbruch. An den seit drei Monaten regierenden 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten knüpfen sich viele Erwartungen aber auch ebenso viele Illusionen und Fragen, denen unsere AutorInnen nachgehen. – Die Redaktion

Cartoon: Kostas Koufogiorgos
Einige sehen Obamas Wahl als Sieg über den Rassismus, andere sehen in Obama die Fortsetzung der Politik Bill Clintons mit einem schwarzen Gesicht. Beide Positionen treffen zu - aber nur als Momentaufnahmen. Sie können uns nicht helfen, die weitere Entwicklung seiner Präsidentschaft zu verstehen. Eine eindeutige Analyse seiner Präsidentschaft ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Wir können hier nur versuchen mit einigen Überlegungen zur Analyse des Phänomens Obama beizutragen.
> Die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten ist zunächst einmal ein Sieg über den Rassismus in den USA, deren gesamte Geschichte und Gesellschaft vom Rassismus gegen Schwarze geprägt sind.
> Obama wurde gewählt gegen den Willen und Plan seiner Partei, die auf Hillary Clinton gesetzt hatte.
> Obamas Wahl ist ein Meilenstein in der US-amerikanischen Geschichte. Ob sie ein Meilenstein für die Weltgeschichte wird, wird sich erst noch zeigen.
Ein Impuls für den antirassistischen Kampf
Obamas Wahlsieg bedeutet nicht, dass der Rassismus in den USA überwunden ist. Sein Wahlsieg bekräftigt den jahrhundertelangen Kampf gegen den Rassismus und kann ihm neue Impulse geben.
Auch wenn der Unterschied nicht am Gesicht zu sehen ist: es ist für viele weiße US-Amerikaner heute immer noch leichter einen US-Amerikaner zur wählen, dessen Vater afrikanischer Immigrant war, als einen Afroamerikaner, der von schwarzen Sklaven abstammt. Ein Nachkomme von Sklaven erinnert zu sehr an die Bürde der Schuld, die die USA mit sich herumtragen durch die Sklaverei, die Segregation, die jahrhundertelange und fortdauernde rassistische Diskriminierung.
Die Wahl eines schwarzen Präsidenten ist einerseits ein Sieg über den Rassismus, kann andererseits aber noch mehr Schwierigkeiten für Schwarze bringen, wenn damit nun behauptet wird, es gäbe keinen Rassismus mehr. Dass das Gegenteil der Fall ist, wird durch jede neue Statistik bewiesen.
Während seines Kampfes für die Nominierung als demokratischer Präsidentschaftskandidat, vermied Obama jede Erwähnung von Rasse und Rassendiskriminierung – wenn er von der Gegenseite nicht dazu gezwungen wurde. Das brachte ihm viel Kritik ein von Seiten der Schwarzen, die die Rassendiskriminierung täglich erleben.
Obama war anfänglich nicht der Kandidat der Mehrheit der Schwarzen. Sie setzten entweder auf linkere Kandidaten oder auf Hillary Clinton, denn sie konnten sich nicht vorstellen, dass ein Schwarzer US-Präsident werden könnte. Als sich echte Chancen für Obama abzeichneten, stellte sich die schwarze Gemeinde fast geschlossen hinter ihn. Wie sein Sieg von den Schwarzen empfunden wurde, konnte man dann auch an den Bildern von der Inaugurationsfeier am Capitol in Washington sehen, eine Feier, die gespickt war mit Symbolen aus dem Bürgerrechtskampf. Wer mit diesem Kampf nicht eng verbunden war, wird das Bewegende des Augenblicks und die Tränen nur schwer nachvollziehen können
Man muss sich aber auch vor der Illusion hüten, dass ein schwarzer Präsident automatisch eine Politik machen wird, die sich gegen Unterdrückung richtet, nur weil Schwarze schon so lange unterdrückt werden. Condoleezza Rice und Colin Powell sind ja schon ein Beispiel dafür, dass mit dem sichtbaren Anwachsen der schwarzen Bourgeoisie, die Zugehörigkeit zur Klasse eine größere Rolle spielt als die Identifizierung als Angehöriger einer Minderheit, die gegen ihre rassistische Unterdrückung kämpft. Dies gilt besonders für ein Land, in der die Linke sehr schwach ist.
Obama hat aus Wirtschafts- und Finanzkreisen mehr finanzielle Unterstützung erhalten als alle anderen Kandidaten. Ein Schwarzer, der, wie z.B. Jesse Jackson, aus der Anti-Rassismus Bewegung kommt und diese repräsentiert, hätte natürlich niemals die finanzielle Unterstützung erhalten gerade von den Kräften, die von der Ungleichheit und Unterdrückung profitieren.
Der Demokratische Parteiapparat wollte Hillary
Obama war nicht der Wunschkandidat der Demokraten. Der mächtige demokratische Parteiapparat hatte auf Hillary Clinton gesetzt. Hillary bedeutete die Fortsetzung der Politik ihres Präsidentenmannes Bill Clinton aber auch in vieler Beziehung eine Fortsetzung der Politik von George Bush. Sie ist eine Vertreterin der Politik, die seit Jahrzehnten in Washington mit relativ unbedeutenden Unterschieden vertreten wird, egal ob von einem Republikanischen oder Demokratischen Präsidenten im Weißen Haus.
Um die Nominierung seiner Partei zu gewinnen, schufen Obama und sein Team eine Massenbewegung von zumeist jungen Leuten. Diese Bewegung gruppierte sich allerdings nicht um ein Programm, sondern um die Person Obama, der den ersehnten Wandel verkörperte und durch seine große Redekunst und Ausstrahlung schnell zur Ikone wurde. Was Obama sagte, war fortschrittlich genug, um den Enthusiasmus von Millionen von US-Bürgern zu wecken, die sich nach den langen Bush-Jahren nach einem Wandel sehnten. Obama sprach die Probleme der Menschen an, die sich vor Arbeitslosigkeit, Armut und Obdachlosigkeit fürchten oder diese schon erleben. Und er versprach ein Ende des Irakkrieges, von dem inzwischen viele amerikanische Familien persönlich betroffen sind. Obama war für die Mehrheit glaubwürdiger als Hillary Clinton. Er hatte im Unterschied zu Hillary nicht nur gegen den Krieg gestimmt. Er kannte auch aus seiner eigenen Erfahrung als Organisator einer sozial engagierten kirchlichen Gruppe im Ghetto und später als Bürgerrechts-Anwalt die Probleme der Armut.
Nachdem er die demokratische Kandidatur gewonnen hatte, musste er wohl einen Deal mit der Führung seiner Partei eingehen, um ihre volle Rückendeckung im Kampf gegen McCain zu bekommen. Dies wurde offensichtlich in der Auswahl seiner Berater. Der demokratische Parteiapparat stülpte ihm sozusagen ein Kabinett über, dessen Mehrheit bereits in der Clinton-Regierung die Fäden zog.
Obama nahm seine schärfste Rivalin Hillary Clinton zur Außenministerin, sicherlich um sie einzubinden und sie davon abzuhalten gegen ihn zu intrigieren. Vielleicht auch weil sie – als starke eigenständige Politikerin – eventuell für außenpolitische Fehlschläge zumindest mitverantwortlich gemacht werden kann.
Hoffen auf Obamas Wirtschaftswunder
Während seiner Kampagne hatte Obama das Hauptgewicht auf sozialstaatliche Maßnahmen gelegt, die er als Präsident ergreifen wollte. Er versprach weitgehende Maßnahmen einzuleiten, die die dringlichsten Probleme von Millionen US-Bürgern lindern helfen, wie Gesundheitsfürsorge und Sozialversicherung für alle, Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit.
Die aktuelle kapitalistische Wirtschaftskrise wurde durch die immensen Schulden der USA ausgelöst, die unter Bush noch zugenommen hatten. Billige Kredite wurden den Menschen geradezu aufgedrängt. Das hatte für Millionen US-Amerikaner katastrophale Auswirkungen z.B. auf ihre Wohnsituation. Millionen, die sich auf Grund der leicht zugänglichen Kredite Wohnungen oder Häuser kauften, konnten diese schließlich nicht mehr abbezahlen. Die Banken übernahmen die Häuser. Nun stehen diese zwar meist leer, aber da es kaum Sozialwohnungen gibt, wurden viele obdachlos. Ein neues Phänomen breitet sich mit zunehmender Geschwindigkeit aus: Zeltstätte und Pappkartonhäuser, in denen ganze Familien hausen. Sie erinnern an die Favelas in Südamerika oder die Shanty Towns in Südafrika. Das Nationale Zentrum für Familienobdachlosigkeit veröffentlichte vor ein paar Wochen den neuesten Bericht: 1,5 Millionen Kinder sind gegenwärtig in den USA obdachlos. Das sind eins von 50 Kindern, die auf der Straße, in Zelten oder Pappkartons leben. (http://www.familyhomelessness.org/?q=node/23)
In dieser Wirtschaftskrise mit dem drastischen Zusammenbruch von Unternehmen und den wachsenden Schlangen vor den Arbeitsämtern, ist es kein Wunder, dass viele auf den “Change“, den Wandel hoffen, den Obama versprach.
Präsident Obamas Priorität ist die wirtschaftliche und finanzielle Situation. Hier legte er ein besonderes Tempo vor. Doch seine Mittel gleichen denen seines Vorgängers, mit dem Unterschied, dass die Schulden schneller wachsen werden. Mit dem vorgelegten Staatshaushalt werden sich die Staatsschulden noch mal verdoppeln. (siehe dazu Rainer Rupp junge Welt 12.02.2009 http://www.jungewelt.de/2009/02-12/044.php?sstr=)

Cartoon: Kostas Koufogiorgos
Trotzdem wird Obama, der den Wandel versprach, die Militärausgaben drastisch erhöhen. Die gesamten Militärausgaben werden um ein Drittel erhöht, von 534 Milliarden auf 739 Milliarden Dollar. Diese US-Militärausgaben dienen bekanntlich nicht der Sicherheit der USA, denn wer sollte schon die USA militärisch angreifen. Sie dienen den US-Aggressionen gegen andere Länder. Bei den Staatsschulden und wirtschaftlichen Problemen, könnte man gerade von Obama erwarten, dass er ein wirkliches Zeichen für den notwendigen Wandel setzt und als erstes die Militärausgaben wesentlich reduziert.
Guantanamo, Atomwaffen, Irak, Afghanistan…
Die Signale, die bis jetzt von der Regierung Obama kommen, sind sehr widersprüchlich. Sein erster Akt als Präsident war die Unterzeichnung des Befehls zur Schließung von Guantanamo. Er will auch die Bezeichnung “feindlicher Kombattant“ abschaffen. Beides deutet auf den versprochenen Wandel. Gleichzeitig aber weigert sich seine Regierung die Willkür zu beenden, die mit der Bezeichnung “feindlicher Kombattant“ verbunden ist, ebenso wie die unbegrenzte Inhaftierung ohne Anklage und Gerichtsverfahren. Außerdem belässt er die Aufsicht über die Gefangenen, solange Guantanamo noch existiert, in den Händen des Militärs. Was aus den zahlreichen Geheimgefängnissen der CIA werden soll, ist nicht bekannt. Die Bezeichnung hat sich geändert aber nicht die Praxis. Oder könnte es sein, dass der gute Wille da ist, aber nicht der Mut, ihn gegen mächtige Interessen durchzusetzen?
Vor einigen Wochen verkündete Obama in Prag, dass die USA nun „Frieden und Sicherheit in einer Welt ohne Atomwaffen“ anstreben werden. Diese Ankündigung wurde weltweit als großartiger Schritt gefeiert. Vergessen wird nur, dass fast alle US-Präsidenten vor ihm Ähnliches angekündigt hatten. Obama fügte ja auch gleich hinzu, dass dieses Ziel nicht schnell erreicht werden wird, „vielleicht nicht einmal zu meinen Lebzeiten.“
Obama kündigte z.B. ein neues Abkommen mit Russland über die Verringerung der strategischen Atomwaffen an. Das war aber mit dem Auslaufen des “START-I-Abkommens“ am Ende dieses Jahres sowieso schon vereinbart. Die von ihm angekündigten Obergrenzen werden auch weiterhin so hoch sein, dass sie jeden Gegner zerstören können. Er will auch nicht auf den amerikanischen Raketen-Abwehrschirm verzichten, der den USA die Erstschlagskapazität gegen Russland ermöglichen soll. Die anderen Ankündigungen haben offensichtlich zum Ziel, Atomwaffen potentieller Gegner zu verhindern. (Siehe hierzu Knut Mellenthin junge Welt 09.04.2009 http://www.jungewelt.de/2009/02-12/044.php?sstr=)
Barack Obama verdankt seinen Einzug ins Weiße Haus auch seiner Opposition zum Irakkrieg. Damit befand er sich auf der Seite der großen Mehrheit der US-Amerikaner, denn fast zwei Drittel von ihnen sehen inzwischen diesen Krieg als Fehler und Desaster.
Im Wahlkampf versprach Obama den schnellen Abzug der Truppen aus Irak. Als Präsident verkündete er, dass der Abzug in kleineren Schritten als versprochen und erst Ende 2011 vollzogen werden soll. ABER: bis zu 50.000 Soldaten sollen im Irak auf unbestimmte Zeit stationiert bleiben. UND: anstelle von Anerkennung der Schuld der USA gegenüber der irakischen Bevölkerung mit ihren inzwischen auf über eine Million geschätzten zivilen Todesopfern (http://www.justforeignpolicy.org/iraq/iraqdeaths.html), lobte Obama die Soldaten, denn sie hätten ihren Auftrag erfüllt, Saddam Husseins Regierung gestürzt und beim Aufbau einer neuen Regierung geholfen. Erinnern wir uns, das war nicht der Vorwand, der für den Angriff auf Irak diente, sondern die angeblichen Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins.
Nach Afghanistan will Obama noch mehr Truppen schicken (und fordert von den Alliierten größeres Engagement) und er fördert die Ausweitung des Krieges nach Pakistan.
Gleichzeitig scheint sich aber auch bei Obama die Einsicht durchzusetzen, dass der Afghanistan-Konflikt mit Militär allein nicht zu lösen ist. So kündigte er einen Strategiewechsel an: Er will mit den “gemäßigten Taliban verhandeln”. Wie im besetzten Irak unter Bush, hofft Obama wohl auch, in Afghanistan die Besatzungsgegner gegeneinander auszuspielen. Viele bezweifeln jedoch jetzt schon, dass das in Afghanistan gelingen kann.
Obama und Israel: Widersprüchliche Signale
Der Nahe Osten ist ein zentrales Problem nicht nur auf internationaler Ebene. Das Verhältnis der USA zu Israel ist von besonderer Bedeutung und Brisanz auch für die politischen Verhältnisse in den USA selbst. Wie sich Obama letztlich dazu verhalten, wie seine Beziehung zur mächtigen Israel-Lobby sein wird, ist noch nicht eindeutig.
Die Signale sind widersprüchlich. Zum einen ernannte er George Mitchell, einen sehr erfahrenen und respektierten, auch arabisch sprechenden Vermittler zum Sonderbeauftragten für den Nahen Osten. Für die Beziehungen mit dem Iran aber wählte er den Erz-Zionisten Dennis Ross.
Nach seiner Nominierung als demokratischer Präsidentschaftskandidat war seine erste Handlung der Auftritt vor dem Kongress des zionistischen American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) um Israel seine ungeteilte Loyalität zu bekräftigen. AIPAC ist heute die wichtigste Lobby in den USA und alle, die in Washington eine große Rolle spielen wollen, müssen vor dieser Lobby antreten und Israel Treue schwören.
Die Bedeutung, das Ausmaß und der Einfluss der Israel-Lobby auf die Politik in Washington wird in der US-Öffentlichkeit immer breiter und lauter diskutiert, vor allem seitdem die beiden profilierten Universitätsprofessoren und politischen Berater Stephan Walt und John Mearsheimer die Mechanismen der Machtausübung dieser Lobby aufgezeigt haben. (http://www.arendt-art.de/deutsch/palestina/israellobby.htm)
Die Israel-Lobby, zu der übrigens auch rechtsgerichtete fundamentalistische Christen gehören, hat in den letzten Jahren systematisch entscheidenden Einfluss auf die Regierungspolitik gewonnen. Viele der wichtigsten Amtsträger in Washington seit der zweiten Regierung Clinton waren und sind Zionisten, deren Hauptziel darin besteht, die Interessen der israelischen Regierung durchzusetzen.
Eine große Anzahl von Kandidaten und Abgeordneten im US Kongress erhalten finanzielle Zuwendungen und Wahlhilfe von der Israel-Lobby. Dies geht aus regelmäßig veröffentlichten Statistiken des Washington Report on Middle East Affairs hervor. (http://www.wrmea.com/) Es ist bekannt, dass die Lobby ihnen sogar Reden liefert. Kongressabgeordnete, die es wagen, die Politik Israels zu hinterfragen oder gar zu kritisieren, haben kaum eine Chance Washington politisch zu überleben. In Israel und in den USA ist die Redewendung weit verbreitet, Israels wichtigstes besetztes Gebiet sei der US-Kongress.
Als in 2001 Shimon Peres sich in einer Kabinettssitzung über mögliche Reaktionen der USA auf Israels Aktionen Sorgen machte, antwortete Premierminister Ariel Sharon: „Sorgen Sie sich nicht über Amerikanischen Druck auf Israel. Wir, die Juden, kontrollieren Amerika, und Amerika weiß das.“ (http://www.wrmea.com/html/newsitem_s.htm) Mit „Juden“ meinte er natürlich die zionistische Lobby. Die US-Regierung hat über diese Aussage keine Erklärung eingefordert.
Obamas erste Personalentscheidung war die Ernennung des Erz-Zionisten Rahm Emanuel zum Stabschef im Weißen Haus. Obamas Vizepräsident Biden ist stolzer Zionist. „Ich bin Zionist”, erklärte er, „denn man muss kein Jude sein, um Zionist zu sein.“ (http://www.youtube.com/watch?v=yAZmO80dLfE)
Im März sollte der ehemalige US-Botschafter in Saudi Arabien und Nahostspezialist, Charles Freeman, die Koordination der geheimdienstlichen Analysen übernehmen. Freeman gilt als sehr erfahrener Spezialist. Unter ihm hätte die geheimdienstliche Analyse ihre eigentliche Rolle gespielt, nämlich objektive Lageberichte zu liefern, als Grundlage für Regierungsentscheidungen. Das wollte die Israel-Lobby unter allen Umständen verhindern und organisierte eine derart verleumderische Kampagne gegen Freeman, dass er schließlich seine Kandidatur zurückzog. Obama hatte sich nicht für Charles Freeman eingesetzt.
Nach Informationen der israelischen Zeitung Ha’aretz bereitet Obama Kongressabgeordnete auf eine mögliche Konfrontation zwischen seiner Regierung und der von Netanjahu über die Zweistaatenlösung vor. Dieses Vorgehen ist neu und „soll verhindern, dass Netanjahu die Regierung umgeht und im Kongress Unterstützung organisiert.“ (http://www.haaretz.com/hasen/spages/1077222.html) Der israelische Außenminister Avigdor Lieberman ist sich jedoch sicher, dass die US-Regierung nichts gegen die Wünsche Israels tun wird. „Glauben Sie mir, Amerika akzeptiert all unsere Entscheidungen” erklärte er vor wenigen Tagen der russischen Tageszeitung Moskovskiy Komosolets. (http://www.haaretz.com/hasen/spages/1080195.html)
Obama hat direkte Gespräche mit Teheran angekündigt, will Iran das Recht auf Nukleartechnologie zugestehen und zumindest für die Zeit der Gespräche ebenso die Urananreicherung. Es wird sich zeigen, wie stark der Einfluss der Israel-Lobby sein wird, diese Gespräche zu torpedieren. Denn Israel ist gegen Gespräche mit Iran und drängt die USA schon lange zu einem Militärschlag gegen das Land. US-Verteidigungsminister Gates erteilte Israels Drängen nach einem Militärschlag gegen Iran aber eine deutliche Absage. Es scheint zumindest, dass – im Gegensatz zur Bush-Regierung – die neue US-Administration Israel keine "carte blanche“ mehr gewährt.
Die US-Politik der letzten Jahre hatte die gesamte muslimische Welt gegen die USA aufgebracht und deren Wirtschaftsinteressen erheblich geschadet. Die Person Obama, seine Herkunft, Hautfarbe und sein Name sind unter den gegenwärtigen Bedingungen ideal für den US-Imperialismus, der eine Verbesserung der Beziehung zu den muslimischen Ländern benötigt, um die eigene Rohstoffversorgung nachhaltiger zu sichern als durch die Kriege der Bush-Regierung. Die „Öffnung zur muslimischen Welt“, die Obama ankündigte und die bei seinem Besuch in der Türkei gefeiert wurde, zeigt diese Neuorientierung. Die Türkei und Iran spielen eine strategische Schlüsselrolle in der auch von Obama offensichtlich verfolgten Isolierung Russlands und in der Sicherung der US-Energieversorgung.
Die Bush-Regierung hinterlässt ein schweres Erbe
Regierungspolitik kann mit einem Hochseetanker verglichen werden. Er braucht seine Zeit um in Fahrt zu kommen und wenn er mal in Fahrt ist, dann braucht er Zeit um seinen Kurs zu ändern, auch wenn die Katastrophe am Horizont erscheint. Und Regierungspolitik ist natürlich der Ausdruck der realen Machtverhältnisse.
Obama wurde nicht in ein Vakuum gewählt. Seine Amtszeit folgt auf 8 Jahre reaktionärster Politik. Der Regierung von George W. Bush ging die reaktionäre Politik von Clinton, Bush Sr, Reagan und dessen Vorgängern voraus. In der Konkurrenz zwischen dem zivilen und dem Rüstungssektor der Wirtschaft, gewann der Militär-Industrielle Komplex seit mehreren Jahrzehnten immer mehr die Oberhand in der Regierungspolitik Washingtons.
In seiner Abschiedsrede als US-Präsident im Januar 1961 warnte Dwight D. Eisenhower vor der wachsenden Macht des Militär-Industriellen Komplexes und seinem destruktiven Einfluss auf die Demokratie. (http://www.youtube.com/watch?v=8y06NSBBRtY) John F. Kennedy war der erste – und letzte – Präsident, der es wagte, sich ernsthaft mit dem Militär-Industriellen Komplex anzulegen. Mit dem Ergebnis, das wir alle kennen.
Der Militär-Industrielle Komplex hat inzwischen nicht nur die gesamte Gesellschaft militarisiert und den Sicherheitsstaat geschaffen. Für die US-Außenpolitik benötigt er permanent den äußeren Feind. Nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten, nach dem Wegfall der "kommunistischen Gefahr“, wird die Gefahr eines "Internationalen Terrorismus“ beschworen. Unter Obama könnte es nun auch die Piraterie werden, die medienwirksam bereits zum drängenden internationalen Problem aufgeblasen und zusammengelogen wird.
Während der zwei Amtszeiten von George W. Bush wurde unter dem Vorwand des "Kampfes gegen den Terrorismus“ die US-Verfassung ausgehöhlt, um einer arbiträren Machtausübung Platz zu schaffen. Die US-Regierung setzte sich über alle internationalen Normen hinweg. Wie weit reichend, zeigen auch die geheimen Folterprotokolle, die vor kurzem enthüllt wurden.
Die Bush-Regierung hinterließ ein Land, das gleich mehrere Aggressionskriege führt, innenpolitisch und außenpolitisch erheblich an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat und in einer tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise steckt.
"Wandel“ – welcher Wandel?
Die Folgen dieser Politik erbt Obama. Aber können wir von Obama erwarten, dass er den Kurs des Hochseetankers grundsätzlich ändert?
Nicht nur hat Obama ein größeres intellektuelles Potential als viele seiner Vorgänger, er hat auch eine Lebenserfahrung wie kein anderer Präsident vor ihm und wie sicherlich auch kein anderes Mitglied seines Kabinetts. Er war in Welten, die den anderen völlig fremd sind. Und im Gegensatz zu anderen Präsidenten vor ihm, war Obama in seiner eigenen Entwicklung mit linker Politik in Berührung gekommen. Er frequentierte linke, fortschrittliche Kreise und hatte entsprechende Freunde. Aber Obama selbst war und ist kein Linker und er ist sicherlich kein Antiimperialist.
Obama könnte der Rettungsanker werden für wichtige Teile der in Bedrängnis geratenen US-amerikanischen Bourgeoisie. Es wäre auch vorstellbar, dass Teile der Bourgeoisie seine Fähigkeiten schon früh erkannten und halfen, ihn als Kandidaten für die Präsidentschaft aufzubauen. Die US-Politik steht vor einem Scherbenhaufen – innenpolitisch und außenpolitisch – hervorgerufen durch das langjährige Diktat des Militär-Industriellen Komplexes. Die Aggressionskriege haben die eigenen Möglichkeiten überspannt, die Probleme verschärft und den US-Wirtschaftsinteressen geschadet. Der US-Imperialismus muss seine Kräfte neu ordnen und orientieren, um im stärker werdenden Konkurrenzkampf um die Ressourcen der Welt zu bestehen. Obama ist hierfür der richtige Mann.
In seiner Antrittsrede legte er großes Gewicht auf die globale Führungsrolle der USA. Die Bush-Regierung hatte durch ihre Alleingänge und Brutalo-Politik die Europäischen Verbündeten verprellt und jenen Kräften Auftrieb gegeben, die eine größere Unabhängigkeit der EU von den USA anstreben. Dies trifft übrigens besonders auf die Bundesrepublik zu, die inzwischen stärker von der Energiezufuhr aus Russland abhängig ist, als es den USA recht sein kann. Obama will das ändern und die Europäer wieder stärker an die USA binden.
Barack Obama steht für die Teile der US-Bourgeoisie, die nicht allein auf Militärmacht setzen, die zur Durchsetzung ihrer Interessen eher Kooperation statt Konfrontation suchen, eher Handelsbeziehungen statt den Krieg. Deswegen spielt die Diplomatie unter Obama wieder eine größere Rolle.
Diese soll auch helfen, das Verhältnis zu Lateinamerika zu stärken, denn mit dem wachsenden Einfluss linker Regierungen droht den USA ihr sicher geglaubter "Hinterhof“ Lateinamerika zu entgleiten. Das Verhältnis zu Kuba wird hier eine entscheidende Rolle spielen. Der "Wandel“ von dem Obama so gerne spricht, könnte hier ganz konkret bedeuten "Wandel durch Annäherung“, oder im Klartext: Erdrückung durch Umarmung.
Die Linke Bewegung ist gefordert
Obama erklärte am Abend seiner Wahl: „Dieser Sieg allein ist nicht der Wandel, den wir erstreben – aber er gibt uns die Möglichkeit einen Wandel zu erreichen.“ Das müssen die Friedensbewegung, die sozialen Bewegungen, die Gewerkschaften und die linken Kräfte als Herausforderung annehmen, um den Wandel in unserem Sinne einzufordern: für die Interessen der Völker, die unter dem US-Imperialismus leiden, und für die Interessen der arbeitenden und arbeitslosen US-Bevölkerung, der Obdachslosen, der Menschen ohne Gesundheitsfürsorge, der vielen, die unter dem Rassismus und dem Unrecht in den USA leiden.
Von Präsident Franklin D. Roosevelt wird berichtet, er habe in den 30er Jahren die Gewerkschaften aufgerufen ihn zu zwingen, das zu tun, was er tun möchte. Wenn sich die progressiven Kräfte tatsächlich einen grundsätzlichen Wandel der Innen- und Außenpolitik der USA erhoffen, wenn sie hoffen, dass er bereit sein könnte, dies auch im Zweifelsfall gegen die mächtigen wirtschaftlichen und militärischen Interessen zu tun, dann könnte er dies nur mit der Macht im Rücken, die von der Straße kommt, aus den Betrieben, aus den Universitäten und Schulen.
Die linken Kräfte müssen die Herausforderung der Obama-Präsidentschaft annehmen und nutzen, um ein günstigeres Klima zu schaffen, größeres Gehör zu finden und um stärker Fuß zu fassen in der US-Gesellschaft.
Unabhängig davon, wie sich eine Regierung in einem kapitalistischen Staat zusammensetzt, eines bleibt grundsätzlich für die Linke – egal ob in den USA, Europa oder anderswo. Es wird immer auf sie ankommen, auf ihre Stärke und ihre Mobilisierungsfähigkeit von breiten Massen, um genug Druck zu organisieren, um gegen die Interessen des Kapitals eine sozial gerechte und eine Friedenspolitik durchzusetzen. (PK)
George Pumphrey (geboren in den USA) und Doris Pumphrey (geboren in
der BRD) waren in der Bürgerrechtsbewegung und bei den Black Panthern
und sind seit vielen Jahren in Frankreich und später in der
Bundesrepublik im anti-rassistischen und Friedenskampf engagiert.
Online-Flyer Nr. 195 vom 29.04.2009
Druckversion
Globales
Barack Obama – Eine Hoffnung? Eine Chance?
Eine Aufforderung!
Von George und Doris Pumphrey
Barack Obamas Wahl am 20. Januar 2009 war war ein historischer Durchbruch. An den seit drei Monaten regierenden 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten knüpfen sich viele Erwartungen aber auch ebenso viele Illusionen und Fragen, denen unsere AutorInnen nachgehen. – Die Redaktion

Cartoon: Kostas Koufogiorgos
Einige sehen Obamas Wahl als Sieg über den Rassismus, andere sehen in Obama die Fortsetzung der Politik Bill Clintons mit einem schwarzen Gesicht. Beide Positionen treffen zu - aber nur als Momentaufnahmen. Sie können uns nicht helfen, die weitere Entwicklung seiner Präsidentschaft zu verstehen. Eine eindeutige Analyse seiner Präsidentschaft ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Wir können hier nur versuchen mit einigen Überlegungen zur Analyse des Phänomens Obama beizutragen.
> Die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten ist zunächst einmal ein Sieg über den Rassismus in den USA, deren gesamte Geschichte und Gesellschaft vom Rassismus gegen Schwarze geprägt sind.
> Obama wurde gewählt gegen den Willen und Plan seiner Partei, die auf Hillary Clinton gesetzt hatte.
> Obamas Wahl ist ein Meilenstein in der US-amerikanischen Geschichte. Ob sie ein Meilenstein für die Weltgeschichte wird, wird sich erst noch zeigen.
Ein Impuls für den antirassistischen Kampf
Obamas Wahlsieg bedeutet nicht, dass der Rassismus in den USA überwunden ist. Sein Wahlsieg bekräftigt den jahrhundertelangen Kampf gegen den Rassismus und kann ihm neue Impulse geben.
Auch wenn der Unterschied nicht am Gesicht zu sehen ist: es ist für viele weiße US-Amerikaner heute immer noch leichter einen US-Amerikaner zur wählen, dessen Vater afrikanischer Immigrant war, als einen Afroamerikaner, der von schwarzen Sklaven abstammt. Ein Nachkomme von Sklaven erinnert zu sehr an die Bürde der Schuld, die die USA mit sich herumtragen durch die Sklaverei, die Segregation, die jahrhundertelange und fortdauernde rassistische Diskriminierung.
Die Wahl eines schwarzen Präsidenten ist einerseits ein Sieg über den Rassismus, kann andererseits aber noch mehr Schwierigkeiten für Schwarze bringen, wenn damit nun behauptet wird, es gäbe keinen Rassismus mehr. Dass das Gegenteil der Fall ist, wird durch jede neue Statistik bewiesen.
Während seines Kampfes für die Nominierung als demokratischer Präsidentschaftskandidat, vermied Obama jede Erwähnung von Rasse und Rassendiskriminierung – wenn er von der Gegenseite nicht dazu gezwungen wurde. Das brachte ihm viel Kritik ein von Seiten der Schwarzen, die die Rassendiskriminierung täglich erleben.
Obama war anfänglich nicht der Kandidat der Mehrheit der Schwarzen. Sie setzten entweder auf linkere Kandidaten oder auf Hillary Clinton, denn sie konnten sich nicht vorstellen, dass ein Schwarzer US-Präsident werden könnte. Als sich echte Chancen für Obama abzeichneten, stellte sich die schwarze Gemeinde fast geschlossen hinter ihn. Wie sein Sieg von den Schwarzen empfunden wurde, konnte man dann auch an den Bildern von der Inaugurationsfeier am Capitol in Washington sehen, eine Feier, die gespickt war mit Symbolen aus dem Bürgerrechtskampf. Wer mit diesem Kampf nicht eng verbunden war, wird das Bewegende des Augenblicks und die Tränen nur schwer nachvollziehen können
Man muss sich aber auch vor der Illusion hüten, dass ein schwarzer Präsident automatisch eine Politik machen wird, die sich gegen Unterdrückung richtet, nur weil Schwarze schon so lange unterdrückt werden. Condoleezza Rice und Colin Powell sind ja schon ein Beispiel dafür, dass mit dem sichtbaren Anwachsen der schwarzen Bourgeoisie, die Zugehörigkeit zur Klasse eine größere Rolle spielt als die Identifizierung als Angehöriger einer Minderheit, die gegen ihre rassistische Unterdrückung kämpft. Dies gilt besonders für ein Land, in der die Linke sehr schwach ist.
Obama hat aus Wirtschafts- und Finanzkreisen mehr finanzielle Unterstützung erhalten als alle anderen Kandidaten. Ein Schwarzer, der, wie z.B. Jesse Jackson, aus der Anti-Rassismus Bewegung kommt und diese repräsentiert, hätte natürlich niemals die finanzielle Unterstützung erhalten gerade von den Kräften, die von der Ungleichheit und Unterdrückung profitieren.
Der Demokratische Parteiapparat wollte Hillary
Obama war nicht der Wunschkandidat der Demokraten. Der mächtige demokratische Parteiapparat hatte auf Hillary Clinton gesetzt. Hillary bedeutete die Fortsetzung der Politik ihres Präsidentenmannes Bill Clinton aber auch in vieler Beziehung eine Fortsetzung der Politik von George Bush. Sie ist eine Vertreterin der Politik, die seit Jahrzehnten in Washington mit relativ unbedeutenden Unterschieden vertreten wird, egal ob von einem Republikanischen oder Demokratischen Präsidenten im Weißen Haus.
Um die Nominierung seiner Partei zu gewinnen, schufen Obama und sein Team eine Massenbewegung von zumeist jungen Leuten. Diese Bewegung gruppierte sich allerdings nicht um ein Programm, sondern um die Person Obama, der den ersehnten Wandel verkörperte und durch seine große Redekunst und Ausstrahlung schnell zur Ikone wurde. Was Obama sagte, war fortschrittlich genug, um den Enthusiasmus von Millionen von US-Bürgern zu wecken, die sich nach den langen Bush-Jahren nach einem Wandel sehnten. Obama sprach die Probleme der Menschen an, die sich vor Arbeitslosigkeit, Armut und Obdachlosigkeit fürchten oder diese schon erleben. Und er versprach ein Ende des Irakkrieges, von dem inzwischen viele amerikanische Familien persönlich betroffen sind. Obama war für die Mehrheit glaubwürdiger als Hillary Clinton. Er hatte im Unterschied zu Hillary nicht nur gegen den Krieg gestimmt. Er kannte auch aus seiner eigenen Erfahrung als Organisator einer sozial engagierten kirchlichen Gruppe im Ghetto und später als Bürgerrechts-Anwalt die Probleme der Armut.
Nachdem er die demokratische Kandidatur gewonnen hatte, musste er wohl einen Deal mit der Führung seiner Partei eingehen, um ihre volle Rückendeckung im Kampf gegen McCain zu bekommen. Dies wurde offensichtlich in der Auswahl seiner Berater. Der demokratische Parteiapparat stülpte ihm sozusagen ein Kabinett über, dessen Mehrheit bereits in der Clinton-Regierung die Fäden zog.
Obama nahm seine schärfste Rivalin Hillary Clinton zur Außenministerin, sicherlich um sie einzubinden und sie davon abzuhalten gegen ihn zu intrigieren. Vielleicht auch weil sie – als starke eigenständige Politikerin – eventuell für außenpolitische Fehlschläge zumindest mitverantwortlich gemacht werden kann.
Hoffen auf Obamas Wirtschaftswunder
Während seiner Kampagne hatte Obama das Hauptgewicht auf sozialstaatliche Maßnahmen gelegt, die er als Präsident ergreifen wollte. Er versprach weitgehende Maßnahmen einzuleiten, die die dringlichsten Probleme von Millionen US-Bürgern lindern helfen, wie Gesundheitsfürsorge und Sozialversicherung für alle, Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit.
Die aktuelle kapitalistische Wirtschaftskrise wurde durch die immensen Schulden der USA ausgelöst, die unter Bush noch zugenommen hatten. Billige Kredite wurden den Menschen geradezu aufgedrängt. Das hatte für Millionen US-Amerikaner katastrophale Auswirkungen z.B. auf ihre Wohnsituation. Millionen, die sich auf Grund der leicht zugänglichen Kredite Wohnungen oder Häuser kauften, konnten diese schließlich nicht mehr abbezahlen. Die Banken übernahmen die Häuser. Nun stehen diese zwar meist leer, aber da es kaum Sozialwohnungen gibt, wurden viele obdachlos. Ein neues Phänomen breitet sich mit zunehmender Geschwindigkeit aus: Zeltstätte und Pappkartonhäuser, in denen ganze Familien hausen. Sie erinnern an die Favelas in Südamerika oder die Shanty Towns in Südafrika. Das Nationale Zentrum für Familienobdachlosigkeit veröffentlichte vor ein paar Wochen den neuesten Bericht: 1,5 Millionen Kinder sind gegenwärtig in den USA obdachlos. Das sind eins von 50 Kindern, die auf der Straße, in Zelten oder Pappkartons leben. (http://www.familyhomelessness.org/?q=node/23)
In dieser Wirtschaftskrise mit dem drastischen Zusammenbruch von Unternehmen und den wachsenden Schlangen vor den Arbeitsämtern, ist es kein Wunder, dass viele auf den “Change“, den Wandel hoffen, den Obama versprach.
Präsident Obamas Priorität ist die wirtschaftliche und finanzielle Situation. Hier legte er ein besonderes Tempo vor. Doch seine Mittel gleichen denen seines Vorgängers, mit dem Unterschied, dass die Schulden schneller wachsen werden. Mit dem vorgelegten Staatshaushalt werden sich die Staatsschulden noch mal verdoppeln. (siehe dazu Rainer Rupp junge Welt 12.02.2009 http://www.jungewelt.de/2009/02-12/044.php?sstr=)

Cartoon: Kostas Koufogiorgos
Trotzdem wird Obama, der den Wandel versprach, die Militärausgaben drastisch erhöhen. Die gesamten Militärausgaben werden um ein Drittel erhöht, von 534 Milliarden auf 739 Milliarden Dollar. Diese US-Militärausgaben dienen bekanntlich nicht der Sicherheit der USA, denn wer sollte schon die USA militärisch angreifen. Sie dienen den US-Aggressionen gegen andere Länder. Bei den Staatsschulden und wirtschaftlichen Problemen, könnte man gerade von Obama erwarten, dass er ein wirkliches Zeichen für den notwendigen Wandel setzt und als erstes die Militärausgaben wesentlich reduziert.
Guantanamo, Atomwaffen, Irak, Afghanistan…
Die Signale, die bis jetzt von der Regierung Obama kommen, sind sehr widersprüchlich. Sein erster Akt als Präsident war die Unterzeichnung des Befehls zur Schließung von Guantanamo. Er will auch die Bezeichnung “feindlicher Kombattant“ abschaffen. Beides deutet auf den versprochenen Wandel. Gleichzeitig aber weigert sich seine Regierung die Willkür zu beenden, die mit der Bezeichnung “feindlicher Kombattant“ verbunden ist, ebenso wie die unbegrenzte Inhaftierung ohne Anklage und Gerichtsverfahren. Außerdem belässt er die Aufsicht über die Gefangenen, solange Guantanamo noch existiert, in den Händen des Militärs. Was aus den zahlreichen Geheimgefängnissen der CIA werden soll, ist nicht bekannt. Die Bezeichnung hat sich geändert aber nicht die Praxis. Oder könnte es sein, dass der gute Wille da ist, aber nicht der Mut, ihn gegen mächtige Interessen durchzusetzen?
Vor einigen Wochen verkündete Obama in Prag, dass die USA nun „Frieden und Sicherheit in einer Welt ohne Atomwaffen“ anstreben werden. Diese Ankündigung wurde weltweit als großartiger Schritt gefeiert. Vergessen wird nur, dass fast alle US-Präsidenten vor ihm Ähnliches angekündigt hatten. Obama fügte ja auch gleich hinzu, dass dieses Ziel nicht schnell erreicht werden wird, „vielleicht nicht einmal zu meinen Lebzeiten.“
Obama kündigte z.B. ein neues Abkommen mit Russland über die Verringerung der strategischen Atomwaffen an. Das war aber mit dem Auslaufen des “START-I-Abkommens“ am Ende dieses Jahres sowieso schon vereinbart. Die von ihm angekündigten Obergrenzen werden auch weiterhin so hoch sein, dass sie jeden Gegner zerstören können. Er will auch nicht auf den amerikanischen Raketen-Abwehrschirm verzichten, der den USA die Erstschlagskapazität gegen Russland ermöglichen soll. Die anderen Ankündigungen haben offensichtlich zum Ziel, Atomwaffen potentieller Gegner zu verhindern. (Siehe hierzu Knut Mellenthin junge Welt 09.04.2009 http://www.jungewelt.de/2009/02-12/044.php?sstr=)
Barack Obama verdankt seinen Einzug ins Weiße Haus auch seiner Opposition zum Irakkrieg. Damit befand er sich auf der Seite der großen Mehrheit der US-Amerikaner, denn fast zwei Drittel von ihnen sehen inzwischen diesen Krieg als Fehler und Desaster.
Im Wahlkampf versprach Obama den schnellen Abzug der Truppen aus Irak. Als Präsident verkündete er, dass der Abzug in kleineren Schritten als versprochen und erst Ende 2011 vollzogen werden soll. ABER: bis zu 50.000 Soldaten sollen im Irak auf unbestimmte Zeit stationiert bleiben. UND: anstelle von Anerkennung der Schuld der USA gegenüber der irakischen Bevölkerung mit ihren inzwischen auf über eine Million geschätzten zivilen Todesopfern (http://www.justforeignpolicy.org/iraq/iraqdeaths.html), lobte Obama die Soldaten, denn sie hätten ihren Auftrag erfüllt, Saddam Husseins Regierung gestürzt und beim Aufbau einer neuen Regierung geholfen. Erinnern wir uns, das war nicht der Vorwand, der für den Angriff auf Irak diente, sondern die angeblichen Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins.
Nach Afghanistan will Obama noch mehr Truppen schicken (und fordert von den Alliierten größeres Engagement) und er fördert die Ausweitung des Krieges nach Pakistan.
Gleichzeitig scheint sich aber auch bei Obama die Einsicht durchzusetzen, dass der Afghanistan-Konflikt mit Militär allein nicht zu lösen ist. So kündigte er einen Strategiewechsel an: Er will mit den “gemäßigten Taliban verhandeln”. Wie im besetzten Irak unter Bush, hofft Obama wohl auch, in Afghanistan die Besatzungsgegner gegeneinander auszuspielen. Viele bezweifeln jedoch jetzt schon, dass das in Afghanistan gelingen kann.
Obama und Israel: Widersprüchliche Signale
Der Nahe Osten ist ein zentrales Problem nicht nur auf internationaler Ebene. Das Verhältnis der USA zu Israel ist von besonderer Bedeutung und Brisanz auch für die politischen Verhältnisse in den USA selbst. Wie sich Obama letztlich dazu verhalten, wie seine Beziehung zur mächtigen Israel-Lobby sein wird, ist noch nicht eindeutig.
Die Signale sind widersprüchlich. Zum einen ernannte er George Mitchell, einen sehr erfahrenen und respektierten, auch arabisch sprechenden Vermittler zum Sonderbeauftragten für den Nahen Osten. Für die Beziehungen mit dem Iran aber wählte er den Erz-Zionisten Dennis Ross.
Nach seiner Nominierung als demokratischer Präsidentschaftskandidat war seine erste Handlung der Auftritt vor dem Kongress des zionistischen American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) um Israel seine ungeteilte Loyalität zu bekräftigen. AIPAC ist heute die wichtigste Lobby in den USA und alle, die in Washington eine große Rolle spielen wollen, müssen vor dieser Lobby antreten und Israel Treue schwören.
Die Bedeutung, das Ausmaß und der Einfluss der Israel-Lobby auf die Politik in Washington wird in der US-Öffentlichkeit immer breiter und lauter diskutiert, vor allem seitdem die beiden profilierten Universitätsprofessoren und politischen Berater Stephan Walt und John Mearsheimer die Mechanismen der Machtausübung dieser Lobby aufgezeigt haben. (http://www.arendt-art.de/deutsch/palestina/israellobby.htm)
Die Israel-Lobby, zu der übrigens auch rechtsgerichtete fundamentalistische Christen gehören, hat in den letzten Jahren systematisch entscheidenden Einfluss auf die Regierungspolitik gewonnen. Viele der wichtigsten Amtsträger in Washington seit der zweiten Regierung Clinton waren und sind Zionisten, deren Hauptziel darin besteht, die Interessen der israelischen Regierung durchzusetzen.
Eine große Anzahl von Kandidaten und Abgeordneten im US Kongress erhalten finanzielle Zuwendungen und Wahlhilfe von der Israel-Lobby. Dies geht aus regelmäßig veröffentlichten Statistiken des Washington Report on Middle East Affairs hervor. (http://www.wrmea.com/) Es ist bekannt, dass die Lobby ihnen sogar Reden liefert. Kongressabgeordnete, die es wagen, die Politik Israels zu hinterfragen oder gar zu kritisieren, haben kaum eine Chance Washington politisch zu überleben. In Israel und in den USA ist die Redewendung weit verbreitet, Israels wichtigstes besetztes Gebiet sei der US-Kongress.
Als in 2001 Shimon Peres sich in einer Kabinettssitzung über mögliche Reaktionen der USA auf Israels Aktionen Sorgen machte, antwortete Premierminister Ariel Sharon: „Sorgen Sie sich nicht über Amerikanischen Druck auf Israel. Wir, die Juden, kontrollieren Amerika, und Amerika weiß das.“ (http://www.wrmea.com/html/newsitem_s.htm) Mit „Juden“ meinte er natürlich die zionistische Lobby. Die US-Regierung hat über diese Aussage keine Erklärung eingefordert.
Obamas erste Personalentscheidung war die Ernennung des Erz-Zionisten Rahm Emanuel zum Stabschef im Weißen Haus. Obamas Vizepräsident Biden ist stolzer Zionist. „Ich bin Zionist”, erklärte er, „denn man muss kein Jude sein, um Zionist zu sein.“ (http://www.youtube.com/watch?v=yAZmO80dLfE)
Im März sollte der ehemalige US-Botschafter in Saudi Arabien und Nahostspezialist, Charles Freeman, die Koordination der geheimdienstlichen Analysen übernehmen. Freeman gilt als sehr erfahrener Spezialist. Unter ihm hätte die geheimdienstliche Analyse ihre eigentliche Rolle gespielt, nämlich objektive Lageberichte zu liefern, als Grundlage für Regierungsentscheidungen. Das wollte die Israel-Lobby unter allen Umständen verhindern und organisierte eine derart verleumderische Kampagne gegen Freeman, dass er schließlich seine Kandidatur zurückzog. Obama hatte sich nicht für Charles Freeman eingesetzt.
Nach Informationen der israelischen Zeitung Ha’aretz bereitet Obama Kongressabgeordnete auf eine mögliche Konfrontation zwischen seiner Regierung und der von Netanjahu über die Zweistaatenlösung vor. Dieses Vorgehen ist neu und „soll verhindern, dass Netanjahu die Regierung umgeht und im Kongress Unterstützung organisiert.“ (http://www.haaretz.com/hasen/spages/1077222.html) Der israelische Außenminister Avigdor Lieberman ist sich jedoch sicher, dass die US-Regierung nichts gegen die Wünsche Israels tun wird. „Glauben Sie mir, Amerika akzeptiert all unsere Entscheidungen” erklärte er vor wenigen Tagen der russischen Tageszeitung Moskovskiy Komosolets. (http://www.haaretz.com/hasen/spages/1080195.html)
Obama hat direkte Gespräche mit Teheran angekündigt, will Iran das Recht auf Nukleartechnologie zugestehen und zumindest für die Zeit der Gespräche ebenso die Urananreicherung. Es wird sich zeigen, wie stark der Einfluss der Israel-Lobby sein wird, diese Gespräche zu torpedieren. Denn Israel ist gegen Gespräche mit Iran und drängt die USA schon lange zu einem Militärschlag gegen das Land. US-Verteidigungsminister Gates erteilte Israels Drängen nach einem Militärschlag gegen Iran aber eine deutliche Absage. Es scheint zumindest, dass – im Gegensatz zur Bush-Regierung – die neue US-Administration Israel keine "carte blanche“ mehr gewährt.
Die US-Politik der letzten Jahre hatte die gesamte muslimische Welt gegen die USA aufgebracht und deren Wirtschaftsinteressen erheblich geschadet. Die Person Obama, seine Herkunft, Hautfarbe und sein Name sind unter den gegenwärtigen Bedingungen ideal für den US-Imperialismus, der eine Verbesserung der Beziehung zu den muslimischen Ländern benötigt, um die eigene Rohstoffversorgung nachhaltiger zu sichern als durch die Kriege der Bush-Regierung. Die „Öffnung zur muslimischen Welt“, die Obama ankündigte und die bei seinem Besuch in der Türkei gefeiert wurde, zeigt diese Neuorientierung. Die Türkei und Iran spielen eine strategische Schlüsselrolle in der auch von Obama offensichtlich verfolgten Isolierung Russlands und in der Sicherung der US-Energieversorgung.
Die Bush-Regierung hinterlässt ein schweres Erbe
Regierungspolitik kann mit einem Hochseetanker verglichen werden. Er braucht seine Zeit um in Fahrt zu kommen und wenn er mal in Fahrt ist, dann braucht er Zeit um seinen Kurs zu ändern, auch wenn die Katastrophe am Horizont erscheint. Und Regierungspolitik ist natürlich der Ausdruck der realen Machtverhältnisse.
Obama wurde nicht in ein Vakuum gewählt. Seine Amtszeit folgt auf 8 Jahre reaktionärster Politik. Der Regierung von George W. Bush ging die reaktionäre Politik von Clinton, Bush Sr, Reagan und dessen Vorgängern voraus. In der Konkurrenz zwischen dem zivilen und dem Rüstungssektor der Wirtschaft, gewann der Militär-Industrielle Komplex seit mehreren Jahrzehnten immer mehr die Oberhand in der Regierungspolitik Washingtons.
In seiner Abschiedsrede als US-Präsident im Januar 1961 warnte Dwight D. Eisenhower vor der wachsenden Macht des Militär-Industriellen Komplexes und seinem destruktiven Einfluss auf die Demokratie. (http://www.youtube.com/watch?v=8y06NSBBRtY) John F. Kennedy war der erste – und letzte – Präsident, der es wagte, sich ernsthaft mit dem Militär-Industriellen Komplex anzulegen. Mit dem Ergebnis, das wir alle kennen.
Der Militär-Industrielle Komplex hat inzwischen nicht nur die gesamte Gesellschaft militarisiert und den Sicherheitsstaat geschaffen. Für die US-Außenpolitik benötigt er permanent den äußeren Feind. Nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten, nach dem Wegfall der "kommunistischen Gefahr“, wird die Gefahr eines "Internationalen Terrorismus“ beschworen. Unter Obama könnte es nun auch die Piraterie werden, die medienwirksam bereits zum drängenden internationalen Problem aufgeblasen und zusammengelogen wird.
Während der zwei Amtszeiten von George W. Bush wurde unter dem Vorwand des "Kampfes gegen den Terrorismus“ die US-Verfassung ausgehöhlt, um einer arbiträren Machtausübung Platz zu schaffen. Die US-Regierung setzte sich über alle internationalen Normen hinweg. Wie weit reichend, zeigen auch die geheimen Folterprotokolle, die vor kurzem enthüllt wurden.
Die Bush-Regierung hinterließ ein Land, das gleich mehrere Aggressionskriege führt, innenpolitisch und außenpolitisch erheblich an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat und in einer tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise steckt.
"Wandel“ – welcher Wandel?
Die Folgen dieser Politik erbt Obama. Aber können wir von Obama erwarten, dass er den Kurs des Hochseetankers grundsätzlich ändert?
Nicht nur hat Obama ein größeres intellektuelles Potential als viele seiner Vorgänger, er hat auch eine Lebenserfahrung wie kein anderer Präsident vor ihm und wie sicherlich auch kein anderes Mitglied seines Kabinetts. Er war in Welten, die den anderen völlig fremd sind. Und im Gegensatz zu anderen Präsidenten vor ihm, war Obama in seiner eigenen Entwicklung mit linker Politik in Berührung gekommen. Er frequentierte linke, fortschrittliche Kreise und hatte entsprechende Freunde. Aber Obama selbst war und ist kein Linker und er ist sicherlich kein Antiimperialist.
Obama könnte der Rettungsanker werden für wichtige Teile der in Bedrängnis geratenen US-amerikanischen Bourgeoisie. Es wäre auch vorstellbar, dass Teile der Bourgeoisie seine Fähigkeiten schon früh erkannten und halfen, ihn als Kandidaten für die Präsidentschaft aufzubauen. Die US-Politik steht vor einem Scherbenhaufen – innenpolitisch und außenpolitisch – hervorgerufen durch das langjährige Diktat des Militär-Industriellen Komplexes. Die Aggressionskriege haben die eigenen Möglichkeiten überspannt, die Probleme verschärft und den US-Wirtschaftsinteressen geschadet. Der US-Imperialismus muss seine Kräfte neu ordnen und orientieren, um im stärker werdenden Konkurrenzkampf um die Ressourcen der Welt zu bestehen. Obama ist hierfür der richtige Mann.
In seiner Antrittsrede legte er großes Gewicht auf die globale Führungsrolle der USA. Die Bush-Regierung hatte durch ihre Alleingänge und Brutalo-Politik die Europäischen Verbündeten verprellt und jenen Kräften Auftrieb gegeben, die eine größere Unabhängigkeit der EU von den USA anstreben. Dies trifft übrigens besonders auf die Bundesrepublik zu, die inzwischen stärker von der Energiezufuhr aus Russland abhängig ist, als es den USA recht sein kann. Obama will das ändern und die Europäer wieder stärker an die USA binden.
Barack Obama steht für die Teile der US-Bourgeoisie, die nicht allein auf Militärmacht setzen, die zur Durchsetzung ihrer Interessen eher Kooperation statt Konfrontation suchen, eher Handelsbeziehungen statt den Krieg. Deswegen spielt die Diplomatie unter Obama wieder eine größere Rolle.
Diese soll auch helfen, das Verhältnis zu Lateinamerika zu stärken, denn mit dem wachsenden Einfluss linker Regierungen droht den USA ihr sicher geglaubter "Hinterhof“ Lateinamerika zu entgleiten. Das Verhältnis zu Kuba wird hier eine entscheidende Rolle spielen. Der "Wandel“ von dem Obama so gerne spricht, könnte hier ganz konkret bedeuten "Wandel durch Annäherung“, oder im Klartext: Erdrückung durch Umarmung.
Die Linke Bewegung ist gefordert
Obama erklärte am Abend seiner Wahl: „Dieser Sieg allein ist nicht der Wandel, den wir erstreben – aber er gibt uns die Möglichkeit einen Wandel zu erreichen.“ Das müssen die Friedensbewegung, die sozialen Bewegungen, die Gewerkschaften und die linken Kräfte als Herausforderung annehmen, um den Wandel in unserem Sinne einzufordern: für die Interessen der Völker, die unter dem US-Imperialismus leiden, und für die Interessen der arbeitenden und arbeitslosen US-Bevölkerung, der Obdachslosen, der Menschen ohne Gesundheitsfürsorge, der vielen, die unter dem Rassismus und dem Unrecht in den USA leiden.
Von Präsident Franklin D. Roosevelt wird berichtet, er habe in den 30er Jahren die Gewerkschaften aufgerufen ihn zu zwingen, das zu tun, was er tun möchte. Wenn sich die progressiven Kräfte tatsächlich einen grundsätzlichen Wandel der Innen- und Außenpolitik der USA erhoffen, wenn sie hoffen, dass er bereit sein könnte, dies auch im Zweifelsfall gegen die mächtigen wirtschaftlichen und militärischen Interessen zu tun, dann könnte er dies nur mit der Macht im Rücken, die von der Straße kommt, aus den Betrieben, aus den Universitäten und Schulen.
Die linken Kräfte müssen die Herausforderung der Obama-Präsidentschaft annehmen und nutzen, um ein günstigeres Klima zu schaffen, größeres Gehör zu finden und um stärker Fuß zu fassen in der US-Gesellschaft.
Unabhängig davon, wie sich eine Regierung in einem kapitalistischen Staat zusammensetzt, eines bleibt grundsätzlich für die Linke – egal ob in den USA, Europa oder anderswo. Es wird immer auf sie ankommen, auf ihre Stärke und ihre Mobilisierungsfähigkeit von breiten Massen, um genug Druck zu organisieren, um gegen die Interessen des Kapitals eine sozial gerechte und eine Friedenspolitik durchzusetzen. (PK)
George Pumphrey (geboren in den USA) und Doris Pumphrey (geboren in
der BRD) waren in der Bürgerrechtsbewegung und bei den Black Panthern
und sind seit vielen Jahren in Frankreich und später in der
Bundesrepublik im anti-rassistischen und Friedenskampf engagiert.
Online-Flyer Nr. 195 vom 29.04.2009
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE