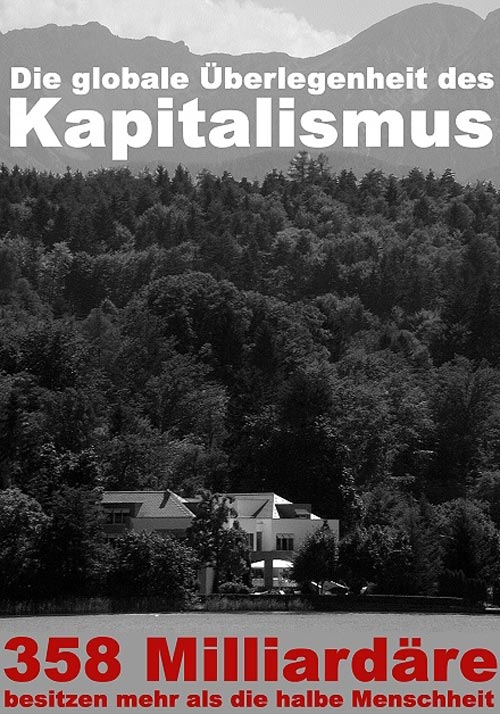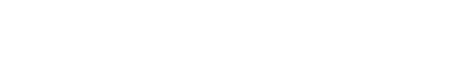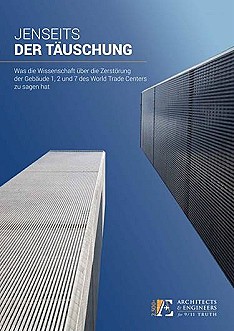SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Kultur und Wissen
Die Me-Too-Berlinale
Was Kunst besser kann als Kampagnen
Von Ulrich Gellermann
 Me too, me too schallt es von der Bühne im Berlinale-Palast und alle, alle stimmen in das eher wohlfeile Echo ein: Von der Kulturstaatsministerin, die den Begriff bisher auch schon kannte, aber nur wenn es um Posten und Finanzen ging, bis zu jenen Besuchern, die seit Jahren brav den me-too-Produkten der Konsum-Industrie folgten, um plötzlich eine echt neue Bedeutung des Begriffs zu entdecken. Nichts gegen eine Kampagne, die sich gegen die Gewaltstrukturen des Film- und TV-Betriebs wendet. Zu prüfen wäre, ob denn unter den BERLINALE-Filmen auch solche waren, die den Gewalt- und Herrschafts-Strukturen weit über das Glamour-Business hinaus nachspüren.
Me too, me too schallt es von der Bühne im Berlinale-Palast und alle, alle stimmen in das eher wohlfeile Echo ein: Von der Kulturstaatsministerin, die den Begriff bisher auch schon kannte, aber nur wenn es um Posten und Finanzen ging, bis zu jenen Besuchern, die seit Jahren brav den me-too-Produkten der Konsum-Industrie folgten, um plötzlich eine echt neue Bedeutung des Begriffs zu entdecken. Nichts gegen eine Kampagne, die sich gegen die Gewaltstrukturen des Film- und TV-Betriebs wendet. Zu prüfen wäre, ob denn unter den BERLINALE-Filmen auch solche waren, die den Gewalt- und Herrschafts-Strukturen weit über das Glamour-Business hinaus nachspüren.
Black 47
Black 47 von Lance Daly, das hätte solch ein Film sein können: Den historischen Hintergrund liefert die brutale Hungersnot im Irland des Jahres 1847, als die Iren nicht nur im Ergebnis der Kartoffelfäule starben oder auswanderten, sondern auch Opfer einer nicht geringeren brutalen Gewalt der britischen Herrschaft wurden. Doch der Film wendet keine Mühe auf, Hintergründe dieser Art zu erzählen. Das ist so, als ob man die Story von Harvey Weinstein und seinen Opfern erzählen würde, ohne die Unsummen zu erwähnen, die im Business verdient werden, ohne die Gier nach Profit zu berücksichtigen, und jene Gier nach erzwungenem Sex als Begleiterscheinung der systemischen Herrschaft zu bemerken.
Im Vordergrund von „Black 47“ schwelgt die Kamera in großartigen irischen Landschaften, die Ausstatter präsentieren wunderwarmen irischen Tweed und die Sponsoren lassen prima irischen Whiskey kreisen und ganz weit vorne, an der Rampe des Stücks, wird eine Rachedrama gegeben: Ein irischer Ex-Soldat aus dem Anglo-Afghanischen Krieg von 1839 bis 1842 – von dem uns Theodor Fontanes Ballade über die anfänglich dreizehntausend Soldaten, von denen nur einer aus Afghanistan heim kam erzählt. Der Soldat trifft auf einen alten Kumpel aus der britischen Afghanistan-Armee und erledigt mit ihm gemeinsam Leute, die seiner Familie das angetan hatten, was in Afghanistan bis heute üblich ist: Eingeborene umbringen. Bis nahezu jüngst waren sogar sieben irische Soldaten Teil der heutigen Afghanistan-Mission. Sie sind inzwischen zurück. Die Deutschen nicht. Vielleicht meidet der Film deshalb jede Parallele, jeden Bezug. Man wollte die Berlinale augenscheinlich nicht überfordern.
Transit
Mit "Transit", einem Film von Christian Petzold nach Anna Seghers gleichnamigem Roman, leistet sich die Berlinale die Verfilmung eines historischen Themas, die im Heute angekommen ist: Zum Exil während der Nazi-Zeit. Es ist ein Wagnis und eine Kunst, dass Petzold den Stoff ins heutige Marseille hebt und eine Flüchtlingsfamilie aus dem Maghreb auftreten lässt. Kenner des Seghers-Romans mag es irritieren, wenn statt uniformierter Nazis schwer armierte französische Polizisten auftreten. Doch bekommt es der Handlung, wenn das Warten auf Amtsentscheidungen, auf Papiere und Passagen ohne Umstände aus dem Damals ins Jetzt transportiert werden: Flucht, Angst und Repression bleiben über die Jahrzehnte, und das Wagnis der Aktualisierung ist gelungen.
Petzolds Film leistet sich mitten im Elend idyllische Bilder: Selbst an den Bahngleisen der Flucht wächst der schöne, rote Mohn. Und wenn er seinen männlichen Hauptdarsteller, Franz Rogowski, als Torwart im Spiel mit dem Flüchtlingsjungen agieren lässt, dann richtet die Kamera einen zärtlichen Blick auf die Beiden, der von einer Welt spricht, die besser sein könnte und müsste, als sie es ist. Es gibt einen Ausflug zu dem, was Heimat wirklich ist, wenn der Regisseur den flüchtigen Gast der Flüchtlinge deren kaputtes Radio reparieren lässt: Für einen Moment nur soll alles heil sein, als sei Rogowski der fehlende Vater.
Weit über das formelhafte "Ich auch" hinaus, gelingt dem Film "Transit" ein Nachdenken über Solidarität, fragt er nach dem "Und was tust Du?", ohne Moral zu predigen. Und wer aus dem Kino geht, um draußen vor den Toren des Berlinale-Palastes zu erfahren, dass die gusseiserne Ursula von der Leyen als nächste Nato-Generalsekretärin im Gespräch ist, dass auf der Münchner Sicherheitskonferenz die gefährliche Unsicherheit der deutschen Auslandseinsätze mit keinem Wort in Frage gestellt wurden, der kann wissen, was Kunst anders und besser kann als die aktuelle politische Kampagne: Den produktiven Zweifel am Kriegskurs zu vertiefen, der Hauptursache für die Flüchtlinge unserer Tage ist. Mit dem Film "Transit" ist das dem Regisseur und seinen Schauspielern gelungen. Und gelungen auch die Verbeugung vor Anna Seghers, jener kommunistischen Schriftstellerin, die aus der eigenen Flucht vor den Nazis in ihren Romanen gültige Lehren aufzeigen konnte, die bis ins Heute ragen.
Erstveröffentlichung am 19. Februar 2018 bei rationalgalerie.de – Eine Plattform für Nachdenker und Vorläufer
Top-Foto:
Ulrich Gellermann (aus Video-Interview: deutsch.rt.com)
Online-Flyer Nr. 648 vom 21.02.2018
Druckversion
Kultur und Wissen
Die Me-Too-Berlinale
Was Kunst besser kann als Kampagnen
Von Ulrich Gellermann
 Me too, me too schallt es von der Bühne im Berlinale-Palast und alle, alle stimmen in das eher wohlfeile Echo ein: Von der Kulturstaatsministerin, die den Begriff bisher auch schon kannte, aber nur wenn es um Posten und Finanzen ging, bis zu jenen Besuchern, die seit Jahren brav den me-too-Produkten der Konsum-Industrie folgten, um plötzlich eine echt neue Bedeutung des Begriffs zu entdecken. Nichts gegen eine Kampagne, die sich gegen die Gewaltstrukturen des Film- und TV-Betriebs wendet. Zu prüfen wäre, ob denn unter den BERLINALE-Filmen auch solche waren, die den Gewalt- und Herrschafts-Strukturen weit über das Glamour-Business hinaus nachspüren.
Me too, me too schallt es von der Bühne im Berlinale-Palast und alle, alle stimmen in das eher wohlfeile Echo ein: Von der Kulturstaatsministerin, die den Begriff bisher auch schon kannte, aber nur wenn es um Posten und Finanzen ging, bis zu jenen Besuchern, die seit Jahren brav den me-too-Produkten der Konsum-Industrie folgten, um plötzlich eine echt neue Bedeutung des Begriffs zu entdecken. Nichts gegen eine Kampagne, die sich gegen die Gewaltstrukturen des Film- und TV-Betriebs wendet. Zu prüfen wäre, ob denn unter den BERLINALE-Filmen auch solche waren, die den Gewalt- und Herrschafts-Strukturen weit über das Glamour-Business hinaus nachspüren.Black 47
Black 47 von Lance Daly, das hätte solch ein Film sein können: Den historischen Hintergrund liefert die brutale Hungersnot im Irland des Jahres 1847, als die Iren nicht nur im Ergebnis der Kartoffelfäule starben oder auswanderten, sondern auch Opfer einer nicht geringeren brutalen Gewalt der britischen Herrschaft wurden. Doch der Film wendet keine Mühe auf, Hintergründe dieser Art zu erzählen. Das ist so, als ob man die Story von Harvey Weinstein und seinen Opfern erzählen würde, ohne die Unsummen zu erwähnen, die im Business verdient werden, ohne die Gier nach Profit zu berücksichtigen, und jene Gier nach erzwungenem Sex als Begleiterscheinung der systemischen Herrschaft zu bemerken.
Im Vordergrund von „Black 47“ schwelgt die Kamera in großartigen irischen Landschaften, die Ausstatter präsentieren wunderwarmen irischen Tweed und die Sponsoren lassen prima irischen Whiskey kreisen und ganz weit vorne, an der Rampe des Stücks, wird eine Rachedrama gegeben: Ein irischer Ex-Soldat aus dem Anglo-Afghanischen Krieg von 1839 bis 1842 – von dem uns Theodor Fontanes Ballade über die anfänglich dreizehntausend Soldaten, von denen nur einer aus Afghanistan heim kam erzählt. Der Soldat trifft auf einen alten Kumpel aus der britischen Afghanistan-Armee und erledigt mit ihm gemeinsam Leute, die seiner Familie das angetan hatten, was in Afghanistan bis heute üblich ist: Eingeborene umbringen. Bis nahezu jüngst waren sogar sieben irische Soldaten Teil der heutigen Afghanistan-Mission. Sie sind inzwischen zurück. Die Deutschen nicht. Vielleicht meidet der Film deshalb jede Parallele, jeden Bezug. Man wollte die Berlinale augenscheinlich nicht überfordern.
Transit
Mit "Transit", einem Film von Christian Petzold nach Anna Seghers gleichnamigem Roman, leistet sich die Berlinale die Verfilmung eines historischen Themas, die im Heute angekommen ist: Zum Exil während der Nazi-Zeit. Es ist ein Wagnis und eine Kunst, dass Petzold den Stoff ins heutige Marseille hebt und eine Flüchtlingsfamilie aus dem Maghreb auftreten lässt. Kenner des Seghers-Romans mag es irritieren, wenn statt uniformierter Nazis schwer armierte französische Polizisten auftreten. Doch bekommt es der Handlung, wenn das Warten auf Amtsentscheidungen, auf Papiere und Passagen ohne Umstände aus dem Damals ins Jetzt transportiert werden: Flucht, Angst und Repression bleiben über die Jahrzehnte, und das Wagnis der Aktualisierung ist gelungen.
Petzolds Film leistet sich mitten im Elend idyllische Bilder: Selbst an den Bahngleisen der Flucht wächst der schöne, rote Mohn. Und wenn er seinen männlichen Hauptdarsteller, Franz Rogowski, als Torwart im Spiel mit dem Flüchtlingsjungen agieren lässt, dann richtet die Kamera einen zärtlichen Blick auf die Beiden, der von einer Welt spricht, die besser sein könnte und müsste, als sie es ist. Es gibt einen Ausflug zu dem, was Heimat wirklich ist, wenn der Regisseur den flüchtigen Gast der Flüchtlinge deren kaputtes Radio reparieren lässt: Für einen Moment nur soll alles heil sein, als sei Rogowski der fehlende Vater.
Weit über das formelhafte "Ich auch" hinaus, gelingt dem Film "Transit" ein Nachdenken über Solidarität, fragt er nach dem "Und was tust Du?", ohne Moral zu predigen. Und wer aus dem Kino geht, um draußen vor den Toren des Berlinale-Palastes zu erfahren, dass die gusseiserne Ursula von der Leyen als nächste Nato-Generalsekretärin im Gespräch ist, dass auf der Münchner Sicherheitskonferenz die gefährliche Unsicherheit der deutschen Auslandseinsätze mit keinem Wort in Frage gestellt wurden, der kann wissen, was Kunst anders und besser kann als die aktuelle politische Kampagne: Den produktiven Zweifel am Kriegskurs zu vertiefen, der Hauptursache für die Flüchtlinge unserer Tage ist. Mit dem Film "Transit" ist das dem Regisseur und seinen Schauspielern gelungen. Und gelungen auch die Verbeugung vor Anna Seghers, jener kommunistischen Schriftstellerin, die aus der eigenen Flucht vor den Nazis in ihren Romanen gültige Lehren aufzeigen konnte, die bis ins Heute ragen.
Erstveröffentlichung am 19. Februar 2018 bei rationalgalerie.de – Eine Plattform für Nachdenker und Vorläufer
Top-Foto:
Ulrich Gellermann (aus Video-Interview: deutsch.rt.com)
Online-Flyer Nr. 648 vom 21.02.2018
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE