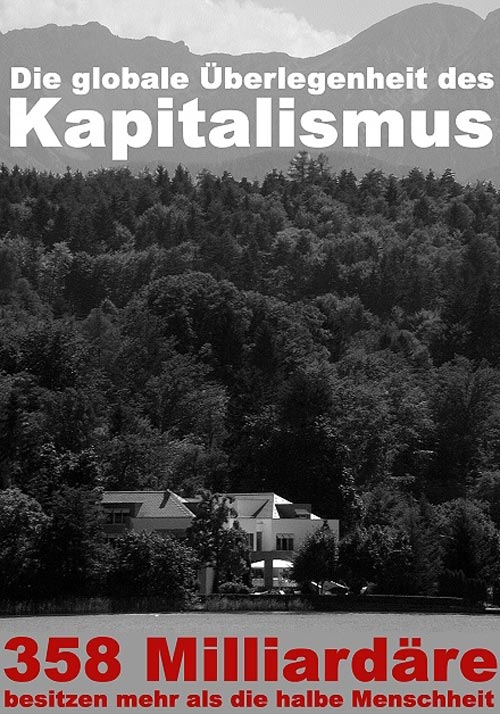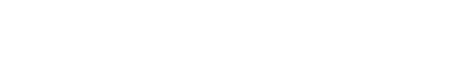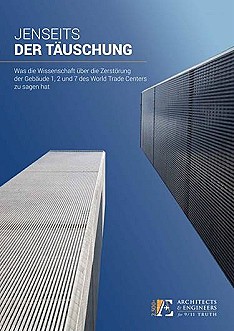SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Literatur
Eine Geschichte im Monat Mai
Draußen vor der Tür
Von Mischi Steinbrück
 Es war ein kalter Mai und meine Mutter heizte noch. Mit Koks, der aus dem Keller geholt werden musste. Ich erinnere mich, wie sie, angetan mit dem Schürzenkleid, einen alten krumpeligen Lederhandschuh zum Schutz über einer Hand, runterging in den Keller und mit den zwei schweren Eimern wiederkam, wie sie den Rost rüttelte, damit die Asche durchfiel und dann die Kohlen in den roten Schlund des Ofens nachschüttete. Alle Geräusche noch im Ohr. In der Küche war es vom Kochen warm. - Manchmal läutete es gegen Abend an unserer Wohnungstür. Papa war schon zu Hause und wollte nicht gestört werden. Er las entweder oder ruhte sich aus. Ich war bei ihr in der Küche. Wir erwarteten keine Gäste. Und so hörte ich meine Mutter halblaut „Oje, die S.!“ sagen.
Es war ein kalter Mai und meine Mutter heizte noch. Mit Koks, der aus dem Keller geholt werden musste. Ich erinnere mich, wie sie, angetan mit dem Schürzenkleid, einen alten krumpeligen Lederhandschuh zum Schutz über einer Hand, runterging in den Keller und mit den zwei schweren Eimern wiederkam, wie sie den Rost rüttelte, damit die Asche durchfiel und dann die Kohlen in den roten Schlund des Ofens nachschüttete. Alle Geräusche noch im Ohr. In der Küche war es vom Kochen warm. - Manchmal läutete es gegen Abend an unserer Wohnungstür. Papa war schon zu Hause und wollte nicht gestört werden. Er las entweder oder ruhte sich aus. Ich war bei ihr in der Küche. Wir erwarteten keine Gäste. Und so hörte ich meine Mutter halblaut „Oje, die S.!“ sagen.
Ich, trotz des Stoßseufzers meiner Mutter froh über die Abwechslung, stürzte zur Tür. Und tatsächlich. Da stand die S. Im Schatten, außerhalb des aus der Wohnung fallenden Lichtkegels. Eine völlig außergewöhnliche Erscheinung. Und bevor sie oder ich etwas sagen konnten, war schon meine Mutter hinter mir und begrüßte sie herzlich. Die S. fragte stammelnd, ob sie störe. Meine Mutter beteuerte, dass das ganz und gar nicht der Fall sei… „Aber ihr Gatte…?“ „Aber nein, nein, bitte kommen Sie herein. Ich mach gerade Essen; bitte kommen Sie doch, essen Sie mit uns…“ „Nein, auf keinen Fall. Ich möchte nicht stören. Ihr Gatte ist ja schon zu Hause…“ „Ja wenn es Ihnen nichts ausmacht, bitte kommen Sie in die Küche…“ „Nur, wenn ich nicht störe…“ Und die Erscheinung kam in die Küche. Unsere Küche war ein schmaler Schlauch, in dem sich auch das Waschbecken für die Familie befand. Am Tisch hatten nur zwei Stühle Platz. Zur Not konnte man noch einen Hocker unter dem Tisch hervorziehen. „Ach, es ist mir so unangenehm. Sie richten gerade das Abendbrot für Ihren Gatten…“ „Aber ich bitte Sie, Frau S., darf ich Ihnen etwas anbieten?“ „Nein, tausend Dank, auf keinen Fall!“ „Aber ich bin doch sowieso gerade dabei. Bitte nehmen Sie etwas an. Mögen Sie vielleicht eine Semmel?“
Frau S. war die weitaus schlankeste Frau, die ich je gesehen hatte. Die Kleidung schlotterte an ihr – und ihr schönes Gesicht, voller feiner Falten, war zu meiner Verwunderung auch im Winter tief gebräunt. (Das war damals nicht Mode)
Frau S.‘ Kleider hatten Löcher. Große und kleine. Aber die Sachen waren von erlesener Qualität. Feinste Woll- und Seidenstoffe, in seltenen Farben: Blusen, Röcke, Schals, Westen. Alles ein bisschen verblichen – wie eine Herbstwiese. Da und dort hing auch ein Gras- oder Strohhalm. Die Löcher versuchte sie, mit ihren sehnigen, ebenfalls tief gebräunten Händen zu verdecken. Und während meine Mutter versuchte, ein Gespräch zustande zu bringen, murmelte Frau S. „Ich sehe schrecklich aus. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich will Ihnen keine Umstände machen…“
Während jedes solcher abendlichen Besuche hörte ich Bruchstücke aus Frau S.‘ Geschichte.
Sie hatte keine Wohnung. Oder vielmehr, sie durfte nicht in die Wohnung, in der ihre Möbel und Sachen waren. Wo sie hauste, wusste niemand. Tagsüber war Frau S. immer im Wald. Sie bekam auch keine Rente.
Wenn je ein Mensch mir vornehm erschien, so war es Frau S. Sie hatte einen wunderbar geformten Kopf, kurzes, weiches, ergrauendes Haar, eine klare, hohe Stirn, leuchtende graue Augen. Und sie sprach reinstes Hochdeutsch.
Sie war völlig in ihr Leid verstrickt – und doch in keiner Weise larmoyant.
Sie war die Geliebte (so drückte es meine Mutter aus), aber wohl eher die Lebensgefährtin eines reichen jüdischen Mannes gewesen, bei dem sie entweder gelebt hatte, oder der ihr die Wohnung bezahlt hatte. Der Mann war in Auschwitz umgebracht worden. Sie von den Nazis als „Judenhure“ auf die Straße gejagt, im Arrest geschoren worden und die Wohnung von den Nazis besetzt. Wo sie von 38 bis 45 bleiben konnte, habe ich nie erfahren. Seit 45 hätte sie wohl als Witwe des Ermordeten Anspruch auf die Wohnung erheben können. Als bloßer Lebensgefährtin war ihr das verwehrt – und in der Wohnung lebten noch immer Nazis. Seitdem irrte sie täglich durch den Wienerwald. Ich glaube, sie ernährte sich sogar teilweise von Beeren, bis der Hunger sie zum Betteln verurteilte.
Irgendwann zum Glück war es ihr doch gelungen, einen Prozess anzustrengen. Nach zig Jahren erfuhr ich von meiner Mutter, dass sie eine Entschädigung erhalten hatte und in einem Altersheim in ihrem geliebten Wienerwald untergekommen war. Sie soll dort sehr glücklich und zufrieden gelebt haben.
Der Stoßtseufzer meiner Mutter „Oje, die S.!“ tut der Nächstenliebe, mit der sie die damals so unglückliche Frau behandelte, keinen Abbruch. Meine Mutter war keine „geborene“ Hausfrau. Sie stand nur ungern für meinen Vater und mich am Herd. Sie war auch keine gläubige oder gar fromme Christin. Und sie hätte Frau S. nicht hereinbitten müssen.
Top-Bild: Symbol für den Kampf der Arbeiterbewegung gegen Faschismus, Klerikalismus und Kapitalismus
Online-Flyer Nr. 744 vom 13.05.2020
Druckversion
Literatur
Eine Geschichte im Monat Mai
Draußen vor der Tür
Von Mischi Steinbrück
 Es war ein kalter Mai und meine Mutter heizte noch. Mit Koks, der aus dem Keller geholt werden musste. Ich erinnere mich, wie sie, angetan mit dem Schürzenkleid, einen alten krumpeligen Lederhandschuh zum Schutz über einer Hand, runterging in den Keller und mit den zwei schweren Eimern wiederkam, wie sie den Rost rüttelte, damit die Asche durchfiel und dann die Kohlen in den roten Schlund des Ofens nachschüttete. Alle Geräusche noch im Ohr. In der Küche war es vom Kochen warm. - Manchmal läutete es gegen Abend an unserer Wohnungstür. Papa war schon zu Hause und wollte nicht gestört werden. Er las entweder oder ruhte sich aus. Ich war bei ihr in der Küche. Wir erwarteten keine Gäste. Und so hörte ich meine Mutter halblaut „Oje, die S.!“ sagen.
Es war ein kalter Mai und meine Mutter heizte noch. Mit Koks, der aus dem Keller geholt werden musste. Ich erinnere mich, wie sie, angetan mit dem Schürzenkleid, einen alten krumpeligen Lederhandschuh zum Schutz über einer Hand, runterging in den Keller und mit den zwei schweren Eimern wiederkam, wie sie den Rost rüttelte, damit die Asche durchfiel und dann die Kohlen in den roten Schlund des Ofens nachschüttete. Alle Geräusche noch im Ohr. In der Küche war es vom Kochen warm. - Manchmal läutete es gegen Abend an unserer Wohnungstür. Papa war schon zu Hause und wollte nicht gestört werden. Er las entweder oder ruhte sich aus. Ich war bei ihr in der Küche. Wir erwarteten keine Gäste. Und so hörte ich meine Mutter halblaut „Oje, die S.!“ sagen.Ich, trotz des Stoßseufzers meiner Mutter froh über die Abwechslung, stürzte zur Tür. Und tatsächlich. Da stand die S. Im Schatten, außerhalb des aus der Wohnung fallenden Lichtkegels. Eine völlig außergewöhnliche Erscheinung. Und bevor sie oder ich etwas sagen konnten, war schon meine Mutter hinter mir und begrüßte sie herzlich. Die S. fragte stammelnd, ob sie störe. Meine Mutter beteuerte, dass das ganz und gar nicht der Fall sei… „Aber ihr Gatte…?“ „Aber nein, nein, bitte kommen Sie herein. Ich mach gerade Essen; bitte kommen Sie doch, essen Sie mit uns…“ „Nein, auf keinen Fall. Ich möchte nicht stören. Ihr Gatte ist ja schon zu Hause…“ „Ja wenn es Ihnen nichts ausmacht, bitte kommen Sie in die Küche…“ „Nur, wenn ich nicht störe…“ Und die Erscheinung kam in die Küche. Unsere Küche war ein schmaler Schlauch, in dem sich auch das Waschbecken für die Familie befand. Am Tisch hatten nur zwei Stühle Platz. Zur Not konnte man noch einen Hocker unter dem Tisch hervorziehen. „Ach, es ist mir so unangenehm. Sie richten gerade das Abendbrot für Ihren Gatten…“ „Aber ich bitte Sie, Frau S., darf ich Ihnen etwas anbieten?“ „Nein, tausend Dank, auf keinen Fall!“ „Aber ich bin doch sowieso gerade dabei. Bitte nehmen Sie etwas an. Mögen Sie vielleicht eine Semmel?“
Frau S. war die weitaus schlankeste Frau, die ich je gesehen hatte. Die Kleidung schlotterte an ihr – und ihr schönes Gesicht, voller feiner Falten, war zu meiner Verwunderung auch im Winter tief gebräunt. (Das war damals nicht Mode)
Frau S.‘ Kleider hatten Löcher. Große und kleine. Aber die Sachen waren von erlesener Qualität. Feinste Woll- und Seidenstoffe, in seltenen Farben: Blusen, Röcke, Schals, Westen. Alles ein bisschen verblichen – wie eine Herbstwiese. Da und dort hing auch ein Gras- oder Strohhalm. Die Löcher versuchte sie, mit ihren sehnigen, ebenfalls tief gebräunten Händen zu verdecken. Und während meine Mutter versuchte, ein Gespräch zustande zu bringen, murmelte Frau S. „Ich sehe schrecklich aus. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich will Ihnen keine Umstände machen…“
Während jedes solcher abendlichen Besuche hörte ich Bruchstücke aus Frau S.‘ Geschichte.
Sie hatte keine Wohnung. Oder vielmehr, sie durfte nicht in die Wohnung, in der ihre Möbel und Sachen waren. Wo sie hauste, wusste niemand. Tagsüber war Frau S. immer im Wald. Sie bekam auch keine Rente.
Wenn je ein Mensch mir vornehm erschien, so war es Frau S. Sie hatte einen wunderbar geformten Kopf, kurzes, weiches, ergrauendes Haar, eine klare, hohe Stirn, leuchtende graue Augen. Und sie sprach reinstes Hochdeutsch.
Sie war völlig in ihr Leid verstrickt – und doch in keiner Weise larmoyant.
Sie war die Geliebte (so drückte es meine Mutter aus), aber wohl eher die Lebensgefährtin eines reichen jüdischen Mannes gewesen, bei dem sie entweder gelebt hatte, oder der ihr die Wohnung bezahlt hatte. Der Mann war in Auschwitz umgebracht worden. Sie von den Nazis als „Judenhure“ auf die Straße gejagt, im Arrest geschoren worden und die Wohnung von den Nazis besetzt. Wo sie von 38 bis 45 bleiben konnte, habe ich nie erfahren. Seit 45 hätte sie wohl als Witwe des Ermordeten Anspruch auf die Wohnung erheben können. Als bloßer Lebensgefährtin war ihr das verwehrt – und in der Wohnung lebten noch immer Nazis. Seitdem irrte sie täglich durch den Wienerwald. Ich glaube, sie ernährte sich sogar teilweise von Beeren, bis der Hunger sie zum Betteln verurteilte.
Irgendwann zum Glück war es ihr doch gelungen, einen Prozess anzustrengen. Nach zig Jahren erfuhr ich von meiner Mutter, dass sie eine Entschädigung erhalten hatte und in einem Altersheim in ihrem geliebten Wienerwald untergekommen war. Sie soll dort sehr glücklich und zufrieden gelebt haben.
Der Stoßtseufzer meiner Mutter „Oje, die S.!“ tut der Nächstenliebe, mit der sie die damals so unglückliche Frau behandelte, keinen Abbruch. Meine Mutter war keine „geborene“ Hausfrau. Sie stand nur ungern für meinen Vater und mich am Herd. Sie war auch keine gläubige oder gar fromme Christin. Und sie hätte Frau S. nicht hereinbitten müssen.
Top-Bild: Symbol für den Kampf der Arbeiterbewegung gegen Faschismus, Klerikalismus und Kapitalismus
Online-Flyer Nr. 744 vom 13.05.2020
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE