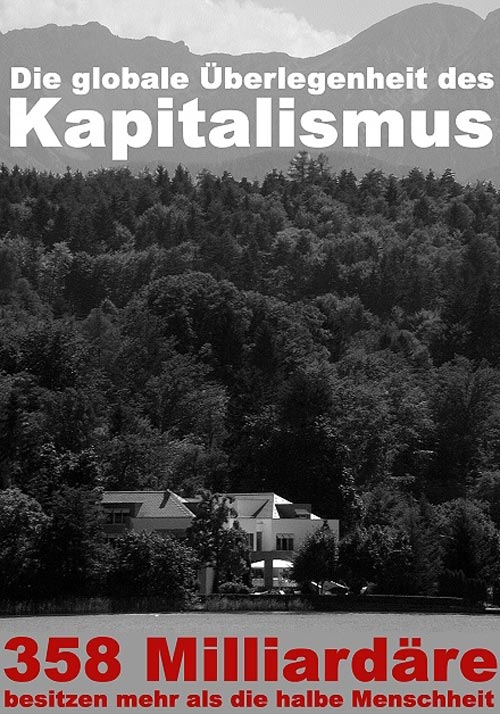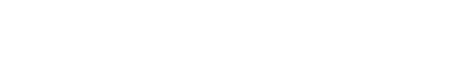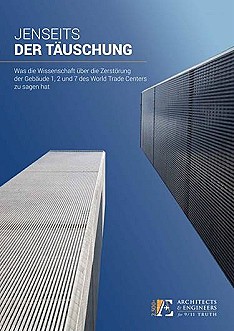SUCHE
Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen
Druckversion
Literatur
Auszug aus dem Roman
Vom letzten Tag ein Stück (1)
Von Ute Bales
 Im Roman "Vom letzten Tag ein Stück" von Ute Bales geht es ums Fortgehen und Bleiben und um den Verlust der einzigartigen Vulkanlandschaft der Eifel. Seit Jahrtausenden prägen Vulkane und Maare das Landschaftsbild der Vulkaneifel. Gesteinsabbau hat es dort immer gegeben. Der frühere Abbau, z.B. mit Pferdefuhrwerken, ist allerdings mit dem Ausmaß des heutigen Abbaus durch Sprengungen und tonnenschwere Bagger nicht zu vergleichen. Ziel ist es, Lava, Basalt und Bims in immer größeren Mengen und in immer schnellerem Tempo u.a. als Baustoffe für den Straßenbau zu gewinnen. Die Gesteine werden zu billigen Preisen in die ganze Welt verschifft. Durch den intensiven Abbau der letzten Jahrzehnte ist das Landschaftsbild vielerorts erheblich gestört. Millionen Tonnen Lava und Basalt werden jährlich in der Eifel abgebaggert. Kaum einer der Vulkane in der Region zeigt sich ohne Beschädigung. Bis Mitte dieses Jahrhunderts werden 40 bis 50 Vulkankegel komplett verschwunden sein bzw. mit minderwertigem Bauschutt wieder aufgefüllt. Zurück bleiben riesige Krater in einer ausgeschlachteten Landschaft. Eine Reduzierung der Abbauflächen ist nicht absehbar. Die Belastung für die Landschaft ist extrem. Die Berge sind gigantische Wasserspeicher. Der Abbau gefährdet nicht nur die berühmten Mineralwasserquellen, sondern auch das Trinkwasser. Tiere, Insekten und Vögel verlieren ihre Lebensgrundlage. Naturschützer und Wissenschaftler befürchten dramatische Auswirkungen auf das Klima. Die Tourismusbranche sieht sich in ihrer Existenz gefährdet. Die Menschen verlieren ihre Heimat, ihre Identität, ihre Geschichte. Die NRhZ bringt Auszüge aus dem Roman. Nachfolgend Auszug 1:
Im Roman "Vom letzten Tag ein Stück" von Ute Bales geht es ums Fortgehen und Bleiben und um den Verlust der einzigartigen Vulkanlandschaft der Eifel. Seit Jahrtausenden prägen Vulkane und Maare das Landschaftsbild der Vulkaneifel. Gesteinsabbau hat es dort immer gegeben. Der frühere Abbau, z.B. mit Pferdefuhrwerken, ist allerdings mit dem Ausmaß des heutigen Abbaus durch Sprengungen und tonnenschwere Bagger nicht zu vergleichen. Ziel ist es, Lava, Basalt und Bims in immer größeren Mengen und in immer schnellerem Tempo u.a. als Baustoffe für den Straßenbau zu gewinnen. Die Gesteine werden zu billigen Preisen in die ganze Welt verschifft. Durch den intensiven Abbau der letzten Jahrzehnte ist das Landschaftsbild vielerorts erheblich gestört. Millionen Tonnen Lava und Basalt werden jährlich in der Eifel abgebaggert. Kaum einer der Vulkane in der Region zeigt sich ohne Beschädigung. Bis Mitte dieses Jahrhunderts werden 40 bis 50 Vulkankegel komplett verschwunden sein bzw. mit minderwertigem Bauschutt wieder aufgefüllt. Zurück bleiben riesige Krater in einer ausgeschlachteten Landschaft. Eine Reduzierung der Abbauflächen ist nicht absehbar. Die Belastung für die Landschaft ist extrem. Die Berge sind gigantische Wasserspeicher. Der Abbau gefährdet nicht nur die berühmten Mineralwasserquellen, sondern auch das Trinkwasser. Tiere, Insekten und Vögel verlieren ihre Lebensgrundlage. Naturschützer und Wissenschaftler befürchten dramatische Auswirkungen auf das Klima. Die Tourismusbranche sieht sich in ihrer Existenz gefährdet. Die Menschen verlieren ihre Heimat, ihre Identität, ihre Geschichte. Die NRhZ bringt Auszüge aus dem Roman. Nachfolgend Auszug 1:

Abbau der Vulkaneifel (Foto: arbeiterfotografie.com)
1. Wenn ich die Augen schließe, ist alles wieder da: unser Berg, der Ginster, die Schlehenhecken, der Hühnervogel, der anderswo Mäusebussard heißt.
Auch Bertram ist wieder da. Er läuft mir entgegen, über die Felder, mit wehenden Haaren und geröteten Wangen. Er lacht und winkt. Ich will ihm folgen, da sehe ich das halbe Dorf herannahen, höre das Getrappel ungezählter Schuhe auf der Straße nach Norden, immer nach Norden.
Bepackt mit Koffern und Taschen eilen Männer und Frauen, Alte und Kinder in Richtung des Berges. Ein Auto überholt mich, wirbelt Staub auf, fegt mich zur Seite. „Weiter, weiter!“, schreit jemand, stößt mich mit seinem Koffer in die Rippen und, bemüht, Bertrams tanzende Mütze im Blick zu behalten, lasse ich mich mitreißen, laufe den anderen hinterher, denn die anderen, die werden schon wissen, wo es hingeht. Sie stoßen und schieben mich; ich werde Teil dieser Menge, die sich lockert und wieder dichter wird, keuchend und kommandierend, wogende Köpfe und Schultern, ein Wirbel von Beinen, stampfend und fordernd, unterwegs entlang der schmutzigen Ackerränder, hinauf auf den Gipfel.
Oben auf dem Kamm stehen wir dicht an dicht, außer Atem, und starren, die Hände über den Augen, in den Himmel, der sich zuzieht. Der Horizont glimmt rot und drohend hinter einer Wand aus Wolken. Die Wolken sind fast schwarz und lassen hier und da weißes Licht durch, das anders ist als Nebel, feiner und wärmer. Jetzt erst fällt mir auf, dass auch die Tiere da sind. Hühner und Schweine, Kühe, auch Truthähne. Die Tiere sind unruhig. Es wird bald regnen, ich kann es spüren, die Luft hat sich verändert.
Bertram steht neben mir mit seinem Feldstecher und hat schon ein ganz schiefes Gesicht vom Schauen durch das Rohr. Ich frage ihn, was er sieht, aber er reguliert nur hektisch die drehbaren Linsen seines Glases und richtet den Blick weiterhin nach oben. Ich entdecke meine Tante und winke ihr. Sie trägt ein Tuch aus Spinnweben um den Kopf und kramt in ihrer Tasche. Dann schwenkt sie eine Tafel Schokolade und ruft: „Fang auf! Fang doch!“, aber ich kann nicht zu ihr, zu viele Leute sind es und die Tante ruft und lacht und schwenkt die Schokolade und ihre weißen Zähne blitzen.
„Am Jüngsten Tag treffen wir uns oben auf dem Berg“, sagte mein Vater und seine Worte machten Mut. „Niemand braucht Angst zu haben, wenn die Erde bebt, der Himmel bricht, die Gräber umgedreht, die Seen ausgegossen werden und die anderen Berge wie Wollbüschel davonfliegen. Wir werden alle zusammenstehen. Dicht beieinander. Auch die Tiere werden dort sein. Pferde und Kühe, sogar die Hühner. Oben auf dem Kamm werden wir stehen und uns bereithalten für den allerletzten Tag. Und für die Nacht ohne Morgen.“ Das sagte mein Vater und ich konnte nicht aufhören, mir vorzustellen, was dann kommen würde.
2. Die Zeit ist schneller als ich. Sie hat mich längst überholt, hat alle überholt, sogar Bertram, von dem ich immer dachte, dass er nie einzuholen sei. „Vielleicht sind wir die Letzten“, höre ich ihn sagen, und ich weiß, was er meint.
Bertram sagt, es gibt zwei Sorten von Leuten in unserem Dorf. Diejenigen, die meinen, dass alles in der Welt besser, größer und bedeutender sei als das, was wir haben. Und diejenigen, die allem, was wir haben, eine besondere Bedeutung zuschreiben, die Dinge sozusagen erhöhen, indem sie sagen: Hör zu, bei uns daheim, da blüht jetzt der Ginster und Vulkane haben wir auch, und Quellen, deren Wasser rund um den Globus verschifft wird, und die Wiesen sind grün und die Kinder grüßen einen noch, wenn man die Straße entlang geht und aus jedem Haus geht einer mit, wenn einer gestorben ist und segnet mit einem Palmstrauß das Grab, im Namen des Vaters. Anders als in der Stadt, wo sich die Leute nicht kennen und es vorkommen kann, dass Tote tagelang in der Wohnung liegen, so lange, bis sie stinken und in erbärmlicher Einsamkeit auf einem Rasenstück verscharrt werden.
Bertram gehört zur zweiten Sorte. Er meint, dass es eine Bedeutung hat, wann und wo ein Mensch geboren ist und dass er genau dort auch hingehört. Wie ein Baum.
Ich hingegen hätte gerne woanders gelebt. In einer großen Stadt mit weitläufigen Parks, breiten Straßen und Häusern mit Aufzügen, mit einer Oper und Theatern, Kaufhäusern mit mehreren Galerien und Cafés, in die Dichter und Musiker einkehren.
Für Bertram sind die Städte keine Option. Es gibt keinen Platz dort, meint er, nicht für einen wie ihn. Es sei alles dicht an dicht, Häuser und Autos und Menschen, eine wabernde Masse, anonym und ohne Konturen. Er hasst die gleichförmigen Kulissen der Wohnblocks, die verschachtelten Hochhäuser, echauffiert sich über hässliche und menschenüberfüllte Betonklötze, über monotone Straßen und unterirdische, nach Urin stinkende Passagen, über abgezirkelte Gärten und Parkanlagen mit künstlich angelegten Beeten. „Was denken sich die, die so was bauen? Wie soll ein Mensch in so einem Siedlungsbrei leben, geschweige denn sich dort mit irgendwas verbunden fühlen?“ Sogar über Blumenkästen auf von Auspuffgasen schwarz gewordenen Balkonen regt er sich auf. Nie hätte er in einer Stadt leben können.
Früher hat Bertram auf dem Hof mitgeholfen, aber seit dem Tod der Eltern sieht er darin keinen Sinn mehr. Er hat das Vieh verkauft, aber die Felder behalten, obwohl er sie nicht nutzt. Im Dorf sagen alle, dass es mit der Landwirtschaft vorbei ist und er getrost verkaufen kann. Aber Bertram behält seine Felder. Wer weiß, was noch kommt. Er meint, dass, solange er sie behält, die Felder dann wenigstens Felder bleiben dürfen.
Bertram wohnt unterhalb unseres Berges, im letzten Haus des Dorfes. Oder im ersten. Wie man es sieht. Jedenfalls abseits. Das Grundstück umfasst mehrere Morgen. Vor dem Haus verteilen sich auf einer Wiese Obstbäume, die von einem morschen Zaun umgeben sind. Im Herbst biegen sich die Äste unter der Last der Früchte. Das Obst wächst verschwenderisch. Eimerweise Äpfel. Saftige, süßsaure Früchte.
Im Garten hinter dem Haus hat Bertrams Vater vor Jahren Kartoffeln, Rüben, Bohnen und Erbsen gezogen, aber auch Spalierobst wuchs dort und Goldruten, die mit ihrem Gelb den Nachsommer schmückten. Das Schönste war ein Mirabellenbaum, den es leider nicht mehr gibt. Er gehörte zu meiner Vorstellung vom Paradies. Im August hingen süße, runde, rotgesprenkelte Früchte an seinen Zweigen. Dann brummte der Baum vor Bienen und Wespen, und ich durfte mir die Taschen füllen, so oft ich wollte.
Bertrams Haus ist geräumig mit vielen Zimmern. Die Räume haben niedrige Decken und sind vollgestopft mit Dingen, die mehrere Generationen angesammelt haben und von denen sich Bertram nicht trennen kann. In Stall und Scheune rosten alte Gerätschaften. Im Schuppen mit dem Wellblechdach stehen ein alter Pflug und ein Schubkarren mit platten Reifen, dazu ein Trecker, der entsetzlich stinkt, wenn man ihn startet. Holzbretter lehnen an der Wand und breite Rollen Maschendrahtzaun. Winterreifen liegen aufgetürmt. Straßenbesen warten mit abgeschrubbten Borsten. Auf der Fensterbank verstauben Mittel gegen Kartoffelfäule.
An seinem Haus hat Bertram nie etwas verändert, nicht einmal eine Wand gestrichen. Obwohl er jedes Jahr einen Abreißkalender von der Sparkasse geschenkt bekommt, steht der in der Küche auf dem 6. Juni 1978. An diesem Tag starb seine Mutter. Der Kalenderspruch passt für die Ewigkeit: Solange man lebt, ist nichts endgültig.
Ansonsten schmusende Porzellankatzen und ein Nikolaus aus Plüsch zwischen Tassen und Eierbechern auf der Ablage über der Spüle. In der Ecke eine Bank und zwei Klappstühle um einen Tisch mit einer geblümten Plastiktischdecke. Der Herd ist alt und voll eingebrannter Stellen auf den Kochfeldern. Die Kühlschranktür hängt schief. Kleine Zettel sind aufgeklebt, mit Terminen, die längst vergangen sind. Die Resopaloberfläche des Küchenbuffets ist matt geworden, die Schubladen schließen nicht. Die Schiebetüren der Hängeschränke haken, aber das ist Bertram egal. Das einzig Schöne in der Küche ist ein gusseiserner Ofen aus der Eisengießerei in Quint, mit Löwenfüßen und einem verzierten Aufsatz. Ich habe nicht erlebt, dass er benutzt wurde.
Im Wohnzimmer hat sich nie einer aufgehalten. Düster ist es dort, schon wegen der dichten Vorhänge. Zinnkrüge stehen in einer Schrankwand aus Eiche massiv neben Vasen aus Bleikristall. Daneben ein Röhrenfernseher auf einem Holzgestell. Zwei schwere Sessel sind um einen Couchtisch mit Marmorplatte gruppiert. An der Wand Karnevalsorden, die der Vater gesammelt hat und ein Foto der Abtei Maria Laach. Die Bücherregale reichen vom Boden bis an die Decke. Die Bretter biegen sich vor Ordnern, Heftchen, losen Blättern und Fotoalben. Die Bücher stehen ohne System; manche sind mit dem Rücken hineingeschoben worden, so dass man die Titel nicht lesen kann. Es sind gute Sachen dabei: Thomas Mann und Balzac, Keller und Raabe, Tolstoi und Dostojewski, alles von Storm und Fontane, ebenfalls von Rilke. Die Bücher haben braune Flecken. In manchen stecken Lesezeichen.
Bertrams Zimmer ist das Chaos selbst. Sogar an heißen Tagen ist es klamm dort und riecht nach Holz und Winter und Räucherstäbchen. Spinnen leben sorglos.
Über der Tür hängen ein grauer Arbeitsanzug und ein kariertes Flanellhemd. Neben dem Bett, auf dem Boden, liegt ein Kassettenrekorder mit geöffneter Klappe. Daneben steht eine Rotweinflasche, in der eine Kerze steckt, die das Etikett zugetropft hat. An einer mit Stoff bespannten Lampe dreht sich eine Papierblume. Postkarten sind an die Wand geklebt: Grüße vom Bodensee und von den Kanarischen Inseln. Dahinter stecken Vogelfedern. Vor dem Nachtschränkchen liegt ein filzig gewordenes Schaffell. Auf der Fensterbank staubt ein Sammelsurium: ein Flummi, eine Taschenlampe, ein Stück Kordel, eine Glühbirne, eine Muschel und ein abgegriffenes Tütchen Natron.
Rechts vom Schrank und unbedingt erwähnenswert: Bertrams Gitarre und das Klavier der Marke Irmler, schwarz poliert mit goldenen Medaillen.
Bertram besitzt eine ungewöhnliche Plattensammlung. Er hat alles von Miles Davis, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk und Charlie Parker. Um eines seiner Stones-Alben beneiden ihn alle: die Originalausgabe von Sticky Fingers, die mit der Jeans und dem Reißverschluss. Auf CDs verzichtet er, schwört auf die Qualität seines Plattenspielers.
Bertram steckt in einer anderen Zeit. Anders als meine sind seine Erinnerungen Teile der Gegenwart. Alles, was passiert, ist für ihn eine Folge von Verkettungen und hat immer eine Ursache. So glaubt er, dass das Haus, in dem er wohnt, Teil einer unendlichen Geschichte ist, so wie er selbst. Ein Netz von Zusammenhängen eben, mit unzählbaren Verzweigungen. Er ist sicher, dass er sich in einem Raum bewegt, der in seinem Inneren längst angelegt ist und dass dieser Raum etwas von ihm erwartet, dass er sich also nicht umsonst zu exakt dieser Zeit genau hier aufhält. So ähnlich sagt er das.
Seit die Eltern tot sind, hat er sich keine Klamotten mehr gekauft. Er meint, dass man der Kleidung Zeit geben müsse, sich dem Träger anzupassen und man sie deshalb nicht allzu häufig wechseln dürfe; er bleibt bei Jeans mit Nietengürtel und Tennissocken, einer abgeschabten Lederjacke und seinem Pferdeschwanz, durch den sich früh schon graue Strähnen ziehen. Sein Gesicht ist mager und sieht besonders an den Wangenknochen so aus, als hätten sich alle Muskeln dort versammelt. Eine Haarsträhne hängt ihm permanent in die Stirn, teilt das Gesicht und scheint von einer Kerbe am Kinn gleichsam fortgesetzt zu werden. Die Augen sind grau und nachdenklich, jedenfalls oft. Der schwarze Pulli, den er fast immer trägt, ist an den Ärmelbündchen geriffelt und löchrig. Seine Brille – das Gestell hat einst dem Großvater gehört - hält dank transparentem Klebeband. Die Fingerspitzen, besonders Zeigefinger und Mittelfinger, sind braun vom Nikotin selbstgedrehter Javaanse Jongens. Er dreht immer mehrere Zigaretten auf Vorrat, weil der blondkräuselige Javaanse so schnell austrocknet und ins Pulvrige wechselt, obwohl Bertram zur Tabakbefeuchtung Apfel- oder Möhrenscheibchen in die Packung legt.
Bertram fährt einen VW-Bus, mit dem er in jungen Jahren nach Indien wollte, eine Reise, die er schließlich trampend realisierte und von der er außer Gelbsucht, die er sich bei einem Tätowierer eingefangen hatte, ein anderes Lebensgefühl mitbrachte.
Bertram lebt allein. Allenfalls hätte er mit einer Frau so leben wollen wie Sartre mit Simone de Beauvoir. Frei. Heiraten und Familie, nein, das ginge nicht, sagt Bertram.
Obwohl ich ihm zu einer Waschmaschine geraten und auch erklärt habe, wie man 30, 40 und 60-Grad Wäsche sortiert, füllt er von Zeit zu Zeit die Badewanne mit Wasser, streut Waschpulver hinein, weicht Kleidung, Handtücher, Unterwäsche und Bettbezüge in bläulichem Schaum, walkt alles durch, wringt die Stücke, bis seine Hände rot werden, und behängt die Leine auf der Wiese.
Waschmaschinen kauft man nicht, sagte er. Man müsse nur abwarten, es gäbe genug davon, Luxusmüll. Irgendwann würde er eine finden, abgestellt irgendwo an der Straße, mit kleinen Defekten, die leicht auszubessern wären. So sei es auch mit Fernsehern. Die kaufe man genauso wenig. Sobald es kleine technische Änderungen gäbe, bräuchte man nur auf den Sperrmüll zu warten.
Bertram nennt unser Dorf ein Kuhdorf. Ich widerspreche. Ein Kuhdorf ist unser Dorf nicht, denn Kühe gibt es kaum noch, jedenfalls keine glücklichen. Die, die noch da sind, leben zwei Kilometer entfernt, gehören einem holländischen Milchbetrieb und haben noch nie den Himmel gesehen. Trotzdem schreibt der Betrieb ‚Weidekühe´ auf die Milchtüte. Die Kühe dort werden jeden Tag dreimal gemolken, nicht, wie es sich gehört, zweimal. Ich habe gelesen, dass es Hochleistungskühe sind, die rund 18.000 Liter Milch pro Jahr geben, was Bertram für unmöglich hält. Das wären nämlich im Schnitt 50 Liter pro Tag. Eine glückliche Kuh auf der Weide gibt nur 20 bis 25 Liter Milch. Das ist den Holländern zu wenig. Das geht zu langsam. Schneller muss es gehen, schneller. Kilometerweit stinkt Gülle. Die Weiden sind voll davon.
„Die Kühe haben zu tun“, sagt Bertram, verzieht den Mund und schiebt ein leises Pfeifen durch die Zähne. Während er nach den Pflanzen auf dem Fensterbrett sieht, mit den Fingern die Erde um die Wurzelstöcke lockert und dann verschrumpelte Blätter abknickt, meint er, dass sich sein Vater im Grab umdrehen würde, wenn er wüsste, wie die Leute heute mit dem Vieh umgehen. Aber das bezweifle ich. Bertrams Vater ist nämlich eingeäschert worden, und es steht fest, dass für Eingeäscherte dieser Spruch nicht gelten kann.
Ute Bales: "Vom letzten Tag ein Stück"

Gebunden, Schutzumschlag, 246 Seiten, ISBN 978-3-89801-442-7, 19,80 Euro
Online-Flyer Nr. 777 vom 22.09.2021
Druckversion
Literatur
Auszug aus dem Roman
Vom letzten Tag ein Stück (1)
Von Ute Bales
 Im Roman "Vom letzten Tag ein Stück" von Ute Bales geht es ums Fortgehen und Bleiben und um den Verlust der einzigartigen Vulkanlandschaft der Eifel. Seit Jahrtausenden prägen Vulkane und Maare das Landschaftsbild der Vulkaneifel. Gesteinsabbau hat es dort immer gegeben. Der frühere Abbau, z.B. mit Pferdefuhrwerken, ist allerdings mit dem Ausmaß des heutigen Abbaus durch Sprengungen und tonnenschwere Bagger nicht zu vergleichen. Ziel ist es, Lava, Basalt und Bims in immer größeren Mengen und in immer schnellerem Tempo u.a. als Baustoffe für den Straßenbau zu gewinnen. Die Gesteine werden zu billigen Preisen in die ganze Welt verschifft. Durch den intensiven Abbau der letzten Jahrzehnte ist das Landschaftsbild vielerorts erheblich gestört. Millionen Tonnen Lava und Basalt werden jährlich in der Eifel abgebaggert. Kaum einer der Vulkane in der Region zeigt sich ohne Beschädigung. Bis Mitte dieses Jahrhunderts werden 40 bis 50 Vulkankegel komplett verschwunden sein bzw. mit minderwertigem Bauschutt wieder aufgefüllt. Zurück bleiben riesige Krater in einer ausgeschlachteten Landschaft. Eine Reduzierung der Abbauflächen ist nicht absehbar. Die Belastung für die Landschaft ist extrem. Die Berge sind gigantische Wasserspeicher. Der Abbau gefährdet nicht nur die berühmten Mineralwasserquellen, sondern auch das Trinkwasser. Tiere, Insekten und Vögel verlieren ihre Lebensgrundlage. Naturschützer und Wissenschaftler befürchten dramatische Auswirkungen auf das Klima. Die Tourismusbranche sieht sich in ihrer Existenz gefährdet. Die Menschen verlieren ihre Heimat, ihre Identität, ihre Geschichte. Die NRhZ bringt Auszüge aus dem Roman. Nachfolgend Auszug 1:
Im Roman "Vom letzten Tag ein Stück" von Ute Bales geht es ums Fortgehen und Bleiben und um den Verlust der einzigartigen Vulkanlandschaft der Eifel. Seit Jahrtausenden prägen Vulkane und Maare das Landschaftsbild der Vulkaneifel. Gesteinsabbau hat es dort immer gegeben. Der frühere Abbau, z.B. mit Pferdefuhrwerken, ist allerdings mit dem Ausmaß des heutigen Abbaus durch Sprengungen und tonnenschwere Bagger nicht zu vergleichen. Ziel ist es, Lava, Basalt und Bims in immer größeren Mengen und in immer schnellerem Tempo u.a. als Baustoffe für den Straßenbau zu gewinnen. Die Gesteine werden zu billigen Preisen in die ganze Welt verschifft. Durch den intensiven Abbau der letzten Jahrzehnte ist das Landschaftsbild vielerorts erheblich gestört. Millionen Tonnen Lava und Basalt werden jährlich in der Eifel abgebaggert. Kaum einer der Vulkane in der Region zeigt sich ohne Beschädigung. Bis Mitte dieses Jahrhunderts werden 40 bis 50 Vulkankegel komplett verschwunden sein bzw. mit minderwertigem Bauschutt wieder aufgefüllt. Zurück bleiben riesige Krater in einer ausgeschlachteten Landschaft. Eine Reduzierung der Abbauflächen ist nicht absehbar. Die Belastung für die Landschaft ist extrem. Die Berge sind gigantische Wasserspeicher. Der Abbau gefährdet nicht nur die berühmten Mineralwasserquellen, sondern auch das Trinkwasser. Tiere, Insekten und Vögel verlieren ihre Lebensgrundlage. Naturschützer und Wissenschaftler befürchten dramatische Auswirkungen auf das Klima. Die Tourismusbranche sieht sich in ihrer Existenz gefährdet. Die Menschen verlieren ihre Heimat, ihre Identität, ihre Geschichte. Die NRhZ bringt Auszüge aus dem Roman. Nachfolgend Auszug 1:
Abbau der Vulkaneifel (Foto: arbeiterfotografie.com)
1. Wenn ich die Augen schließe, ist alles wieder da: unser Berg, der Ginster, die Schlehenhecken, der Hühnervogel, der anderswo Mäusebussard heißt.
Auch Bertram ist wieder da. Er läuft mir entgegen, über die Felder, mit wehenden Haaren und geröteten Wangen. Er lacht und winkt. Ich will ihm folgen, da sehe ich das halbe Dorf herannahen, höre das Getrappel ungezählter Schuhe auf der Straße nach Norden, immer nach Norden.
Bepackt mit Koffern und Taschen eilen Männer und Frauen, Alte und Kinder in Richtung des Berges. Ein Auto überholt mich, wirbelt Staub auf, fegt mich zur Seite. „Weiter, weiter!“, schreit jemand, stößt mich mit seinem Koffer in die Rippen und, bemüht, Bertrams tanzende Mütze im Blick zu behalten, lasse ich mich mitreißen, laufe den anderen hinterher, denn die anderen, die werden schon wissen, wo es hingeht. Sie stoßen und schieben mich; ich werde Teil dieser Menge, die sich lockert und wieder dichter wird, keuchend und kommandierend, wogende Köpfe und Schultern, ein Wirbel von Beinen, stampfend und fordernd, unterwegs entlang der schmutzigen Ackerränder, hinauf auf den Gipfel.
Oben auf dem Kamm stehen wir dicht an dicht, außer Atem, und starren, die Hände über den Augen, in den Himmel, der sich zuzieht. Der Horizont glimmt rot und drohend hinter einer Wand aus Wolken. Die Wolken sind fast schwarz und lassen hier und da weißes Licht durch, das anders ist als Nebel, feiner und wärmer. Jetzt erst fällt mir auf, dass auch die Tiere da sind. Hühner und Schweine, Kühe, auch Truthähne. Die Tiere sind unruhig. Es wird bald regnen, ich kann es spüren, die Luft hat sich verändert.
Bertram steht neben mir mit seinem Feldstecher und hat schon ein ganz schiefes Gesicht vom Schauen durch das Rohr. Ich frage ihn, was er sieht, aber er reguliert nur hektisch die drehbaren Linsen seines Glases und richtet den Blick weiterhin nach oben. Ich entdecke meine Tante und winke ihr. Sie trägt ein Tuch aus Spinnweben um den Kopf und kramt in ihrer Tasche. Dann schwenkt sie eine Tafel Schokolade und ruft: „Fang auf! Fang doch!“, aber ich kann nicht zu ihr, zu viele Leute sind es und die Tante ruft und lacht und schwenkt die Schokolade und ihre weißen Zähne blitzen.
„Am Jüngsten Tag treffen wir uns oben auf dem Berg“, sagte mein Vater und seine Worte machten Mut. „Niemand braucht Angst zu haben, wenn die Erde bebt, der Himmel bricht, die Gräber umgedreht, die Seen ausgegossen werden und die anderen Berge wie Wollbüschel davonfliegen. Wir werden alle zusammenstehen. Dicht beieinander. Auch die Tiere werden dort sein. Pferde und Kühe, sogar die Hühner. Oben auf dem Kamm werden wir stehen und uns bereithalten für den allerletzten Tag. Und für die Nacht ohne Morgen.“ Das sagte mein Vater und ich konnte nicht aufhören, mir vorzustellen, was dann kommen würde.
2. Die Zeit ist schneller als ich. Sie hat mich längst überholt, hat alle überholt, sogar Bertram, von dem ich immer dachte, dass er nie einzuholen sei. „Vielleicht sind wir die Letzten“, höre ich ihn sagen, und ich weiß, was er meint.
Bertram sagt, es gibt zwei Sorten von Leuten in unserem Dorf. Diejenigen, die meinen, dass alles in der Welt besser, größer und bedeutender sei als das, was wir haben. Und diejenigen, die allem, was wir haben, eine besondere Bedeutung zuschreiben, die Dinge sozusagen erhöhen, indem sie sagen: Hör zu, bei uns daheim, da blüht jetzt der Ginster und Vulkane haben wir auch, und Quellen, deren Wasser rund um den Globus verschifft wird, und die Wiesen sind grün und die Kinder grüßen einen noch, wenn man die Straße entlang geht und aus jedem Haus geht einer mit, wenn einer gestorben ist und segnet mit einem Palmstrauß das Grab, im Namen des Vaters. Anders als in der Stadt, wo sich die Leute nicht kennen und es vorkommen kann, dass Tote tagelang in der Wohnung liegen, so lange, bis sie stinken und in erbärmlicher Einsamkeit auf einem Rasenstück verscharrt werden.
Bertram gehört zur zweiten Sorte. Er meint, dass es eine Bedeutung hat, wann und wo ein Mensch geboren ist und dass er genau dort auch hingehört. Wie ein Baum.
Ich hingegen hätte gerne woanders gelebt. In einer großen Stadt mit weitläufigen Parks, breiten Straßen und Häusern mit Aufzügen, mit einer Oper und Theatern, Kaufhäusern mit mehreren Galerien und Cafés, in die Dichter und Musiker einkehren.
Für Bertram sind die Städte keine Option. Es gibt keinen Platz dort, meint er, nicht für einen wie ihn. Es sei alles dicht an dicht, Häuser und Autos und Menschen, eine wabernde Masse, anonym und ohne Konturen. Er hasst die gleichförmigen Kulissen der Wohnblocks, die verschachtelten Hochhäuser, echauffiert sich über hässliche und menschenüberfüllte Betonklötze, über monotone Straßen und unterirdische, nach Urin stinkende Passagen, über abgezirkelte Gärten und Parkanlagen mit künstlich angelegten Beeten. „Was denken sich die, die so was bauen? Wie soll ein Mensch in so einem Siedlungsbrei leben, geschweige denn sich dort mit irgendwas verbunden fühlen?“ Sogar über Blumenkästen auf von Auspuffgasen schwarz gewordenen Balkonen regt er sich auf. Nie hätte er in einer Stadt leben können.
Früher hat Bertram auf dem Hof mitgeholfen, aber seit dem Tod der Eltern sieht er darin keinen Sinn mehr. Er hat das Vieh verkauft, aber die Felder behalten, obwohl er sie nicht nutzt. Im Dorf sagen alle, dass es mit der Landwirtschaft vorbei ist und er getrost verkaufen kann. Aber Bertram behält seine Felder. Wer weiß, was noch kommt. Er meint, dass, solange er sie behält, die Felder dann wenigstens Felder bleiben dürfen.
Bertram wohnt unterhalb unseres Berges, im letzten Haus des Dorfes. Oder im ersten. Wie man es sieht. Jedenfalls abseits. Das Grundstück umfasst mehrere Morgen. Vor dem Haus verteilen sich auf einer Wiese Obstbäume, die von einem morschen Zaun umgeben sind. Im Herbst biegen sich die Äste unter der Last der Früchte. Das Obst wächst verschwenderisch. Eimerweise Äpfel. Saftige, süßsaure Früchte.
Im Garten hinter dem Haus hat Bertrams Vater vor Jahren Kartoffeln, Rüben, Bohnen und Erbsen gezogen, aber auch Spalierobst wuchs dort und Goldruten, die mit ihrem Gelb den Nachsommer schmückten. Das Schönste war ein Mirabellenbaum, den es leider nicht mehr gibt. Er gehörte zu meiner Vorstellung vom Paradies. Im August hingen süße, runde, rotgesprenkelte Früchte an seinen Zweigen. Dann brummte der Baum vor Bienen und Wespen, und ich durfte mir die Taschen füllen, so oft ich wollte.
Bertrams Haus ist geräumig mit vielen Zimmern. Die Räume haben niedrige Decken und sind vollgestopft mit Dingen, die mehrere Generationen angesammelt haben und von denen sich Bertram nicht trennen kann. In Stall und Scheune rosten alte Gerätschaften. Im Schuppen mit dem Wellblechdach stehen ein alter Pflug und ein Schubkarren mit platten Reifen, dazu ein Trecker, der entsetzlich stinkt, wenn man ihn startet. Holzbretter lehnen an der Wand und breite Rollen Maschendrahtzaun. Winterreifen liegen aufgetürmt. Straßenbesen warten mit abgeschrubbten Borsten. Auf der Fensterbank verstauben Mittel gegen Kartoffelfäule.
An seinem Haus hat Bertram nie etwas verändert, nicht einmal eine Wand gestrichen. Obwohl er jedes Jahr einen Abreißkalender von der Sparkasse geschenkt bekommt, steht der in der Küche auf dem 6. Juni 1978. An diesem Tag starb seine Mutter. Der Kalenderspruch passt für die Ewigkeit: Solange man lebt, ist nichts endgültig.
Ansonsten schmusende Porzellankatzen und ein Nikolaus aus Plüsch zwischen Tassen und Eierbechern auf der Ablage über der Spüle. In der Ecke eine Bank und zwei Klappstühle um einen Tisch mit einer geblümten Plastiktischdecke. Der Herd ist alt und voll eingebrannter Stellen auf den Kochfeldern. Die Kühlschranktür hängt schief. Kleine Zettel sind aufgeklebt, mit Terminen, die längst vergangen sind. Die Resopaloberfläche des Küchenbuffets ist matt geworden, die Schubladen schließen nicht. Die Schiebetüren der Hängeschränke haken, aber das ist Bertram egal. Das einzig Schöne in der Küche ist ein gusseiserner Ofen aus der Eisengießerei in Quint, mit Löwenfüßen und einem verzierten Aufsatz. Ich habe nicht erlebt, dass er benutzt wurde.
Im Wohnzimmer hat sich nie einer aufgehalten. Düster ist es dort, schon wegen der dichten Vorhänge. Zinnkrüge stehen in einer Schrankwand aus Eiche massiv neben Vasen aus Bleikristall. Daneben ein Röhrenfernseher auf einem Holzgestell. Zwei schwere Sessel sind um einen Couchtisch mit Marmorplatte gruppiert. An der Wand Karnevalsorden, die der Vater gesammelt hat und ein Foto der Abtei Maria Laach. Die Bücherregale reichen vom Boden bis an die Decke. Die Bretter biegen sich vor Ordnern, Heftchen, losen Blättern und Fotoalben. Die Bücher stehen ohne System; manche sind mit dem Rücken hineingeschoben worden, so dass man die Titel nicht lesen kann. Es sind gute Sachen dabei: Thomas Mann und Balzac, Keller und Raabe, Tolstoi und Dostojewski, alles von Storm und Fontane, ebenfalls von Rilke. Die Bücher haben braune Flecken. In manchen stecken Lesezeichen.
Bertrams Zimmer ist das Chaos selbst. Sogar an heißen Tagen ist es klamm dort und riecht nach Holz und Winter und Räucherstäbchen. Spinnen leben sorglos.
Über der Tür hängen ein grauer Arbeitsanzug und ein kariertes Flanellhemd. Neben dem Bett, auf dem Boden, liegt ein Kassettenrekorder mit geöffneter Klappe. Daneben steht eine Rotweinflasche, in der eine Kerze steckt, die das Etikett zugetropft hat. An einer mit Stoff bespannten Lampe dreht sich eine Papierblume. Postkarten sind an die Wand geklebt: Grüße vom Bodensee und von den Kanarischen Inseln. Dahinter stecken Vogelfedern. Vor dem Nachtschränkchen liegt ein filzig gewordenes Schaffell. Auf der Fensterbank staubt ein Sammelsurium: ein Flummi, eine Taschenlampe, ein Stück Kordel, eine Glühbirne, eine Muschel und ein abgegriffenes Tütchen Natron.
Rechts vom Schrank und unbedingt erwähnenswert: Bertrams Gitarre und das Klavier der Marke Irmler, schwarz poliert mit goldenen Medaillen.
Bertram besitzt eine ungewöhnliche Plattensammlung. Er hat alles von Miles Davis, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk und Charlie Parker. Um eines seiner Stones-Alben beneiden ihn alle: die Originalausgabe von Sticky Fingers, die mit der Jeans und dem Reißverschluss. Auf CDs verzichtet er, schwört auf die Qualität seines Plattenspielers.
Bertram steckt in einer anderen Zeit. Anders als meine sind seine Erinnerungen Teile der Gegenwart. Alles, was passiert, ist für ihn eine Folge von Verkettungen und hat immer eine Ursache. So glaubt er, dass das Haus, in dem er wohnt, Teil einer unendlichen Geschichte ist, so wie er selbst. Ein Netz von Zusammenhängen eben, mit unzählbaren Verzweigungen. Er ist sicher, dass er sich in einem Raum bewegt, der in seinem Inneren längst angelegt ist und dass dieser Raum etwas von ihm erwartet, dass er sich also nicht umsonst zu exakt dieser Zeit genau hier aufhält. So ähnlich sagt er das.
Seit die Eltern tot sind, hat er sich keine Klamotten mehr gekauft. Er meint, dass man der Kleidung Zeit geben müsse, sich dem Träger anzupassen und man sie deshalb nicht allzu häufig wechseln dürfe; er bleibt bei Jeans mit Nietengürtel und Tennissocken, einer abgeschabten Lederjacke und seinem Pferdeschwanz, durch den sich früh schon graue Strähnen ziehen. Sein Gesicht ist mager und sieht besonders an den Wangenknochen so aus, als hätten sich alle Muskeln dort versammelt. Eine Haarsträhne hängt ihm permanent in die Stirn, teilt das Gesicht und scheint von einer Kerbe am Kinn gleichsam fortgesetzt zu werden. Die Augen sind grau und nachdenklich, jedenfalls oft. Der schwarze Pulli, den er fast immer trägt, ist an den Ärmelbündchen geriffelt und löchrig. Seine Brille – das Gestell hat einst dem Großvater gehört - hält dank transparentem Klebeband. Die Fingerspitzen, besonders Zeigefinger und Mittelfinger, sind braun vom Nikotin selbstgedrehter Javaanse Jongens. Er dreht immer mehrere Zigaretten auf Vorrat, weil der blondkräuselige Javaanse so schnell austrocknet und ins Pulvrige wechselt, obwohl Bertram zur Tabakbefeuchtung Apfel- oder Möhrenscheibchen in die Packung legt.
Bertram fährt einen VW-Bus, mit dem er in jungen Jahren nach Indien wollte, eine Reise, die er schließlich trampend realisierte und von der er außer Gelbsucht, die er sich bei einem Tätowierer eingefangen hatte, ein anderes Lebensgefühl mitbrachte.
Bertram lebt allein. Allenfalls hätte er mit einer Frau so leben wollen wie Sartre mit Simone de Beauvoir. Frei. Heiraten und Familie, nein, das ginge nicht, sagt Bertram.
Obwohl ich ihm zu einer Waschmaschine geraten und auch erklärt habe, wie man 30, 40 und 60-Grad Wäsche sortiert, füllt er von Zeit zu Zeit die Badewanne mit Wasser, streut Waschpulver hinein, weicht Kleidung, Handtücher, Unterwäsche und Bettbezüge in bläulichem Schaum, walkt alles durch, wringt die Stücke, bis seine Hände rot werden, und behängt die Leine auf der Wiese.
Waschmaschinen kauft man nicht, sagte er. Man müsse nur abwarten, es gäbe genug davon, Luxusmüll. Irgendwann würde er eine finden, abgestellt irgendwo an der Straße, mit kleinen Defekten, die leicht auszubessern wären. So sei es auch mit Fernsehern. Die kaufe man genauso wenig. Sobald es kleine technische Änderungen gäbe, bräuchte man nur auf den Sperrmüll zu warten.
Bertram nennt unser Dorf ein Kuhdorf. Ich widerspreche. Ein Kuhdorf ist unser Dorf nicht, denn Kühe gibt es kaum noch, jedenfalls keine glücklichen. Die, die noch da sind, leben zwei Kilometer entfernt, gehören einem holländischen Milchbetrieb und haben noch nie den Himmel gesehen. Trotzdem schreibt der Betrieb ‚Weidekühe´ auf die Milchtüte. Die Kühe dort werden jeden Tag dreimal gemolken, nicht, wie es sich gehört, zweimal. Ich habe gelesen, dass es Hochleistungskühe sind, die rund 18.000 Liter Milch pro Jahr geben, was Bertram für unmöglich hält. Das wären nämlich im Schnitt 50 Liter pro Tag. Eine glückliche Kuh auf der Weide gibt nur 20 bis 25 Liter Milch. Das ist den Holländern zu wenig. Das geht zu langsam. Schneller muss es gehen, schneller. Kilometerweit stinkt Gülle. Die Weiden sind voll davon.
„Die Kühe haben zu tun“, sagt Bertram, verzieht den Mund und schiebt ein leises Pfeifen durch die Zähne. Während er nach den Pflanzen auf dem Fensterbrett sieht, mit den Fingern die Erde um die Wurzelstöcke lockert und dann verschrumpelte Blätter abknickt, meint er, dass sich sein Vater im Grab umdrehen würde, wenn er wüsste, wie die Leute heute mit dem Vieh umgehen. Aber das bezweifle ich. Bertrams Vater ist nämlich eingeäschert worden, und es steht fest, dass für Eingeäscherte dieser Spruch nicht gelten kann.
Ute Bales: "Vom letzten Tag ein Stück"

Gebunden, Schutzumschlag, 246 Seiten, ISBN 978-3-89801-442-7, 19,80 Euro
Online-Flyer Nr. 777 vom 22.09.2021
Druckversion
NEWS
KÖLNER KLAGEMAUER
FILMCLIP
FOTOGALERIE